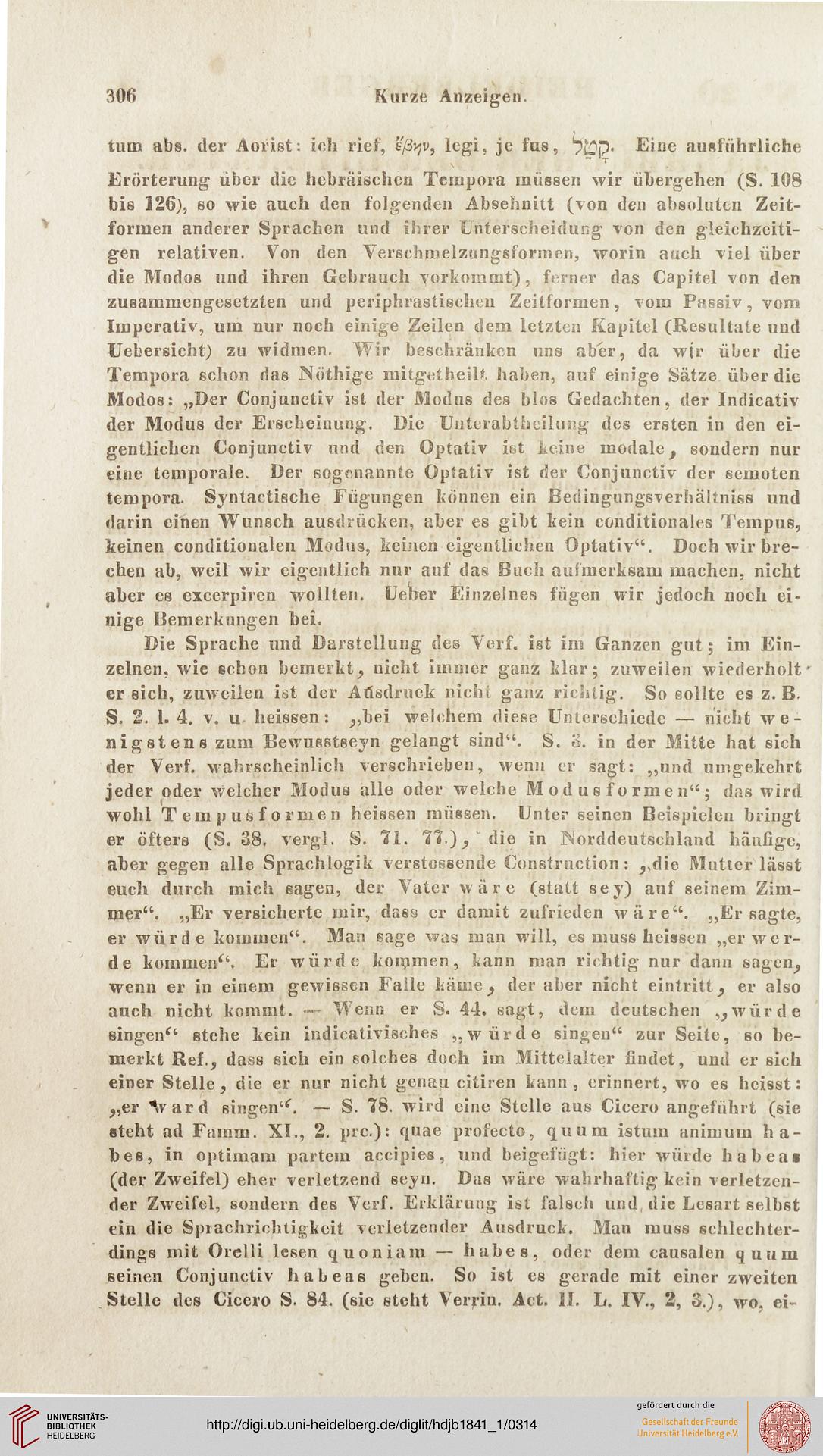306
Kurze Anzeigen.
tum abs. der Aorist: loh rief, t'ßyv, legi, je fus, ^p. Eine ausführliche
Erörterung über die hebräischen Tempora müssen wir übergehen (S. 108
bis 126), so wie auch den folgenden Absehnitt (von den absoluten Zeit-
formen anderer Sprachen und ihrer Unterscheidung von den gleichzeiti-
gen relativen. Von den Verschmelzungsformen, worin auch viel über
die Modos und ihren Gebrauch yorkommt), ferner das Capitel von den
zusammengesetzten und periphrastischen Zeitformen, vom Passiv, vom
Imperativ, um nur noch einige Zeilen dem letzten Kapitel (Resultate und
Uebersicht) zu widmen. Wir beschränken uns aber, da wir über die
Tempora schon das Nöthige mitgetheilt haben, auf einige Sätze über die
Modos: „Der Conjunetiv ist der Modus des blos Gedachten, der Indicativ
der Modus der Erscheinung. Die Unterabtheilung des ersten in den ei-
gentlichen Conjunetiv und den Optativ ist keine modale, sondern nur
eine temporale. Der sogenannte Optativ ist der Conjunetiv der semoten
tempora. Syntactische Fügungen können ein Bedingungsverhältmss und
darin einen Wunsch ausdrücken, aber es gibt kein conditionales Tempus,
keinen conditionalen Modus, keinen eigentlichen Optativ“. Doch wir bre-
chen ab, weil wir eigentlich nur auf das Buch aufmerksam machen, nicht
aber es excerpircn wollten. Uetaer Einzelnes fügen wir jedoch noch ei-
nige Bemerkungen bei.
Die Sprache und Darstellung des Verf. ist im Ganzen gut; im Ein-
zelnen, wie schon bemerkt, nicht immer ganz klar; zuweilen wiederholt
er sich, zuweilen ist der Aüsdruek nicht ganz richtig. So sollte es z. B.
S. 2. 1. 4. v. u heissen: „bei welchem diese Unterschiede — nicht we-
nigstens zum Bewusstsein gelangt sind“. S. 3. in der Mitte hat sich
der Verf. wahrscheinlich verschrieben, wenn er sagt: „und umgekehrt
jeder oder welcher Modus alle oder welche Modusformen“; das wird
wohl Tempus formen heissen müssen. Unter seinen Beispielen bringt
er öfters (§. 38. vergl. S. 11. 11.), die in Norddeutsehland häufige,
aber gegen alle Sprachlogik verstossende Construction: „die Mutter lässt
eucli durch mich sagen, der Vater wäre (statt sey) auf seinem Zim-
mer“. „Er versicherte mir, dass er damit zufrieden wäre“. „Er sagte,
er würde kommen“. Man sage was man will, es muss heissen „er wer-
de kommen“. Er würde korpmen, kann man richtig nur dann sagen,
wenn er in einem gewissen Falle käme , der aber nicht eintritt, er also
auch nicht kommt. — Wenn er §. 44. sagt, dem deutschen „würde
singen“ stehe kein indicativisches „würde singen“ zur Seite, so be-
merkt Ref., dass sich ein solches doch im Mittelalter findet, und er sich
einer Stelle, die er nur nicht genau citiren kann, erinnert, wo es heisst:
„er Vard singen1*. — S. 18. wird eine Stelle aus Cicero angeführt (sie
steht ad Faram. XI., 2. prc.): quae profecto, quum istum animum ha-
be«, in opthnam partem accipies, und beigefügt: hier würde habeai
(der Zweifel) eher verletzend seyn. Das wäre wahrhaftig kein verletzen-
der Zweifel, sondern des Verf. Erklärung ist falsch und, die Lesart selbst
ein die Sprachriohtigkeit verletzender Ausdruck. Man muss schlechter-
dings mit Orelli lesen quoniam — habes, oder dem causalen quum
seinen Conjunetiv ha Leas geben. So ist es gerade mit einer zweiten
Stelle des Cicero S. 84. (sie steht Verrin. Aet. II. L. IV., 2, 3.), wo, ei-
Kurze Anzeigen.
tum abs. der Aorist: loh rief, t'ßyv, legi, je fus, ^p. Eine ausführliche
Erörterung über die hebräischen Tempora müssen wir übergehen (S. 108
bis 126), so wie auch den folgenden Absehnitt (von den absoluten Zeit-
formen anderer Sprachen und ihrer Unterscheidung von den gleichzeiti-
gen relativen. Von den Verschmelzungsformen, worin auch viel über
die Modos und ihren Gebrauch yorkommt), ferner das Capitel von den
zusammengesetzten und periphrastischen Zeitformen, vom Passiv, vom
Imperativ, um nur noch einige Zeilen dem letzten Kapitel (Resultate und
Uebersicht) zu widmen. Wir beschränken uns aber, da wir über die
Tempora schon das Nöthige mitgetheilt haben, auf einige Sätze über die
Modos: „Der Conjunetiv ist der Modus des blos Gedachten, der Indicativ
der Modus der Erscheinung. Die Unterabtheilung des ersten in den ei-
gentlichen Conjunetiv und den Optativ ist keine modale, sondern nur
eine temporale. Der sogenannte Optativ ist der Conjunetiv der semoten
tempora. Syntactische Fügungen können ein Bedingungsverhältmss und
darin einen Wunsch ausdrücken, aber es gibt kein conditionales Tempus,
keinen conditionalen Modus, keinen eigentlichen Optativ“. Doch wir bre-
chen ab, weil wir eigentlich nur auf das Buch aufmerksam machen, nicht
aber es excerpircn wollten. Uetaer Einzelnes fügen wir jedoch noch ei-
nige Bemerkungen bei.
Die Sprache und Darstellung des Verf. ist im Ganzen gut; im Ein-
zelnen, wie schon bemerkt, nicht immer ganz klar; zuweilen wiederholt
er sich, zuweilen ist der Aüsdruek nicht ganz richtig. So sollte es z. B.
S. 2. 1. 4. v. u heissen: „bei welchem diese Unterschiede — nicht we-
nigstens zum Bewusstsein gelangt sind“. S. 3. in der Mitte hat sich
der Verf. wahrscheinlich verschrieben, wenn er sagt: „und umgekehrt
jeder oder welcher Modus alle oder welche Modusformen“; das wird
wohl Tempus formen heissen müssen. Unter seinen Beispielen bringt
er öfters (§. 38. vergl. S. 11. 11.), die in Norddeutsehland häufige,
aber gegen alle Sprachlogik verstossende Construction: „die Mutter lässt
eucli durch mich sagen, der Vater wäre (statt sey) auf seinem Zim-
mer“. „Er versicherte mir, dass er damit zufrieden wäre“. „Er sagte,
er würde kommen“. Man sage was man will, es muss heissen „er wer-
de kommen“. Er würde korpmen, kann man richtig nur dann sagen,
wenn er in einem gewissen Falle käme , der aber nicht eintritt, er also
auch nicht kommt. — Wenn er §. 44. sagt, dem deutschen „würde
singen“ stehe kein indicativisches „würde singen“ zur Seite, so be-
merkt Ref., dass sich ein solches doch im Mittelalter findet, und er sich
einer Stelle, die er nur nicht genau citiren kann, erinnert, wo es heisst:
„er Vard singen1*. — S. 18. wird eine Stelle aus Cicero angeführt (sie
steht ad Faram. XI., 2. prc.): quae profecto, quum istum animum ha-
be«, in opthnam partem accipies, und beigefügt: hier würde habeai
(der Zweifel) eher verletzend seyn. Das wäre wahrhaftig kein verletzen-
der Zweifel, sondern des Verf. Erklärung ist falsch und, die Lesart selbst
ein die Sprachriohtigkeit verletzender Ausdruck. Man muss schlechter-
dings mit Orelli lesen quoniam — habes, oder dem causalen quum
seinen Conjunetiv ha Leas geben. So ist es gerade mit einer zweiten
Stelle des Cicero S. 84. (sie steht Verrin. Aet. II. L. IV., 2, 3.), wo, ei-