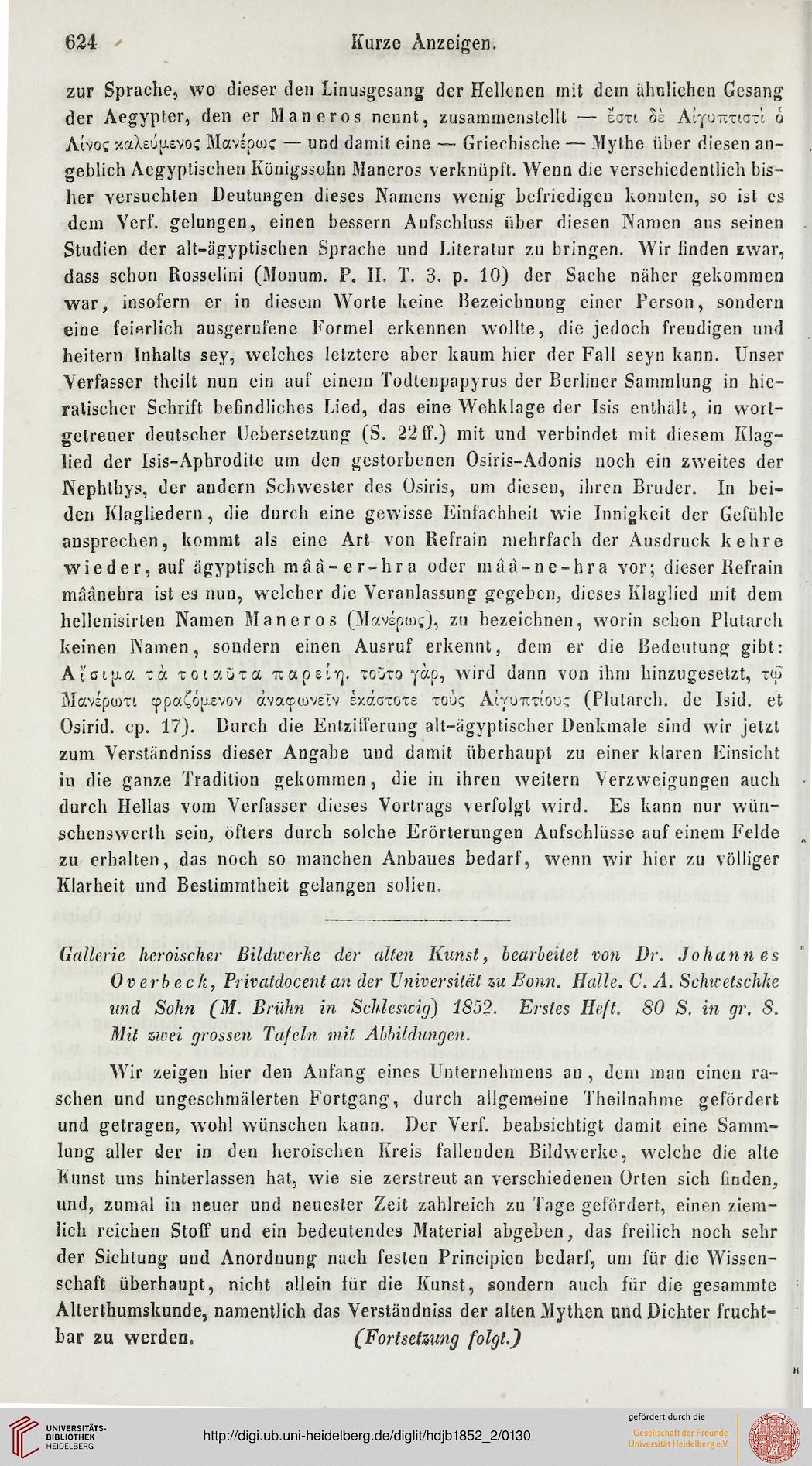624
Kurze Anzeigen.
zur Sprache, wo dieser den Linusgesang der Hellenen mit dem ähnlichen Gesang
der Aegypter, den er Maneros nennt, zusammenstellt — εστι δε Αίγυπτισ-Ι ό
Λίνος καλεύρενος Μανέρως — und damit eine — Griechische — Mythe über diesen an-
geblich Aegyptischen Königssohn Maneros verknüpft. Wenn die verschiedentlich bis-
her versuchten Deutungen dieses Namens wenig befriedigen konnten, so ist es
dem Verf. gelungen, einen bessern Aufschluss über diesen Namen aus seinen
Studien der alt-ägyptischen Sprache und Literatur zu bringen. Wir finden zwar,
dass schon Rosselini (Monum. P. II. T. 3. p. 10) der Sache näher gekommen
war, insofern er in diesem Worte keine Bezeichnung einer Person, sondern
eine feierlich ausgerufene Formel erkennen wollte, die jedoch freudigen und
heitern Inhalts sey, welches letztere aber kaum hier der Fall seyn kann. Unser
Verfasser theilt nun ein auf einem Todtcnpapyrus der Berliner Sammlung in hie-
ratischer Schrift befindliches Lied, das eine Wehklage der Isis enthält, in wort-
getreuer deutscher Ucbersetzung (S. 22 ff.) mit und verbindet mit diesem Klag-
lied der Isis-Aphrodite um den gestorbenen Osiris-Adonis noch ein zweites der
Nephlhys, der andern Schwester des Osiris, um diesen, ihren Bruder. In bei-
den Klagliedern, die durch eine gewisse Einfachheit wie Innigkeit der Gefühle
ansprechen, kommt als eine Art von Refrain mehrfach der Ausdruck kehre
wieder, auf ägyptisch mää-er-hr a oder mää-ne-hra vor; dieser Refrain
määnehra ist es nun, welcher die Veranlassung gegeben, dieses Klaglied mit dem
hellenisirten Namen Maneros (Μανέρως), zu bezeichnen, worin schon Plutarch
keinen Namen, sondern einen Ausruf erkennt, dem er die Bedeutung gibt:
Αισιρα τά τοιαΰτα παρείη. τούτο γάρ, wird dann von ihm hinzugesetzt, τω
Μανερωτι φραζόρενον άναφωνεΐν έκάστοτε τούς Αιγυπτίους (Plutarch. de Isid. et
Osirid. cp. 17). Durch die Entzifferung alt-ägyptischer Denkmale sind wir jetzt
zum Verständniss dieser Angabe und damit überhaupt zu einer klaren Einsicht
in die ganze Tradition gekommen, die in ihren weitern Verzweigungen auch
durch Hellas vom Verfasser dieses Vortrags verfolgt wird. Es kann nur wün-
schenswerth sein, öfters durch solche Erörterungen Aufschlüsse auf einem Felde
zu erhalten, das noch so manchen Anbaues bedarf, wenn wir hier zu völliger
Klarheit und Bestimmtheit gelangen sollen.
Gallerte heroischer Bildwerke der alten Kunst, bearbeitet von Dr. Johannes
Overbeck, Privatdocent an der Universität zu Bonn. Halle. C. A. Schicetschke
und Sohn (Μ. Brühn in Schleswig) 1852. Erstes Heft. 80 S. in gr. 8.
Mit zwei grossen Tafeln mit Abbildungen.
Wir zeigen hier den Anfang eines Unternehmens an, dem man einen ra-
schen und ungeschmälerten Fortgang, durch allgemeine Theilnahme gefördert
und getragen, wohl wünschen kann. Der Verf. beabsichtigt damit eine Samm-
lung aller der in den heroischen Kreis fallenden Bildwerke, welche die alte
Kunst uns hinterlassen hat, wie sie zerstreut an verschiedenen Orten sich finden,
und, zumal in neuer und neuester Zeit zahlreich zu Tage gefördert, einen ziem-
lich reichen Stoff und ein bedeutendes Material abgeben, das freilich noch sehr
der Sichtung und Anordnung nach festen Principien bedarf, um für die Wissen-
schaft überhaupt, nicht allein für die Kunst, sondern auch für die gesammte
Alterthumskunde, namentlich das Verständniss der alten Mythen und Dichter frucht-
bar zu werden. (Fortsetzung folgt.)
Kurze Anzeigen.
zur Sprache, wo dieser den Linusgesang der Hellenen mit dem ähnlichen Gesang
der Aegypter, den er Maneros nennt, zusammenstellt — εστι δε Αίγυπτισ-Ι ό
Λίνος καλεύρενος Μανέρως — und damit eine — Griechische — Mythe über diesen an-
geblich Aegyptischen Königssohn Maneros verknüpft. Wenn die verschiedentlich bis-
her versuchten Deutungen dieses Namens wenig befriedigen konnten, so ist es
dem Verf. gelungen, einen bessern Aufschluss über diesen Namen aus seinen
Studien der alt-ägyptischen Sprache und Literatur zu bringen. Wir finden zwar,
dass schon Rosselini (Monum. P. II. T. 3. p. 10) der Sache näher gekommen
war, insofern er in diesem Worte keine Bezeichnung einer Person, sondern
eine feierlich ausgerufene Formel erkennen wollte, die jedoch freudigen und
heitern Inhalts sey, welches letztere aber kaum hier der Fall seyn kann. Unser
Verfasser theilt nun ein auf einem Todtcnpapyrus der Berliner Sammlung in hie-
ratischer Schrift befindliches Lied, das eine Wehklage der Isis enthält, in wort-
getreuer deutscher Ucbersetzung (S. 22 ff.) mit und verbindet mit diesem Klag-
lied der Isis-Aphrodite um den gestorbenen Osiris-Adonis noch ein zweites der
Nephlhys, der andern Schwester des Osiris, um diesen, ihren Bruder. In bei-
den Klagliedern, die durch eine gewisse Einfachheit wie Innigkeit der Gefühle
ansprechen, kommt als eine Art von Refrain mehrfach der Ausdruck kehre
wieder, auf ägyptisch mää-er-hr a oder mää-ne-hra vor; dieser Refrain
määnehra ist es nun, welcher die Veranlassung gegeben, dieses Klaglied mit dem
hellenisirten Namen Maneros (Μανέρως), zu bezeichnen, worin schon Plutarch
keinen Namen, sondern einen Ausruf erkennt, dem er die Bedeutung gibt:
Αισιρα τά τοιαΰτα παρείη. τούτο γάρ, wird dann von ihm hinzugesetzt, τω
Μανερωτι φραζόρενον άναφωνεΐν έκάστοτε τούς Αιγυπτίους (Plutarch. de Isid. et
Osirid. cp. 17). Durch die Entzifferung alt-ägyptischer Denkmale sind wir jetzt
zum Verständniss dieser Angabe und damit überhaupt zu einer klaren Einsicht
in die ganze Tradition gekommen, die in ihren weitern Verzweigungen auch
durch Hellas vom Verfasser dieses Vortrags verfolgt wird. Es kann nur wün-
schenswerth sein, öfters durch solche Erörterungen Aufschlüsse auf einem Felde
zu erhalten, das noch so manchen Anbaues bedarf, wenn wir hier zu völliger
Klarheit und Bestimmtheit gelangen sollen.
Gallerte heroischer Bildwerke der alten Kunst, bearbeitet von Dr. Johannes
Overbeck, Privatdocent an der Universität zu Bonn. Halle. C. A. Schicetschke
und Sohn (Μ. Brühn in Schleswig) 1852. Erstes Heft. 80 S. in gr. 8.
Mit zwei grossen Tafeln mit Abbildungen.
Wir zeigen hier den Anfang eines Unternehmens an, dem man einen ra-
schen und ungeschmälerten Fortgang, durch allgemeine Theilnahme gefördert
und getragen, wohl wünschen kann. Der Verf. beabsichtigt damit eine Samm-
lung aller der in den heroischen Kreis fallenden Bildwerke, welche die alte
Kunst uns hinterlassen hat, wie sie zerstreut an verschiedenen Orten sich finden,
und, zumal in neuer und neuester Zeit zahlreich zu Tage gefördert, einen ziem-
lich reichen Stoff und ein bedeutendes Material abgeben, das freilich noch sehr
der Sichtung und Anordnung nach festen Principien bedarf, um für die Wissen-
schaft überhaupt, nicht allein für die Kunst, sondern auch für die gesammte
Alterthumskunde, namentlich das Verständniss der alten Mythen und Dichter frucht-
bar zu werden. (Fortsetzung folgt.)