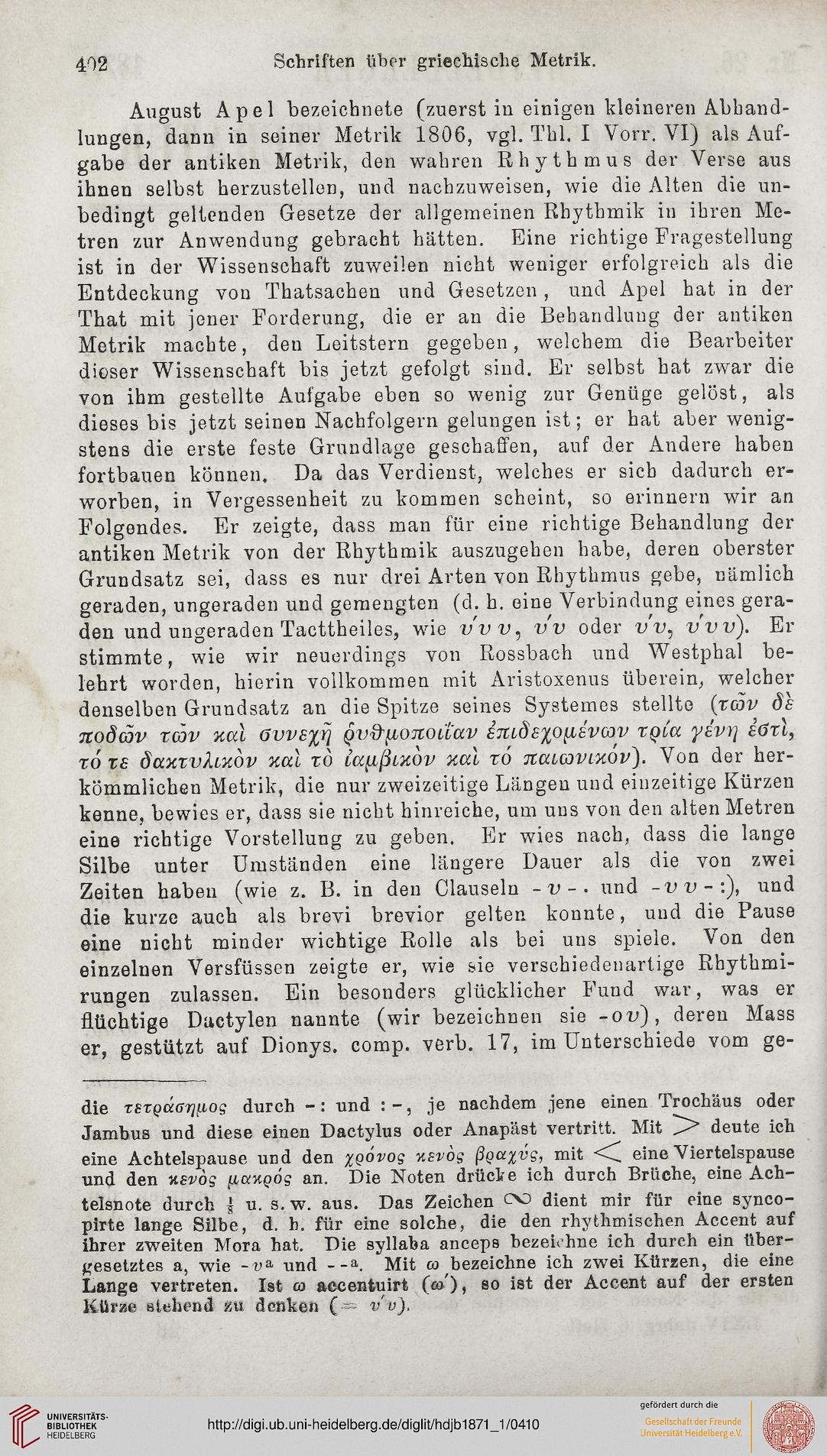402
Schriften über griechische Metrik.
August Apel bezeichnete (zuerst in einigen kleineren Abhand-
lungen, dann in seiner Metrik 1806, vgl. Thl. I Vorr. VI) als Auf-
gabe der antiken Metrik, den wahren Rhythmus der Verse aus
ihnen selbst herzustellen, und nachzuweisen, wie die Alten die un-
bedingt geltenden Gesetze der allgemeinen Rhythmik in ihren Me-
tren zur Anwendung gebracht hätten. Eine richtige Fragestellung
ist in der Wissenschaft zuweilen nicht weniger erfolgreich als die
Entdeckung von Thatsachen und Gesetzen, und Apel hat in der
That mit jener Forderung, die er an die Behandlung der antiken
Metrik machte, den Leitstern gegeben, welchem die Bearbeiter
dioser Wissenschaft bis jetzt gefolgt sind. Er selbst hat zwar die
von ihm gestellte Aufgabe eben so wenig zur Genüge gelöst, als
dieses bis jetzt seinen Nachfolgern gelungen ist; er hat aber wenig-
stens die erste feste Grundlage geschaffen, auf der Andere haben
fortbauen können. Da das Verdienst, welches er sich dadurch er-
worben, in Vergessenheit zu kommen scheint, so erinnern wir an
Folgendes. Er zeigte, dass man für eine richtige Behandlung der
antiken Metrik von der Rhythmik auszugehen habe, deren oberster
Grundsatz sei, dass es nur drei Arten von Rhythmus gebe, nämlich
geraden, ungeraden und gemengten (d. h. eine Verbindung eines gera-
den und ungeraden Tacttheiles, wie vvv. v'v oder v'v, vvv). Ei’
stimmte, wie wir neuerdings von Rossbach und Westphal be-
lehrt worden, hierin vollkommen mit Aristoxenus überein, welcher
denselben Grundsatz an die Spitze seines Systemes stellte (των δε
ποδών των καϊ συνεχή ρν&μοποι'ίαν έπεδεχομένων τρία γένη έστί,
τότε δακτνλεκόν καί τδ ιαμβικόν καί τό παεωνεκον). Von der her-
kömmlichen Metrik, die nur zweizeitige Längen und einzeitige Kürzen
kenne, bewies er, dass sie nicht hinreiche, um uns von den alten Metren
eine richtige Vorstellung zu geben. Er wies nach, dass die lange
Silbe unter Umständen eine längere Dauer als die von zwei
Zeiten haben (wie z. B. in den Clauseln -v~- und -vv-:), und
die kurze auch als brevi brevior gelten konnte, und die Pause
eine nicht minder wichtige Rolle als bei uns spiele. Von den
einzelnen Versfüssen zeigte er, wie sie verschiedenartige Rhythmi-
rungen zulassen. Ein besonders glücklicher Fund war, was er
flüchtige Dactylen nannte (wir bezeichnen sie -ov), deren Mass
er, gestützt auf Dionys, comp. verb. 17, im Unterschiede vom ge-
die τετράοημος durch und je nachdem jene einen Trochäus oder
Jambus und diese einen Dactylus oder Anapäst vertritt. Mit deute ich
eine Achtelspause und den χρόνος κενός βραχύς, mit eine Viertelspause
und den κενός μακρύς an. Die Noten drücke ich durch Brüche, eine Ach-
telsnote durch 1 u. s. w. aus. Das Zeichen C\D dient mir für eine synco-
pirte lange Silbe, d. h. für eine solche, die den rhythmischen Accent auf
ihrer zweiten Mora hat. Die syllaba anceps bezeichne ich durch ein über-
gesetztes a, wie -va und --a. Mit ω bezeichne ich zwei Kürzen, die eine
Lange vertreten. Ist ω accentuirt (ω'), so ist der Accent auf der ersten
Kürze stehend zu denken (~ v'v).
Schriften über griechische Metrik.
August Apel bezeichnete (zuerst in einigen kleineren Abhand-
lungen, dann in seiner Metrik 1806, vgl. Thl. I Vorr. VI) als Auf-
gabe der antiken Metrik, den wahren Rhythmus der Verse aus
ihnen selbst herzustellen, und nachzuweisen, wie die Alten die un-
bedingt geltenden Gesetze der allgemeinen Rhythmik in ihren Me-
tren zur Anwendung gebracht hätten. Eine richtige Fragestellung
ist in der Wissenschaft zuweilen nicht weniger erfolgreich als die
Entdeckung von Thatsachen und Gesetzen, und Apel hat in der
That mit jener Forderung, die er an die Behandlung der antiken
Metrik machte, den Leitstern gegeben, welchem die Bearbeiter
dioser Wissenschaft bis jetzt gefolgt sind. Er selbst hat zwar die
von ihm gestellte Aufgabe eben so wenig zur Genüge gelöst, als
dieses bis jetzt seinen Nachfolgern gelungen ist; er hat aber wenig-
stens die erste feste Grundlage geschaffen, auf der Andere haben
fortbauen können. Da das Verdienst, welches er sich dadurch er-
worben, in Vergessenheit zu kommen scheint, so erinnern wir an
Folgendes. Er zeigte, dass man für eine richtige Behandlung der
antiken Metrik von der Rhythmik auszugehen habe, deren oberster
Grundsatz sei, dass es nur drei Arten von Rhythmus gebe, nämlich
geraden, ungeraden und gemengten (d. h. eine Verbindung eines gera-
den und ungeraden Tacttheiles, wie vvv. v'v oder v'v, vvv). Ei’
stimmte, wie wir neuerdings von Rossbach und Westphal be-
lehrt worden, hierin vollkommen mit Aristoxenus überein, welcher
denselben Grundsatz an die Spitze seines Systemes stellte (των δε
ποδών των καϊ συνεχή ρν&μοποι'ίαν έπεδεχομένων τρία γένη έστί,
τότε δακτνλεκόν καί τδ ιαμβικόν καί τό παεωνεκον). Von der her-
kömmlichen Metrik, die nur zweizeitige Längen und einzeitige Kürzen
kenne, bewies er, dass sie nicht hinreiche, um uns von den alten Metren
eine richtige Vorstellung zu geben. Er wies nach, dass die lange
Silbe unter Umständen eine längere Dauer als die von zwei
Zeiten haben (wie z. B. in den Clauseln -v~- und -vv-:), und
die kurze auch als brevi brevior gelten konnte, und die Pause
eine nicht minder wichtige Rolle als bei uns spiele. Von den
einzelnen Versfüssen zeigte er, wie sie verschiedenartige Rhythmi-
rungen zulassen. Ein besonders glücklicher Fund war, was er
flüchtige Dactylen nannte (wir bezeichnen sie -ov), deren Mass
er, gestützt auf Dionys, comp. verb. 17, im Unterschiede vom ge-
die τετράοημος durch und je nachdem jene einen Trochäus oder
Jambus und diese einen Dactylus oder Anapäst vertritt. Mit deute ich
eine Achtelspause und den χρόνος κενός βραχύς, mit eine Viertelspause
und den κενός μακρύς an. Die Noten drücke ich durch Brüche, eine Ach-
telsnote durch 1 u. s. w. aus. Das Zeichen C\D dient mir für eine synco-
pirte lange Silbe, d. h. für eine solche, die den rhythmischen Accent auf
ihrer zweiten Mora hat. Die syllaba anceps bezeichne ich durch ein über-
gesetztes a, wie -va und --a. Mit ω bezeichne ich zwei Kürzen, die eine
Lange vertreten. Ist ω accentuirt (ω'), so ist der Accent auf der ersten
Kürze stehend zu denken (~ v'v).