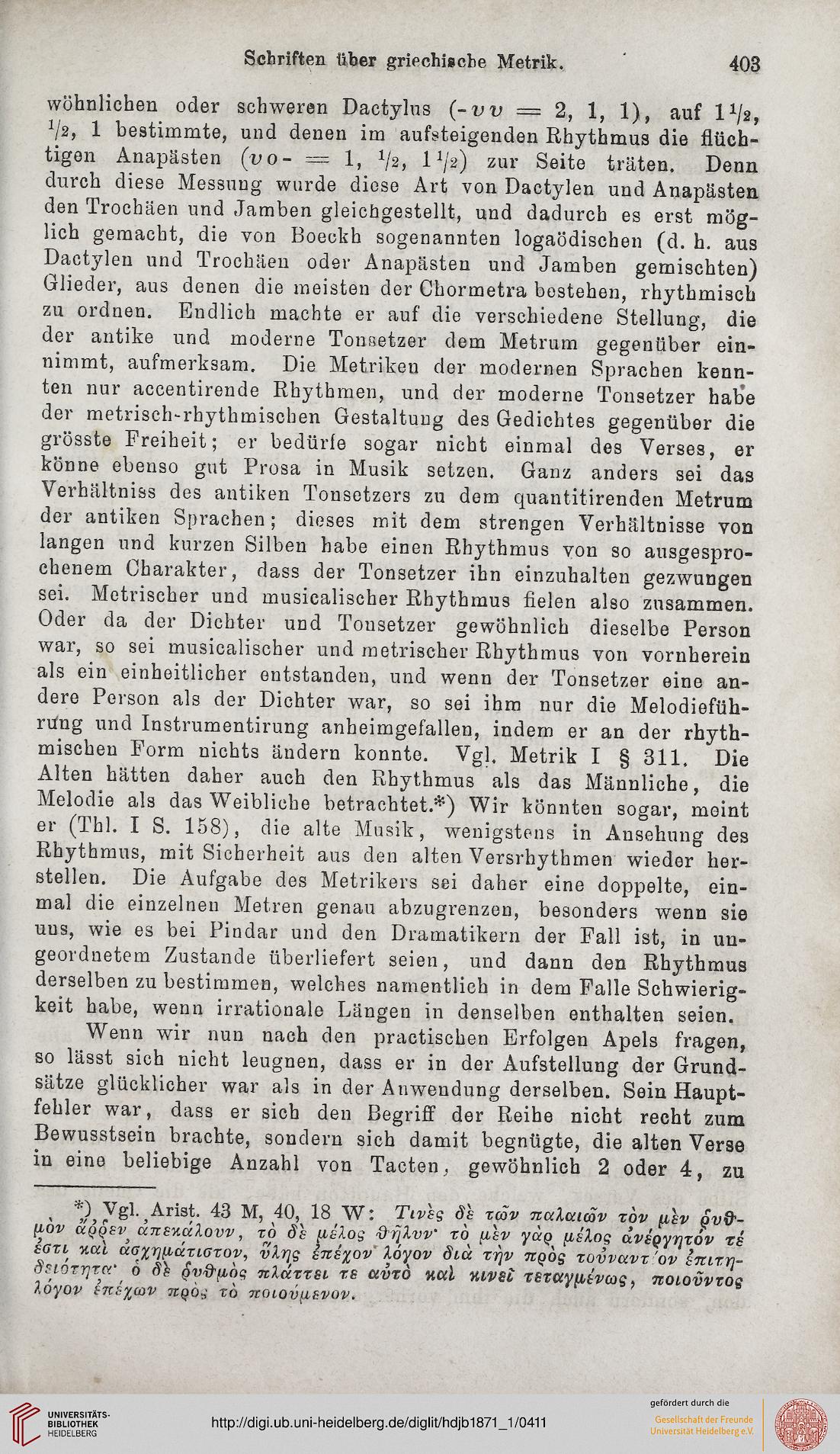Schriften über griechische Metrik.
403
wohnlichen oder schweren Dactylus (-vv = 2, 1, 1), auf V/2,
^2, 1 bestimmte, und denen im aufsteigenden Rhythmus die flüch-
tigen Anapästen (υο- = 1, */2, P/2) zur Seite träten. Denn
durch diese Messung wurde diese Art von Dactylen und Anapästen
den Trochäen und Jamben gleichgestellt, und dadurch es erst mög-
lich gemacht, die von Boeckb sogenannten logaödischen (d. h. aus
Dactylen und Trochäen oder Anapästen und Jamben gemischten)
Glieder, aus denen die meisten der Chormetra bestehen, rhythmisch
zu ordnen. Endlich machte er auf die verschiedene Stellung, die
der antike und moderne Tonsetzer dem Metrum gegenüber ein-
nimmt, aufmerksam. Die Metriken der modernen Sprachen kenn-
ten nur accentirende Rhythmen, und der moderne Tonsetzer haüe
der metrisclurhythmiscben Gestaltung des Gedichtes gegenüber die
grösste Freiheit; er bedürfe sogar nicht einmal des Verses, er
könne ebenso gut Prosa in Musik setzen. Ganz anders sei das
Verhältniss des antiken Tonsetzers zu dem quantitirenden Metrum
der antiken Sprachen; dieses mit dem strengen Verhältnisse von
langen und kurzen Silben habe einen Rhythmus von so ausgespro-
chenem Charakter, dass der Tonsetzer ihn einzuhalten gezwungen
sei. Metrischer und musicalischer Rhythmus fielen also zusammen.
Oder da der Dichter und Tonsetzer gewöhnlich dieselbe Person
war, so sei musicalischer und metrischer Rhythmus von vornherein
als ein einheitlicher entstanden, und wenn der Tonsetzer eine an-
dere Person als der Dichter war, so sei ihm nur die Melodiefüh-
rüng und Instrumentirung anbeimgefallen, indem er an der rhyth-
mischen Form nichts ändern konnte. Vgl. Metrik I § 311. Die
Alten hätten daher auch den Rhythmus als das Männliche, die
Melodie als das Weibliche betrachtet.*) Wir könnten sogar, meint
er (Thl. I S. 158), die alte Musik, wenigstens in Ansehung des
Rhythmus, mit Sicherheit aus den alten Versrhythmen wieder her-
stellen. Die Aufgabe des Metrikers sei daher eine doppelte, ein-
mal die einzelnen Metren genau abzugrenzen, besonders wenn sie
uus, wie es bei Pindar und den Dramatikern der Fall ist, in un-
geordnetem Zustande überliefert seien, und dann den Rhythmus
derselben zu bestimmen, welches namentlich in dem Falle Schwierig-
keit habe, wenn irrationale Längen in denselben enthalten seien.
Wenn wir nun nach den practischen Erfolgen Apels fragen,
so lässt sich nicht leugnen, dass er in der Aufstellung der Grund-
sätze glücklicher war als in der Anwendung derselben. Sein Haupt-
fehler war, dass er sich den Begriff der Reibe nicht recht zum
Bewusstsein brachte, sondern sich damit begnügte, die alten Verse
in eine beliebige Anzahl von Tacten, gewöhnlich 2 oder 4, zu
*) Vgl. Arist. 43 M, 40, 18 W: Τιν'ες δε των παλαιών τον μεν ρυ&-
μόν οίρρεν απεκάλουν, τό δε μέλος 'θήλυν' τό μεν γάρ μέλος άνέργητόν τέ
έοτι και άΰχημάτιατον, ύλης επέχον λόγον άιά την προς τονναντ 'ον έπιτη-
δειότητα' ό ρυ&μός πλάττει τε αυτό καί κινεί τεταγμένως, ποιοΰντος
λόγον επέχων πρός τό ποιούμενον.
403
wohnlichen oder schweren Dactylus (-vv = 2, 1, 1), auf V/2,
^2, 1 bestimmte, und denen im aufsteigenden Rhythmus die flüch-
tigen Anapästen (υο- = 1, */2, P/2) zur Seite träten. Denn
durch diese Messung wurde diese Art von Dactylen und Anapästen
den Trochäen und Jamben gleichgestellt, und dadurch es erst mög-
lich gemacht, die von Boeckb sogenannten logaödischen (d. h. aus
Dactylen und Trochäen oder Anapästen und Jamben gemischten)
Glieder, aus denen die meisten der Chormetra bestehen, rhythmisch
zu ordnen. Endlich machte er auf die verschiedene Stellung, die
der antike und moderne Tonsetzer dem Metrum gegenüber ein-
nimmt, aufmerksam. Die Metriken der modernen Sprachen kenn-
ten nur accentirende Rhythmen, und der moderne Tonsetzer haüe
der metrisclurhythmiscben Gestaltung des Gedichtes gegenüber die
grösste Freiheit; er bedürfe sogar nicht einmal des Verses, er
könne ebenso gut Prosa in Musik setzen. Ganz anders sei das
Verhältniss des antiken Tonsetzers zu dem quantitirenden Metrum
der antiken Sprachen; dieses mit dem strengen Verhältnisse von
langen und kurzen Silben habe einen Rhythmus von so ausgespro-
chenem Charakter, dass der Tonsetzer ihn einzuhalten gezwungen
sei. Metrischer und musicalischer Rhythmus fielen also zusammen.
Oder da der Dichter und Tonsetzer gewöhnlich dieselbe Person
war, so sei musicalischer und metrischer Rhythmus von vornherein
als ein einheitlicher entstanden, und wenn der Tonsetzer eine an-
dere Person als der Dichter war, so sei ihm nur die Melodiefüh-
rüng und Instrumentirung anbeimgefallen, indem er an der rhyth-
mischen Form nichts ändern konnte. Vgl. Metrik I § 311. Die
Alten hätten daher auch den Rhythmus als das Männliche, die
Melodie als das Weibliche betrachtet.*) Wir könnten sogar, meint
er (Thl. I S. 158), die alte Musik, wenigstens in Ansehung des
Rhythmus, mit Sicherheit aus den alten Versrhythmen wieder her-
stellen. Die Aufgabe des Metrikers sei daher eine doppelte, ein-
mal die einzelnen Metren genau abzugrenzen, besonders wenn sie
uus, wie es bei Pindar und den Dramatikern der Fall ist, in un-
geordnetem Zustande überliefert seien, und dann den Rhythmus
derselben zu bestimmen, welches namentlich in dem Falle Schwierig-
keit habe, wenn irrationale Längen in denselben enthalten seien.
Wenn wir nun nach den practischen Erfolgen Apels fragen,
so lässt sich nicht leugnen, dass er in der Aufstellung der Grund-
sätze glücklicher war als in der Anwendung derselben. Sein Haupt-
fehler war, dass er sich den Begriff der Reibe nicht recht zum
Bewusstsein brachte, sondern sich damit begnügte, die alten Verse
in eine beliebige Anzahl von Tacten, gewöhnlich 2 oder 4, zu
*) Vgl. Arist. 43 M, 40, 18 W: Τιν'ες δε των παλαιών τον μεν ρυ&-
μόν οίρρεν απεκάλουν, τό δε μέλος 'θήλυν' τό μεν γάρ μέλος άνέργητόν τέ
έοτι και άΰχημάτιατον, ύλης επέχον λόγον άιά την προς τονναντ 'ον έπιτη-
δειότητα' ό ρυ&μός πλάττει τε αυτό καί κινεί τεταγμένως, ποιοΰντος
λόγον επέχων πρός τό ποιούμενον.