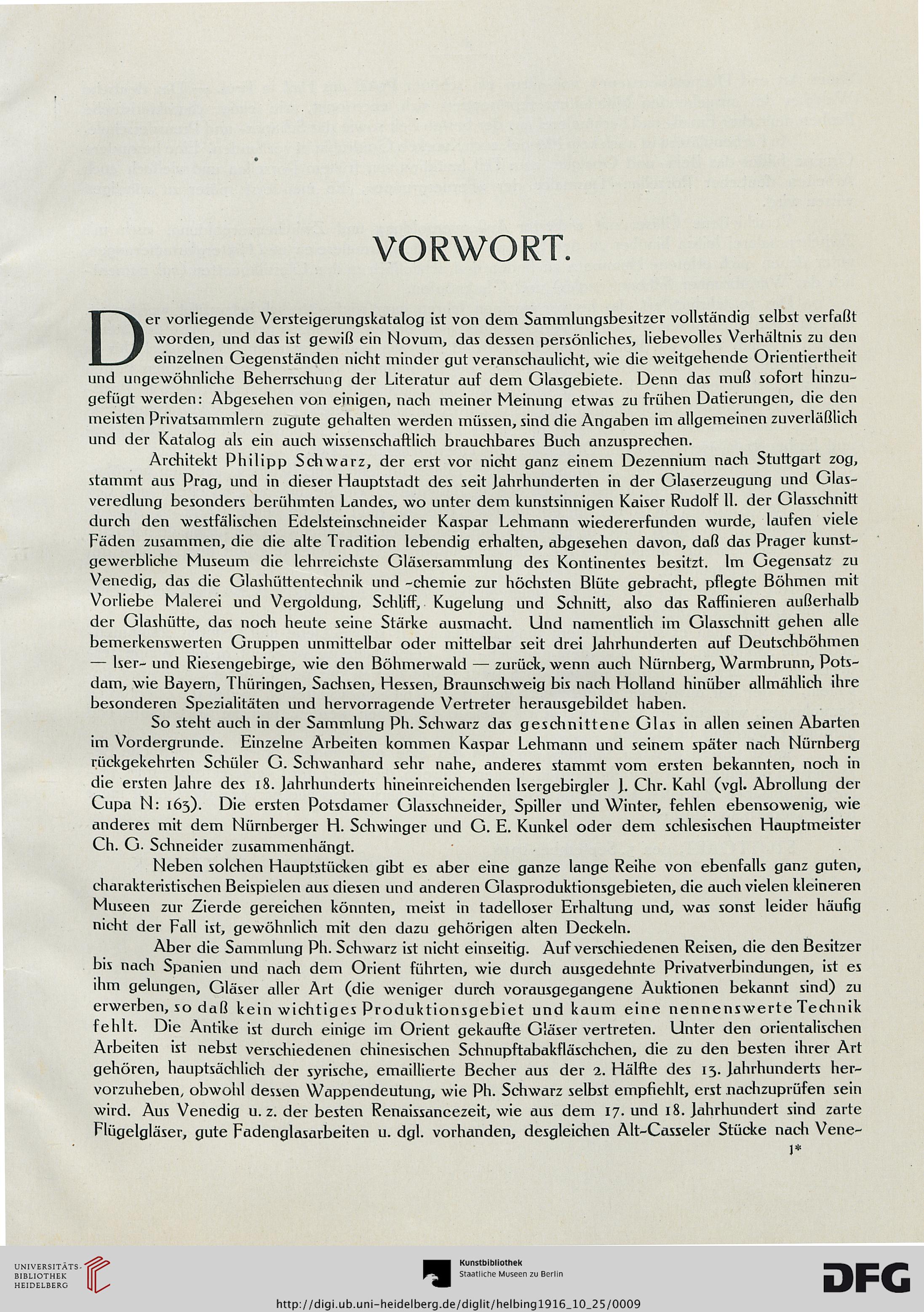VORWORT.
Der vorliegende Versteigerungskatalog ist von dem Sammlungsbesitzer vollständig selbst verfaßt
worden, und das ist gewiß ein Novum, das dessen persönliches, liebevolles Verhältnis zu den
einzelnen Gegenständen nicht minder gut veranschaulicht, wie die weitgehende Orientiertheit
und ungewöhnliche Beherrschung der Literatur auf dem Glasgebiete. Denn das muß sofort hinzu-
gefügt werden: Abgesehen von einigen, nach meiner Meinung etwas zu frühen Datierungen, die den
meisten Privatsammlern zugute gehalten werden müssen, sind die Angaben im allgemeinen zuverläßlich
und der Katalog als ein auch wissenschaftlich brauchbares Buch anzusprechen.
Architekt Philipp Schwarz, der erst vor nicht ganz einem Dezennium nach Stuttgart zog,
stammt aus Prag, und in dieser Hauptstadt des seit Jahrhunderten in der Glaserzeugung und Glas-
veredlung besonders berühmten Landes, wo unter dem kunstsinnigen Kaiser Rudolf 11. der Glasschnitt
durch den westfälischen Edelsteinschneider Kaspar Lehmann wiedererfunden wurde, laufen viele
Fäden zusammen, die die alte Tradition lebendig erhalten, abgesehen davon, daß das Prager kunst-
gewerbliche Museum die lehrreichste Gläsersammlung des Kontinentes besitzt. Im Gegensatz zu
Venedig, das die Glashüttentechnik und -chemie zur höchsten Blüte gebracht, pflegte Böhmen mit
Vorliebe Malerei und Vergoldung, Schliff, Kugelung und Schnitt, also das Raffinieren außerhalb
der Glashütte, das noch heute seine Stärke ausmacht. Und namentlich im Glasschnitt gehen alle
bemerkenswerten Gruppen unmittelbar oder mittelbar seit drei Jahrhunderten auf Deutschböhmen
— Iser- und Riesengebirge, wie den Böhmerwald — zurück, wenn auch Nürnberg, Warmbrunn, Pots-
dam, wie Bayern, Thüringen, Sachsen, Hessen, Braunschweig bis nach Holland hinüber allmählich ihre
besonderen Spezialitäten und hervorragende Vertreter herausgebildet haben.
So steht auch in der Sammlung Ph. Schwarz das geschnittene Glas in allen seinen Abarten
im Vordergrunde. Einzelne Arbeiten kommen Kaspar Lehmann und seinem später nach Nürnberg
rückgekehrten Schüler G. Schwanhard sehr nahe, anderes stammt vom ersten bekannten, noch in
die ersten Jahre des 18. Jahrhunderts hineinreichenden lsergebirgler J. Chr. Kahl (vgl. Abrollung der
Cupa N: 165). Die ersten Potsdamer Glasschneider, Spiller und Winter, fehlen ebensowenig, wie
anderes mit dem Nürnberger H. Schwinger und G. E. Kunkel oder dem schlesischen Hauptmeister
Ch. G. Schneider zusammenhängt.
Neben solchen Hauptstücken gibt es aber eine ganze lange Reihe von ebenfalls ganz guten,
charakteristischen Beispielen aus diesen und anderen Glasproduktionsgebieten, die auch vielen kleineren
Museen zur Zierde gereichen könnten, meist in tadelloser Erhaltung und, was sonst leider häufig
nicht der Fall ist, gewöhnlich mit den dazu gehörigen alten Deckeln.
Aber die Sammlung Ph. Schwarz ist nicht einseitig. Auf verschiedenen Reisen, die den Besitzer
bis nach Spanien und nach dem Orient führten, wie durch ausgedehnte Privatverbindungen, ist es
ihm gelungen, Gläser aller Art (die weniger durch vorausgegangene Auktionen bekannt sind) zu
erwerben, so daß kein wichtiges Produktionsgebiet und kaum eine nennenswerte Technik
fehlt. Die Antike ist durch einige im Orient gekaufte Gläser vertreten. Unter den orientalischen
Arbeiten ist nebst verschiedenen chinesischen Schnupftabakfläschchen, die zu den besten ihrer Art
gehören, hauptsächlich der syrische, emaillierte Becher aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts her-
vorzuheben, obwohl dessen Wappendeutung, wie Ph. Schwarz selbst empfiehlt, erst nachzuprüfen sein
wird. Aus Venedig u. z. der besten Renaissancezeit, wie aus dem 17. und 18. Jahrhundert sind zarte
Flügelgläser, gute Fadenglasarbeiten u. dgl. vorhanden, desgleichen Alt-Casseler Stücke nach Vene-
1*
Der vorliegende Versteigerungskatalog ist von dem Sammlungsbesitzer vollständig selbst verfaßt
worden, und das ist gewiß ein Novum, das dessen persönliches, liebevolles Verhältnis zu den
einzelnen Gegenständen nicht minder gut veranschaulicht, wie die weitgehende Orientiertheit
und ungewöhnliche Beherrschung der Literatur auf dem Glasgebiete. Denn das muß sofort hinzu-
gefügt werden: Abgesehen von einigen, nach meiner Meinung etwas zu frühen Datierungen, die den
meisten Privatsammlern zugute gehalten werden müssen, sind die Angaben im allgemeinen zuverläßlich
und der Katalog als ein auch wissenschaftlich brauchbares Buch anzusprechen.
Architekt Philipp Schwarz, der erst vor nicht ganz einem Dezennium nach Stuttgart zog,
stammt aus Prag, und in dieser Hauptstadt des seit Jahrhunderten in der Glaserzeugung und Glas-
veredlung besonders berühmten Landes, wo unter dem kunstsinnigen Kaiser Rudolf 11. der Glasschnitt
durch den westfälischen Edelsteinschneider Kaspar Lehmann wiedererfunden wurde, laufen viele
Fäden zusammen, die die alte Tradition lebendig erhalten, abgesehen davon, daß das Prager kunst-
gewerbliche Museum die lehrreichste Gläsersammlung des Kontinentes besitzt. Im Gegensatz zu
Venedig, das die Glashüttentechnik und -chemie zur höchsten Blüte gebracht, pflegte Böhmen mit
Vorliebe Malerei und Vergoldung, Schliff, Kugelung und Schnitt, also das Raffinieren außerhalb
der Glashütte, das noch heute seine Stärke ausmacht. Und namentlich im Glasschnitt gehen alle
bemerkenswerten Gruppen unmittelbar oder mittelbar seit drei Jahrhunderten auf Deutschböhmen
— Iser- und Riesengebirge, wie den Böhmerwald — zurück, wenn auch Nürnberg, Warmbrunn, Pots-
dam, wie Bayern, Thüringen, Sachsen, Hessen, Braunschweig bis nach Holland hinüber allmählich ihre
besonderen Spezialitäten und hervorragende Vertreter herausgebildet haben.
So steht auch in der Sammlung Ph. Schwarz das geschnittene Glas in allen seinen Abarten
im Vordergrunde. Einzelne Arbeiten kommen Kaspar Lehmann und seinem später nach Nürnberg
rückgekehrten Schüler G. Schwanhard sehr nahe, anderes stammt vom ersten bekannten, noch in
die ersten Jahre des 18. Jahrhunderts hineinreichenden lsergebirgler J. Chr. Kahl (vgl. Abrollung der
Cupa N: 165). Die ersten Potsdamer Glasschneider, Spiller und Winter, fehlen ebensowenig, wie
anderes mit dem Nürnberger H. Schwinger und G. E. Kunkel oder dem schlesischen Hauptmeister
Ch. G. Schneider zusammenhängt.
Neben solchen Hauptstücken gibt es aber eine ganze lange Reihe von ebenfalls ganz guten,
charakteristischen Beispielen aus diesen und anderen Glasproduktionsgebieten, die auch vielen kleineren
Museen zur Zierde gereichen könnten, meist in tadelloser Erhaltung und, was sonst leider häufig
nicht der Fall ist, gewöhnlich mit den dazu gehörigen alten Deckeln.
Aber die Sammlung Ph. Schwarz ist nicht einseitig. Auf verschiedenen Reisen, die den Besitzer
bis nach Spanien und nach dem Orient führten, wie durch ausgedehnte Privatverbindungen, ist es
ihm gelungen, Gläser aller Art (die weniger durch vorausgegangene Auktionen bekannt sind) zu
erwerben, so daß kein wichtiges Produktionsgebiet und kaum eine nennenswerte Technik
fehlt. Die Antike ist durch einige im Orient gekaufte Gläser vertreten. Unter den orientalischen
Arbeiten ist nebst verschiedenen chinesischen Schnupftabakfläschchen, die zu den besten ihrer Art
gehören, hauptsächlich der syrische, emaillierte Becher aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts her-
vorzuheben, obwohl dessen Wappendeutung, wie Ph. Schwarz selbst empfiehlt, erst nachzuprüfen sein
wird. Aus Venedig u. z. der besten Renaissancezeit, wie aus dem 17. und 18. Jahrhundert sind zarte
Flügelgläser, gute Fadenglasarbeiten u. dgl. vorhanden, desgleichen Alt-Casseler Stücke nach Vene-
1*