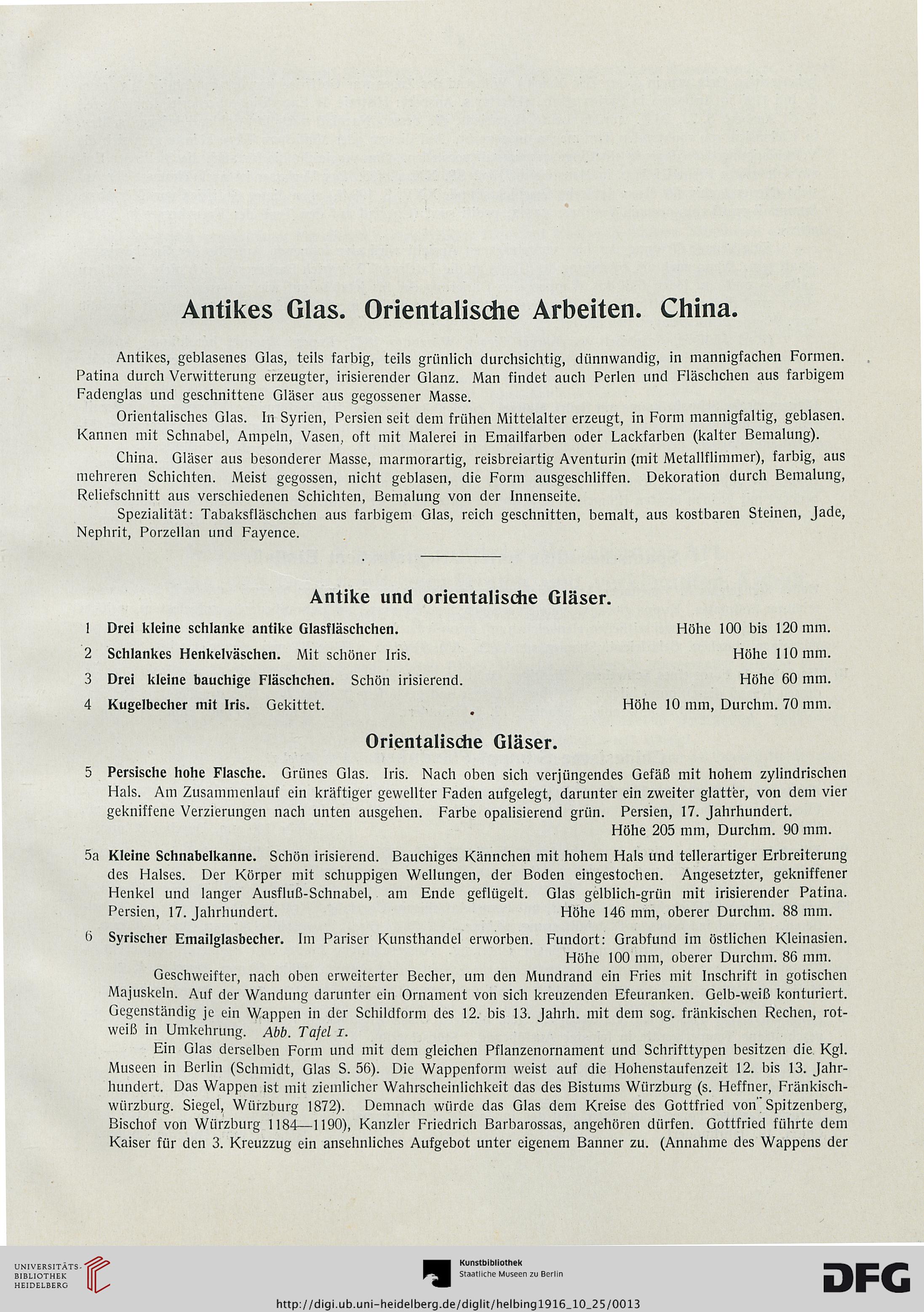Antikes Glas. Orientalische Arbeiten. China.
Antikes, geblasenes Glas, teils farbig, teils grünlich durchsichtig, dünnwandig, in mannigfachen Formen.
Patina durch Verwitterung erzeugter, irisierender Glanz. Man findet auch Perlen und Fläschchen aus farbigem
Fadenglas und geschnittene Gläser aus gegossener Masse.
Orientalisches Glas. In Syrien, Persien seit dem frühen Mittelalter erzeugt, in Form mannigfaltig, geblasen.
Kannen mit Schnabel, Ampeln, Vasen, oft mit Malerei in Emailfarben oder Lackfarben (kalter Bemalung).
China. Gläser aus besonderer Masse, marmorartig, reisbreiartig Aventurin (mit Metallflimmer), farbig, aus
mehreren Schichten. Meist gegossen, nicht geblasen, die Form ausgeschliffen. Dekoration durch Bemalung,
Reliefschnitt aus verschiedenen Schichten, Bemalung von der Innenseite.
Spezialität: Tabaksfläschchen aus farbigem Glas, reich geschnitten, bemalt, aus kostbaren Steinen, Jade,
Nephrit, Porzellan und Fayence.
Antike und orientalische Gläser.
1 Drei kleine schlanke antike Glasfläschchen.
2 Schlankes Henkelväschen. Mit schöner Iris.
3 Drei kleine bauchige Fläschchen. Schön irisierend.
4 Kugelbecher mit Iris. Gekittet.
Orientalische Gläser.
5 Persische hohe Flasche. Grünes Glas. Iris. Nach oben sich verjüngendes Gefäß mit hohem zylindrischen
Hals. Am Zusammenlauf ein kräftiger gewellter Faden aufgelegt, darunter ein zweiter glatter, von dem vier
gekniffene Verzierungen nach unten ausgehen. Farbe opalisierend grün. Persien, 17. Jahrhundert.
Höhe 205 mm, Durchm. 90 mm.
5a Kleine Schnabelkanne. Schön irisierend. Bauchiges Kännchen mit hohem Hals und tellerartiger Erbreiterung
des Halses. Der Körper mit schuppigen Wellungen, der Boden eingestochen. Angesetzter, gekniffener
Henkel und langer Ausfluß-Schnabel, am Ende geflügelt. Glas gelblich-grün mit irisierender Patina.
Persien, 17. Jahrhundert. Höhe 146 mm, oberer Durchm. 88 mm.
() Syrischer Emailglasbecher. Im Pariser Kunsthandel erworben. Fundort: Grabfund im östlichen Kleinasien.
Höhe 100 mm, oberer Durchm. 86 mm.
Geschweifter, nach oben erweiterter Becher, um den Mundrand ein Fries mit Inschrift in gotischen
Majuskeln. Auf der Wandung darunter ein Ornament von sich kreuzenden Efeuranken. Gelb-weiß konturiert.
Gegenständig je ein Wappen in der Schildform des 12. bis 13. Jahrh. mit dem sog. fränkischen Rechen, rot-
weiß in Umkehrung. Abb. Tafel i.
Ein Glas derselben Form und mit dem gleichen Pflanzenornament und Schrifttypen besitzen die Kgl.
Museen in Berlin (Schmidt, Glas S. 56). Die Wappenform weist auf die Hohenstaufenzeit 12. bis 13. Jahr-
hundert. Das Wappen ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit das des Bistums Würzburg (s. Heffner, Fränkisch-
würzburg. Siegel, Würzburg 1872). Demnach würde das Glas dem Kreise des Gottfried von' Spitzenberg,
Bischof von Würzburg 1184—1190), Kanzler Friedrich Barbarossas, angehören dürfen. Gottfried führte dem
Kaiser für den 3. Kreuzzug ein ansehnliches Aufgebot unter eigenem Banner zu. (Annahme des Wappens der
Höhe 100 bis 120 mm.
Höhe 110 mm.
Höhe 60 mm.
Höhe 10 mm, Durchm. 70 mm.
Antikes, geblasenes Glas, teils farbig, teils grünlich durchsichtig, dünnwandig, in mannigfachen Formen.
Patina durch Verwitterung erzeugter, irisierender Glanz. Man findet auch Perlen und Fläschchen aus farbigem
Fadenglas und geschnittene Gläser aus gegossener Masse.
Orientalisches Glas. In Syrien, Persien seit dem frühen Mittelalter erzeugt, in Form mannigfaltig, geblasen.
Kannen mit Schnabel, Ampeln, Vasen, oft mit Malerei in Emailfarben oder Lackfarben (kalter Bemalung).
China. Gläser aus besonderer Masse, marmorartig, reisbreiartig Aventurin (mit Metallflimmer), farbig, aus
mehreren Schichten. Meist gegossen, nicht geblasen, die Form ausgeschliffen. Dekoration durch Bemalung,
Reliefschnitt aus verschiedenen Schichten, Bemalung von der Innenseite.
Spezialität: Tabaksfläschchen aus farbigem Glas, reich geschnitten, bemalt, aus kostbaren Steinen, Jade,
Nephrit, Porzellan und Fayence.
Antike und orientalische Gläser.
1 Drei kleine schlanke antike Glasfläschchen.
2 Schlankes Henkelväschen. Mit schöner Iris.
3 Drei kleine bauchige Fläschchen. Schön irisierend.
4 Kugelbecher mit Iris. Gekittet.
Orientalische Gläser.
5 Persische hohe Flasche. Grünes Glas. Iris. Nach oben sich verjüngendes Gefäß mit hohem zylindrischen
Hals. Am Zusammenlauf ein kräftiger gewellter Faden aufgelegt, darunter ein zweiter glatter, von dem vier
gekniffene Verzierungen nach unten ausgehen. Farbe opalisierend grün. Persien, 17. Jahrhundert.
Höhe 205 mm, Durchm. 90 mm.
5a Kleine Schnabelkanne. Schön irisierend. Bauchiges Kännchen mit hohem Hals und tellerartiger Erbreiterung
des Halses. Der Körper mit schuppigen Wellungen, der Boden eingestochen. Angesetzter, gekniffener
Henkel und langer Ausfluß-Schnabel, am Ende geflügelt. Glas gelblich-grün mit irisierender Patina.
Persien, 17. Jahrhundert. Höhe 146 mm, oberer Durchm. 88 mm.
() Syrischer Emailglasbecher. Im Pariser Kunsthandel erworben. Fundort: Grabfund im östlichen Kleinasien.
Höhe 100 mm, oberer Durchm. 86 mm.
Geschweifter, nach oben erweiterter Becher, um den Mundrand ein Fries mit Inschrift in gotischen
Majuskeln. Auf der Wandung darunter ein Ornament von sich kreuzenden Efeuranken. Gelb-weiß konturiert.
Gegenständig je ein Wappen in der Schildform des 12. bis 13. Jahrh. mit dem sog. fränkischen Rechen, rot-
weiß in Umkehrung. Abb. Tafel i.
Ein Glas derselben Form und mit dem gleichen Pflanzenornament und Schrifttypen besitzen die Kgl.
Museen in Berlin (Schmidt, Glas S. 56). Die Wappenform weist auf die Hohenstaufenzeit 12. bis 13. Jahr-
hundert. Das Wappen ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit das des Bistums Würzburg (s. Heffner, Fränkisch-
würzburg. Siegel, Würzburg 1872). Demnach würde das Glas dem Kreise des Gottfried von' Spitzenberg,
Bischof von Würzburg 1184—1190), Kanzler Friedrich Barbarossas, angehören dürfen. Gottfried führte dem
Kaiser für den 3. Kreuzzug ein ansehnliches Aufgebot unter eigenem Banner zu. (Annahme des Wappens der
Höhe 100 bis 120 mm.
Höhe 110 mm.
Höhe 60 mm.
Höhe 10 mm, Durchm. 70 mm.