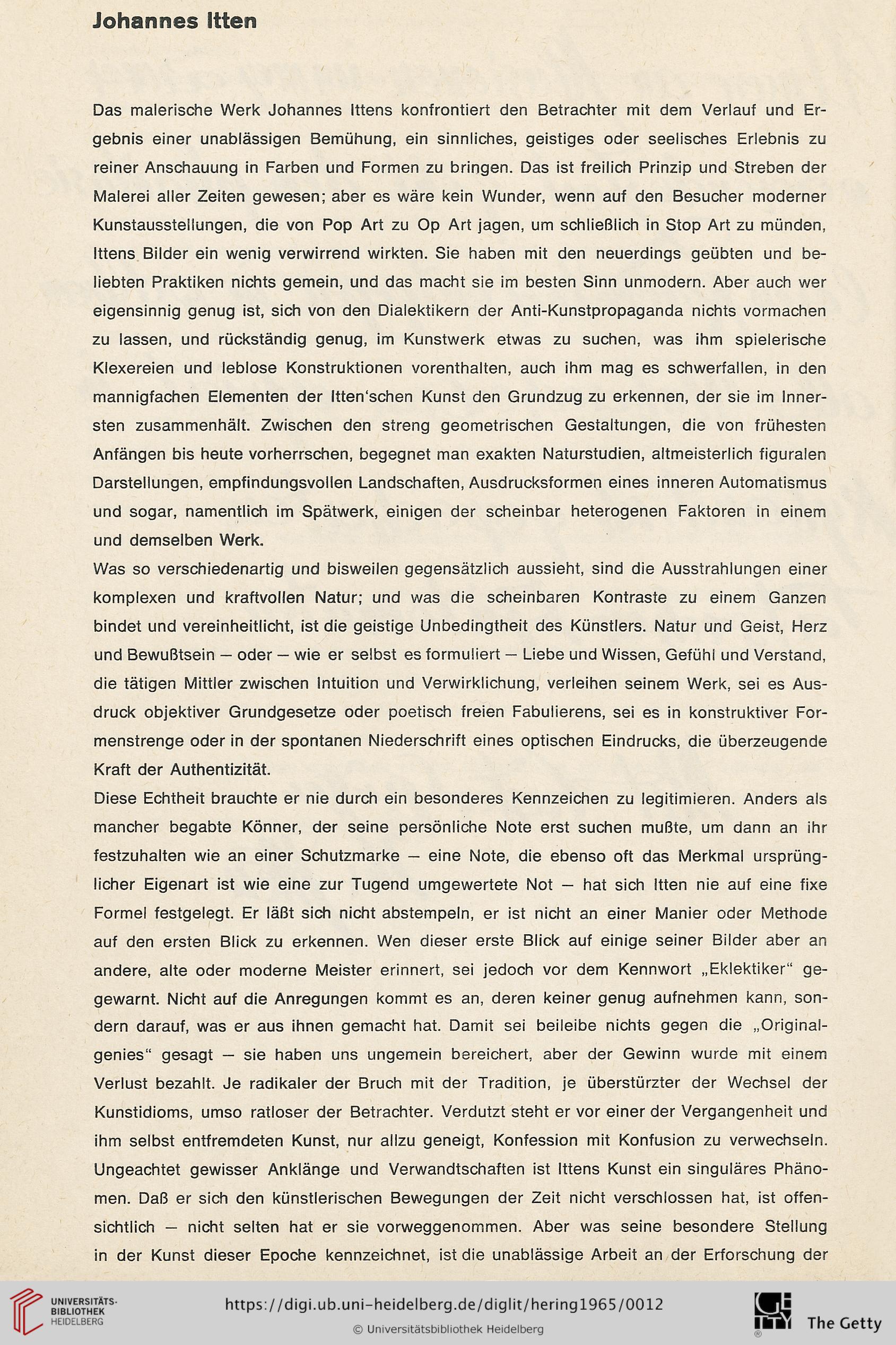Johannes Itten
Das malerische Werk Johannes Ittens konfrontiert den Betrachter mit dem Verlauf und Er-
gebnis einer unablässigen Bemühung, ein sinnliches, geistiges oder seelisches Erlebnis zu
reiner Anschauung in Farben und Formen zu bringen. Das ist freilich Prinzip und Streben der
Malerei aller Zeiten gewesen; aber es wäre kein Wunder, wenn auf den Besucher moderner
Kunstausstellungen, die von Pop Art zu Op Art jagen, um schließlich in Stop Art zu münden,
Ittens Bilder ein wenig verwirrend wirkten. Sie haben mit den neuerdings geübten und be-
liebten Praktiken nichts gemein, und das macht sie im besten Sinn unmodern. Aber auch wer
eigensinnig genug ist, sich von den Dialektikern der Anti-Kunstpropaganda nichts vormachen
zu lassen, und rückständig genug, im Kunstwerk etwas zu suchen, was ihm spielerische
Klexereien und leblose Konstruktionen vorenthalten, auch ihm mag es schwerfallen, in den
mannigfachen Elementen der Itten'schen Kunst den Grundzug zu erkennen, der sie im Inner-
sten zusammenhält. Zwischen den streng geometrischen Gestaltungen, die von frühesten
Anfängen bis heute vorherrschen, begegnet man exakten Naturstudien, altmeisterlich figuralen
Darstellungen, empfindungsvollen Landschaften, Ausdrucksformen eines inneren Automatismus
und sogar, namentlich im Spätwerk, einigen der scheinbar heterogenen Faktoren in einem
und demselben Werk.
Was so verschiedenartig und bisweilen gegensätzlich aussieht, sind die Ausstrahlungen einer
komplexen und kraftvollen Natur; und was die scheinbaren Kontraste zu einem Ganzen
bindet und vereinheitlicht, ist die geistige Unbedingtheit des Künstlers. Natur und Geist, Herz
und Bewußtsein — oder — wie er selbst es formuliert - Liebe und Wissen, Gefühl und Verstand,
die tätigen Mittler zwischen Intuition und Verwirklichung, verleihen seinem Werk, sei es Aus-
druck objektiver Grundgesetze oder poetisch freien Fabulierens, sei es in konstruktiver For-
menstrenge oder in der spontanen Niederschrift eines optischen Eindrucks, die überzeugende
Kraft der Authentizität.
Diese Echtheit brauchte er nie durch ein besonderes Kennzeichen zu legitimieren. Anders als
mancher begabte Könner, der seine persönliche Note erst suchen mußte, um dann an ihr
festzuhalten wie an einer Schutzmarke — eine Note, die ebenso oft das Merkmal ursprüng-
licher Eigenart ist wie eine zur Tugend umgewertete Not — hat sich Itten nie auf eine fixe
Formel festgelegt. Er läßt sich nicht abstempeln, er ist nicht an einer Manier oder Methode
auf den ersten Blick zu erkennen. Wen dieser erste Blick auf einige seiner Bilder aber an
andere, alte oder moderne Meister erinnert, sei jedoch vor dem Kennwort „Eklektiker“ ge-
gewarnt. Nicht auf die Anregungen kommt es an, deren keiner genug aufnehmen kann, son-
dern darauf, was er aus ihnen gemacht hat. Damit sei beileibe nichts gegen die „Original-
genies“ gesagt — sie haben uns ungemein bereichert, aber der Gewinn wurde mit einem
Verlust bezahlt. Je radikaler der Bruch mit der Tradition, je überstürzter der Wechsel der
Kunstidioms, umso ratloser der Betrachter. Verdutzt steht er vor einer der Vergangenheit und
ihm selbst entfremdeten Kunst, nur allzu geneigt, Konfession mit Konfusion zu verwechseln.
Ungeachtet gewisser Anklänge und Verwandtschaften ist Ittens Kunst ein singuläres Phäno-
men. Daß er sich den künstlerischen Bewegungen der Zeit nicht verschlossen hat, ist offen-
sichtlich — nicht selten hat er sie vorweggenommen. Aber was seine besondere Stellung
in der Kunst dieser Epoche kennzeichnet, ist die unablässige Arbeit an der Erforschung der
Das malerische Werk Johannes Ittens konfrontiert den Betrachter mit dem Verlauf und Er-
gebnis einer unablässigen Bemühung, ein sinnliches, geistiges oder seelisches Erlebnis zu
reiner Anschauung in Farben und Formen zu bringen. Das ist freilich Prinzip und Streben der
Malerei aller Zeiten gewesen; aber es wäre kein Wunder, wenn auf den Besucher moderner
Kunstausstellungen, die von Pop Art zu Op Art jagen, um schließlich in Stop Art zu münden,
Ittens Bilder ein wenig verwirrend wirkten. Sie haben mit den neuerdings geübten und be-
liebten Praktiken nichts gemein, und das macht sie im besten Sinn unmodern. Aber auch wer
eigensinnig genug ist, sich von den Dialektikern der Anti-Kunstpropaganda nichts vormachen
zu lassen, und rückständig genug, im Kunstwerk etwas zu suchen, was ihm spielerische
Klexereien und leblose Konstruktionen vorenthalten, auch ihm mag es schwerfallen, in den
mannigfachen Elementen der Itten'schen Kunst den Grundzug zu erkennen, der sie im Inner-
sten zusammenhält. Zwischen den streng geometrischen Gestaltungen, die von frühesten
Anfängen bis heute vorherrschen, begegnet man exakten Naturstudien, altmeisterlich figuralen
Darstellungen, empfindungsvollen Landschaften, Ausdrucksformen eines inneren Automatismus
und sogar, namentlich im Spätwerk, einigen der scheinbar heterogenen Faktoren in einem
und demselben Werk.
Was so verschiedenartig und bisweilen gegensätzlich aussieht, sind die Ausstrahlungen einer
komplexen und kraftvollen Natur; und was die scheinbaren Kontraste zu einem Ganzen
bindet und vereinheitlicht, ist die geistige Unbedingtheit des Künstlers. Natur und Geist, Herz
und Bewußtsein — oder — wie er selbst es formuliert - Liebe und Wissen, Gefühl und Verstand,
die tätigen Mittler zwischen Intuition und Verwirklichung, verleihen seinem Werk, sei es Aus-
druck objektiver Grundgesetze oder poetisch freien Fabulierens, sei es in konstruktiver For-
menstrenge oder in der spontanen Niederschrift eines optischen Eindrucks, die überzeugende
Kraft der Authentizität.
Diese Echtheit brauchte er nie durch ein besonderes Kennzeichen zu legitimieren. Anders als
mancher begabte Könner, der seine persönliche Note erst suchen mußte, um dann an ihr
festzuhalten wie an einer Schutzmarke — eine Note, die ebenso oft das Merkmal ursprüng-
licher Eigenart ist wie eine zur Tugend umgewertete Not — hat sich Itten nie auf eine fixe
Formel festgelegt. Er läßt sich nicht abstempeln, er ist nicht an einer Manier oder Methode
auf den ersten Blick zu erkennen. Wen dieser erste Blick auf einige seiner Bilder aber an
andere, alte oder moderne Meister erinnert, sei jedoch vor dem Kennwort „Eklektiker“ ge-
gewarnt. Nicht auf die Anregungen kommt es an, deren keiner genug aufnehmen kann, son-
dern darauf, was er aus ihnen gemacht hat. Damit sei beileibe nichts gegen die „Original-
genies“ gesagt — sie haben uns ungemein bereichert, aber der Gewinn wurde mit einem
Verlust bezahlt. Je radikaler der Bruch mit der Tradition, je überstürzter der Wechsel der
Kunstidioms, umso ratloser der Betrachter. Verdutzt steht er vor einer der Vergangenheit und
ihm selbst entfremdeten Kunst, nur allzu geneigt, Konfession mit Konfusion zu verwechseln.
Ungeachtet gewisser Anklänge und Verwandtschaften ist Ittens Kunst ein singuläres Phäno-
men. Daß er sich den künstlerischen Bewegungen der Zeit nicht verschlossen hat, ist offen-
sichtlich — nicht selten hat er sie vorweggenommen. Aber was seine besondere Stellung
in der Kunst dieser Epoche kennzeichnet, ist die unablässige Arbeit an der Erforschung der