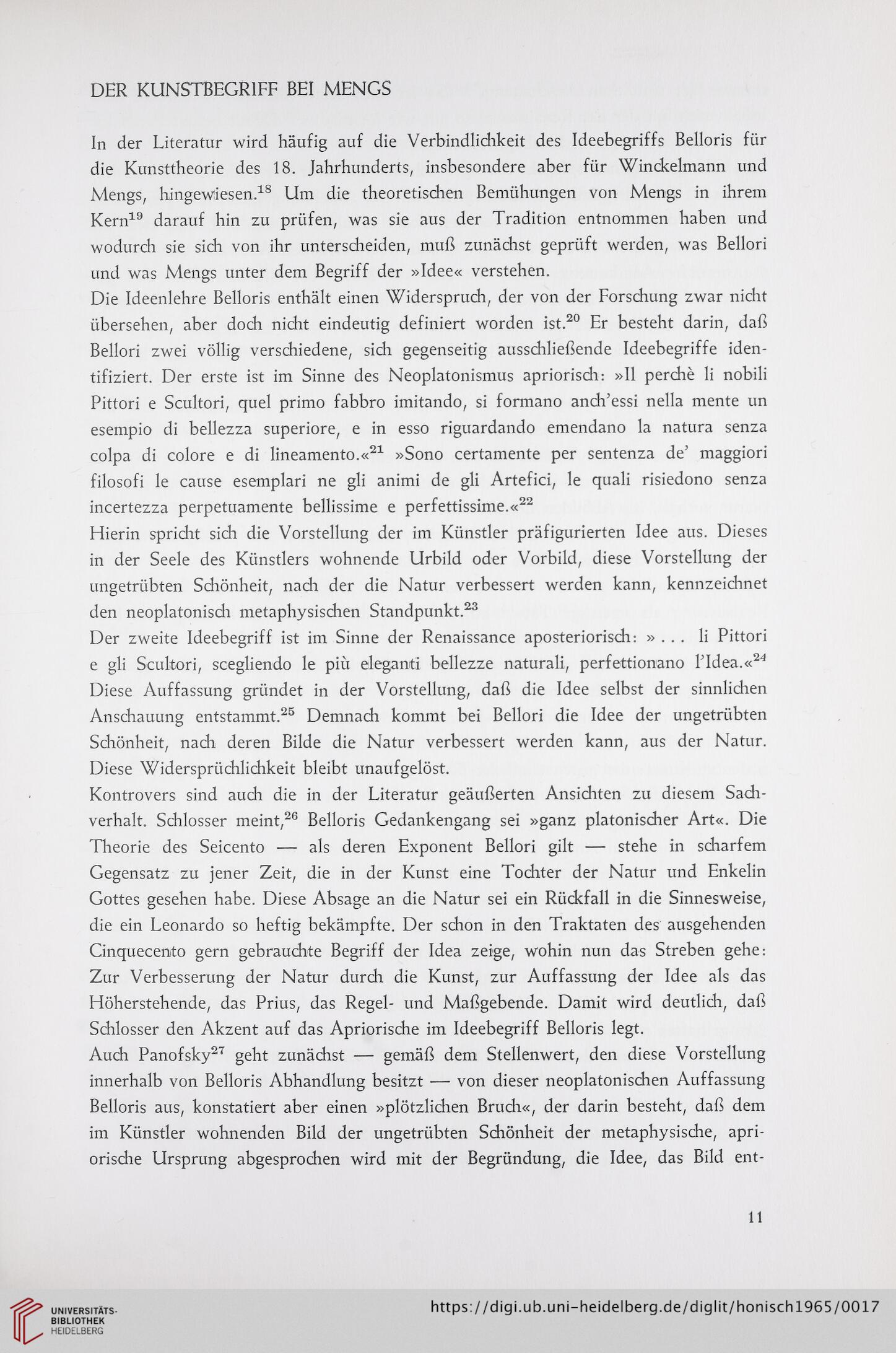DER KUNSTBEGRIFF BEI MENGS
In der Literatur wird häufig auf die Verbindlichkeit des Ideebegriffs Beiloris für
die Kunsttheorie des 18. Jahrhunderts, insbesondere aber für Winckelmann und
Mengs, hingewiesen.18 Um die theoretischen Bemühungen von Mengs in ihrem
Kern19 darauf hin zu prüfen, was sie aus der Tradition entnommen haben und
wodurch sie sich von ihr unterscheiden, muß zunächst geprüft werden, was Bellori
und was Mengs unter dem Begriff der »Idee« verstehen.
Die Ideenlehre Beiloris enthält einen Widerspruch, der von der Forschung zwar nicht
übersehen, aber doch nicht eindeutig definiert worden ist.20 Er besteht darin, daß
Bellori zwei völlig verschiedene, sich gegenseitig ausschließende Ideebegriffe iden-
tifiziert. Der erste ist im Sinne des Neoplatonismus apriorisch: »II perche li nobili
Pittori e Scultori, quel primo fabbro imitando, si formano anch’essi nella mente un
esempio di bellezza superiore, e in esso riguardando emendano la natura senza
colpa di colore e di lineamento.«21 »Sono certamente per sentenza de’ maggiori
filosofi le cause esemplari ne gli animi de gli Artefici, le quali risiedono senza
incertezza perpetuamente bellissime e perfettissime.«22
Hierin spricht sich die Vorstellung der im Künstler präfigurierten Idee aus. Dieses
in der Seele des Künstlers wohnende Urbild oder Vorbild, diese Vorstellung der
ungetrübten Schönheit, nach der die Natur verbessert werden kann, kennzeichnet
den neoplatonisch metaphysischen Standpunkt.23
Der zweite Ideebegriff ist im Sinne der Renaissance aposteriorisch: » . . . li Pittori
e gli Scultori, scegliendo le piü eleganti bellezze naturali, perfettionano l’Idea.«21
Diese Auffassung gründet in der Vorstellung, daß die Idee selbst der sinnlichen
Anschauung entstammt.25 Demnach kommt bei Bellori die Idee der ungetrübten
Schönheit, nach deren Bilde die Natur verbessert werden kann, aus der Natur.
Diese Widersprüchlichkeit bleibt unaufgelöst.
Kontrovers sind auch die in der Literatur geäußerten Ansichten zu diesem Sach-
verhalt. Schlosser meint,26 Belloris Gedankengang sei »ganz platonischer Art«. Die
Theorie des Seicento — als deren Exponent Bellori gilt — stehe in scharfem
Gegensatz zu jener Zeit, die in der Kunst eine Tochter der Natur und Enkelin
Gottes gesehen habe. Diese Absage an die Natur sei ein Rückfall in die Sinnesweise,
die ein Leonardo so heftig bekämpfte. Der schon in den Traktaten des ausgehenden
Cinquecento gern gebrauchte Begriff der Idea zeige, wohin nun das Streben gehe:
Zur Verbesserung der Natur durch die Kunst, zur Auffassung der Idee als das
Höherstehende, das Prius, das Regel- und Maßgebende. Damit wird deutlich, daß
Schlosser den Akzent auf das Apriorische im Ideebegriff Belloris legt.
Auch Panofsky27 geht zunächst — gemäß dem Stellenwert, den diese Vorstellung
innerhalb von Belloris Abhandlung besitzt — von dieser neoplatonischen Auffassung
Belloris aus, konstatiert aber einen »plötzlichen Bruch«, der darin besteht, daß dem
im Künstler wohnenden Bild der ungetrübten Schönheit der metaphysische, apri-
orische Ursprung abgesprochen wird mit der Begründung, die Idee, das Bild ent-
11
In der Literatur wird häufig auf die Verbindlichkeit des Ideebegriffs Beiloris für
die Kunsttheorie des 18. Jahrhunderts, insbesondere aber für Winckelmann und
Mengs, hingewiesen.18 Um die theoretischen Bemühungen von Mengs in ihrem
Kern19 darauf hin zu prüfen, was sie aus der Tradition entnommen haben und
wodurch sie sich von ihr unterscheiden, muß zunächst geprüft werden, was Bellori
und was Mengs unter dem Begriff der »Idee« verstehen.
Die Ideenlehre Beiloris enthält einen Widerspruch, der von der Forschung zwar nicht
übersehen, aber doch nicht eindeutig definiert worden ist.20 Er besteht darin, daß
Bellori zwei völlig verschiedene, sich gegenseitig ausschließende Ideebegriffe iden-
tifiziert. Der erste ist im Sinne des Neoplatonismus apriorisch: »II perche li nobili
Pittori e Scultori, quel primo fabbro imitando, si formano anch’essi nella mente un
esempio di bellezza superiore, e in esso riguardando emendano la natura senza
colpa di colore e di lineamento.«21 »Sono certamente per sentenza de’ maggiori
filosofi le cause esemplari ne gli animi de gli Artefici, le quali risiedono senza
incertezza perpetuamente bellissime e perfettissime.«22
Hierin spricht sich die Vorstellung der im Künstler präfigurierten Idee aus. Dieses
in der Seele des Künstlers wohnende Urbild oder Vorbild, diese Vorstellung der
ungetrübten Schönheit, nach der die Natur verbessert werden kann, kennzeichnet
den neoplatonisch metaphysischen Standpunkt.23
Der zweite Ideebegriff ist im Sinne der Renaissance aposteriorisch: » . . . li Pittori
e gli Scultori, scegliendo le piü eleganti bellezze naturali, perfettionano l’Idea.«21
Diese Auffassung gründet in der Vorstellung, daß die Idee selbst der sinnlichen
Anschauung entstammt.25 Demnach kommt bei Bellori die Idee der ungetrübten
Schönheit, nach deren Bilde die Natur verbessert werden kann, aus der Natur.
Diese Widersprüchlichkeit bleibt unaufgelöst.
Kontrovers sind auch die in der Literatur geäußerten Ansichten zu diesem Sach-
verhalt. Schlosser meint,26 Belloris Gedankengang sei »ganz platonischer Art«. Die
Theorie des Seicento — als deren Exponent Bellori gilt — stehe in scharfem
Gegensatz zu jener Zeit, die in der Kunst eine Tochter der Natur und Enkelin
Gottes gesehen habe. Diese Absage an die Natur sei ein Rückfall in die Sinnesweise,
die ein Leonardo so heftig bekämpfte. Der schon in den Traktaten des ausgehenden
Cinquecento gern gebrauchte Begriff der Idea zeige, wohin nun das Streben gehe:
Zur Verbesserung der Natur durch die Kunst, zur Auffassung der Idee als das
Höherstehende, das Prius, das Regel- und Maßgebende. Damit wird deutlich, daß
Schlosser den Akzent auf das Apriorische im Ideebegriff Belloris legt.
Auch Panofsky27 geht zunächst — gemäß dem Stellenwert, den diese Vorstellung
innerhalb von Belloris Abhandlung besitzt — von dieser neoplatonischen Auffassung
Belloris aus, konstatiert aber einen »plötzlichen Bruch«, der darin besteht, daß dem
im Künstler wohnenden Bild der ungetrübten Schönheit der metaphysische, apri-
orische Ursprung abgesprochen wird mit der Begründung, die Idee, das Bild ent-
11