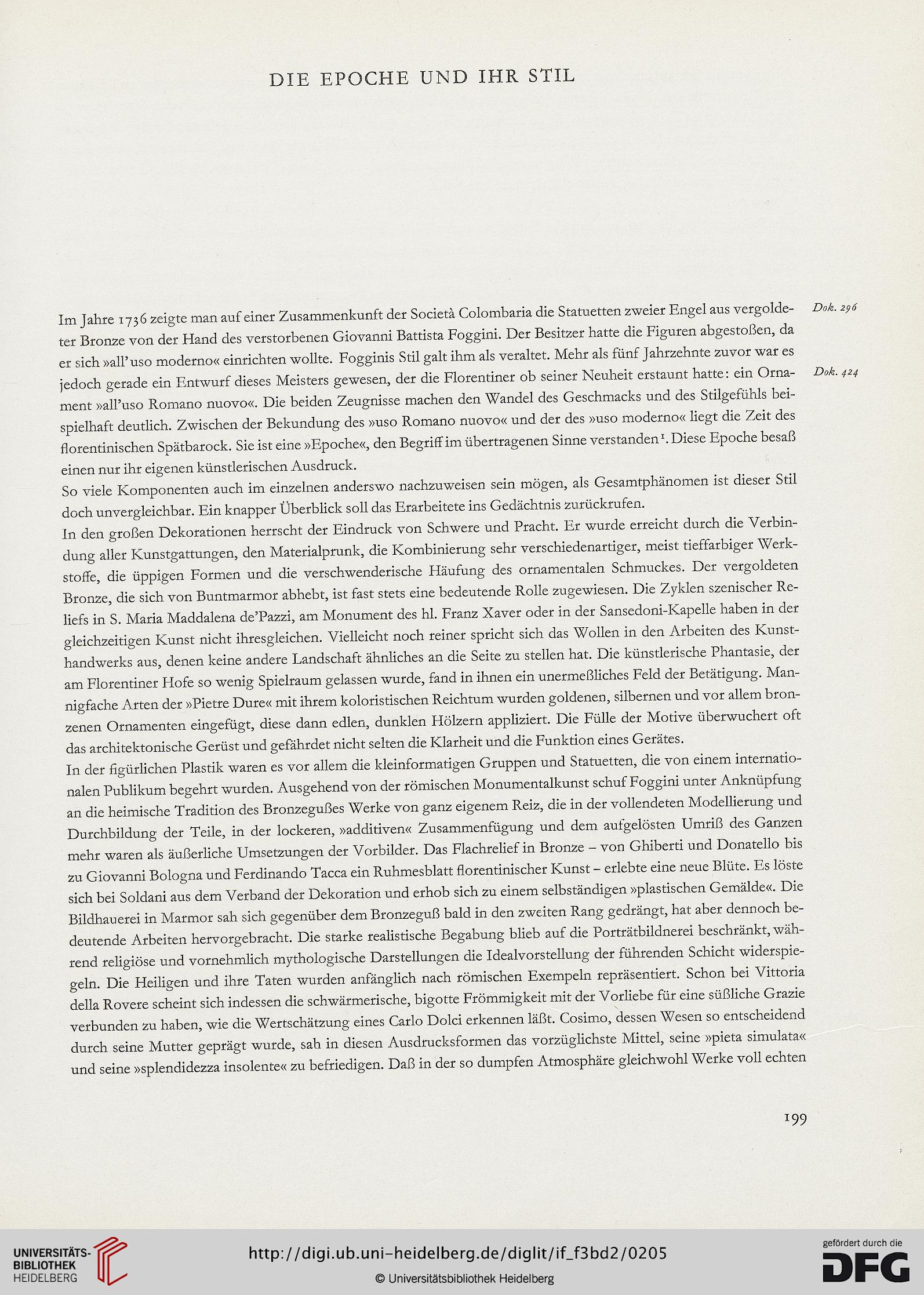DIE EPOCHE UND IHR STIL
Im Jahre 1*736 zeigte man auf einer Zusammenkunft der Societa Colombaria die Statuetten zweier Engel aus vergolde-
ter Bronze von der Hand des verstorbenen Giovanni Battista Foggini. Der Besitzer hatte die Figuren abgestoßen, da
er sich »all'uso moderno« einrichten wollte. Fogginis Stil galt ihm als veraltet. Mehr als fünf Jahrzehnte zuvor war es
jedoch gerade ein Entwurf dieses Meisters gewesen, der die Florentiner ob seiner Neuheit erstaunt hatte: ein Orna-
ment »all'uso Romano nuovo«. Die beiden Zeugnisse machen den Wandel des Geschmacks und des Stilgefühls bei-
spielhaft deutlich. Zwischen der Bekundung des »uso Romano nuovo« und der des »uso moderno« liegt die Zeit des
Rorentinischen Spätbarock. Sie ist eine »Epoche«, den Begriff im übertragenen Sinne verstanden *. Diese Epoche besaß
einen nur ihr eigenen künstlerischen Ausdruck.
So viele Komponenten auch im einzelnen anderswo nachzuweisen sein mögen, als Gesamtphänomen ist dieser Stil
doch unvergleichbar. Ein knapper Überblick soll das Erarbeitete ins Gedächtnis zurückrufen.
In den großen Dekorationen herrscht der Eindruck von Schwere und Pracht. Er wurde erreicht durch die Verbin-
dung aller Kunstgattungen, den Materialprunk, die Kombinierung sehr verschiedenartiger, meist tieffarbiger Werk-
stoffe, die üppigen Formen und die verschwenderische Häufung des ornamentalen Schmuckes. Der vergoldeten
Bronze, die sich von Buntmarmor abhebt, ist fast stets eine bedeutende Rolle zugewiesen. Die Zyklen szenischer Re-
liefs in S. Maria Maddalena de'Pazzi, am Monument des hl. Franz Xaver oder in der Sansedoni-Kapelle haben in der
gleichzeitigen Kunst nicht ihresgleichen. Vielleicht noch reiner spricht sich das Wollen in den Arbeiten des Kunst-
handwerks aus, denen keine andere Landschaft ähnliches an die Seite zu stellen hat. Die künstlerische Phantasie, der
am Florentiner Hofe so wenig Spielraum gelassen wurde, fand in ihnen ein unermeßliches Feld der Betätigung. Man-
nigfache Arten der »Pietre Dure« mit ihrem koloristischen Reichtum wurden goldenen, silbernen und vor allem bron-
zenen Ornamenten eingefugt, diese dann edlen, dunklen Hölzern appliziert. Die Fülle der Motive überwuchert oft
das architektonische Gerüst und gefährdet nicht selten die Klarheit und die Funktion eines Gerätes.
In der figürlichen Plastik waren es vor allem die kleinformatigen Gruppen und Statuetten, die von einem internatio-
nalen Publikum begehrt wurden. Ausgehend von der römischen Monumentalkunst schuf Foggini unter Anknüpfung
an die heimische Tradition des Bronzegußes Werke von ganz eigenem Reiz, die in der vollendeten Modellierung und
Durchbildung der Teile, in der lockeren, »additiven« Zusammenfügung und dem aufgelösten Umriß des Ganzen
mehr waren als äußerliche Umsetzungen der Vorbilder. Das Flachrelief in Bronze - von Ghiberti und Donatello bis
zu Giovanni Bologna und Ferdinando Tacca ein Ruhmesblatt florentinischer Kunst - erlebte eine neue Blüte. Es löste
sich bei Soldani aus dem Verband der Dekoration und erhob sich zu einem selbständigen »plastischen Gemälde«. Die
Bildhauerei in Marmor sah sich gegenüber dem Bronzeguß bald in den zweiten Rang gedrängt, hat aber dennoch be-
deutende Arbeiten hervorgebracht. Die starke realistische Begabung blieb auf die Porträtbildnerei beschränkt, wäh-
rend religiöse und vornehmlich mythologische Darstellungen die Idealvorstellung der führenden Schicht widerspie-
geln. Die Heiligen und ihre Taten wurden anfänglich nach römischen Exempeln repräsentiert. Schon bei Vittoria
della Rovere scheint sich indessen die schwärmerische, bigotte Frömmigkeit mit der Vorliebe für eine süßliche Grazie
verbunden zu haben, wie die Wertschätzung eines Carlo Dolci erkennen läßt. Cosimo, dessen Wesen so entscheidend
durch seine Mutter geprägt wurde, sah in diesen Ausdrucksformen das vorzüglichste Mittel, seine »pieta simulata«
und seine »splendidezza insolente« zu befriedigen. Daß in der so dumpfen Atmosphäre gleichwohl Werke voll echten
199
Im Jahre 1*736 zeigte man auf einer Zusammenkunft der Societa Colombaria die Statuetten zweier Engel aus vergolde-
ter Bronze von der Hand des verstorbenen Giovanni Battista Foggini. Der Besitzer hatte die Figuren abgestoßen, da
er sich »all'uso moderno« einrichten wollte. Fogginis Stil galt ihm als veraltet. Mehr als fünf Jahrzehnte zuvor war es
jedoch gerade ein Entwurf dieses Meisters gewesen, der die Florentiner ob seiner Neuheit erstaunt hatte: ein Orna-
ment »all'uso Romano nuovo«. Die beiden Zeugnisse machen den Wandel des Geschmacks und des Stilgefühls bei-
spielhaft deutlich. Zwischen der Bekundung des »uso Romano nuovo« und der des »uso moderno« liegt die Zeit des
Rorentinischen Spätbarock. Sie ist eine »Epoche«, den Begriff im übertragenen Sinne verstanden *. Diese Epoche besaß
einen nur ihr eigenen künstlerischen Ausdruck.
So viele Komponenten auch im einzelnen anderswo nachzuweisen sein mögen, als Gesamtphänomen ist dieser Stil
doch unvergleichbar. Ein knapper Überblick soll das Erarbeitete ins Gedächtnis zurückrufen.
In den großen Dekorationen herrscht der Eindruck von Schwere und Pracht. Er wurde erreicht durch die Verbin-
dung aller Kunstgattungen, den Materialprunk, die Kombinierung sehr verschiedenartiger, meist tieffarbiger Werk-
stoffe, die üppigen Formen und die verschwenderische Häufung des ornamentalen Schmuckes. Der vergoldeten
Bronze, die sich von Buntmarmor abhebt, ist fast stets eine bedeutende Rolle zugewiesen. Die Zyklen szenischer Re-
liefs in S. Maria Maddalena de'Pazzi, am Monument des hl. Franz Xaver oder in der Sansedoni-Kapelle haben in der
gleichzeitigen Kunst nicht ihresgleichen. Vielleicht noch reiner spricht sich das Wollen in den Arbeiten des Kunst-
handwerks aus, denen keine andere Landschaft ähnliches an die Seite zu stellen hat. Die künstlerische Phantasie, der
am Florentiner Hofe so wenig Spielraum gelassen wurde, fand in ihnen ein unermeßliches Feld der Betätigung. Man-
nigfache Arten der »Pietre Dure« mit ihrem koloristischen Reichtum wurden goldenen, silbernen und vor allem bron-
zenen Ornamenten eingefugt, diese dann edlen, dunklen Hölzern appliziert. Die Fülle der Motive überwuchert oft
das architektonische Gerüst und gefährdet nicht selten die Klarheit und die Funktion eines Gerätes.
In der figürlichen Plastik waren es vor allem die kleinformatigen Gruppen und Statuetten, die von einem internatio-
nalen Publikum begehrt wurden. Ausgehend von der römischen Monumentalkunst schuf Foggini unter Anknüpfung
an die heimische Tradition des Bronzegußes Werke von ganz eigenem Reiz, die in der vollendeten Modellierung und
Durchbildung der Teile, in der lockeren, »additiven« Zusammenfügung und dem aufgelösten Umriß des Ganzen
mehr waren als äußerliche Umsetzungen der Vorbilder. Das Flachrelief in Bronze - von Ghiberti und Donatello bis
zu Giovanni Bologna und Ferdinando Tacca ein Ruhmesblatt florentinischer Kunst - erlebte eine neue Blüte. Es löste
sich bei Soldani aus dem Verband der Dekoration und erhob sich zu einem selbständigen »plastischen Gemälde«. Die
Bildhauerei in Marmor sah sich gegenüber dem Bronzeguß bald in den zweiten Rang gedrängt, hat aber dennoch be-
deutende Arbeiten hervorgebracht. Die starke realistische Begabung blieb auf die Porträtbildnerei beschränkt, wäh-
rend religiöse und vornehmlich mythologische Darstellungen die Idealvorstellung der führenden Schicht widerspie-
geln. Die Heiligen und ihre Taten wurden anfänglich nach römischen Exempeln repräsentiert. Schon bei Vittoria
della Rovere scheint sich indessen die schwärmerische, bigotte Frömmigkeit mit der Vorliebe für eine süßliche Grazie
verbunden zu haben, wie die Wertschätzung eines Carlo Dolci erkennen läßt. Cosimo, dessen Wesen so entscheidend
durch seine Mutter geprägt wurde, sah in diesen Ausdrucksformen das vorzüglichste Mittel, seine »pieta simulata«
und seine »splendidezza insolente« zu befriedigen. Daß in der so dumpfen Atmosphäre gleichwohl Werke voll echten
199