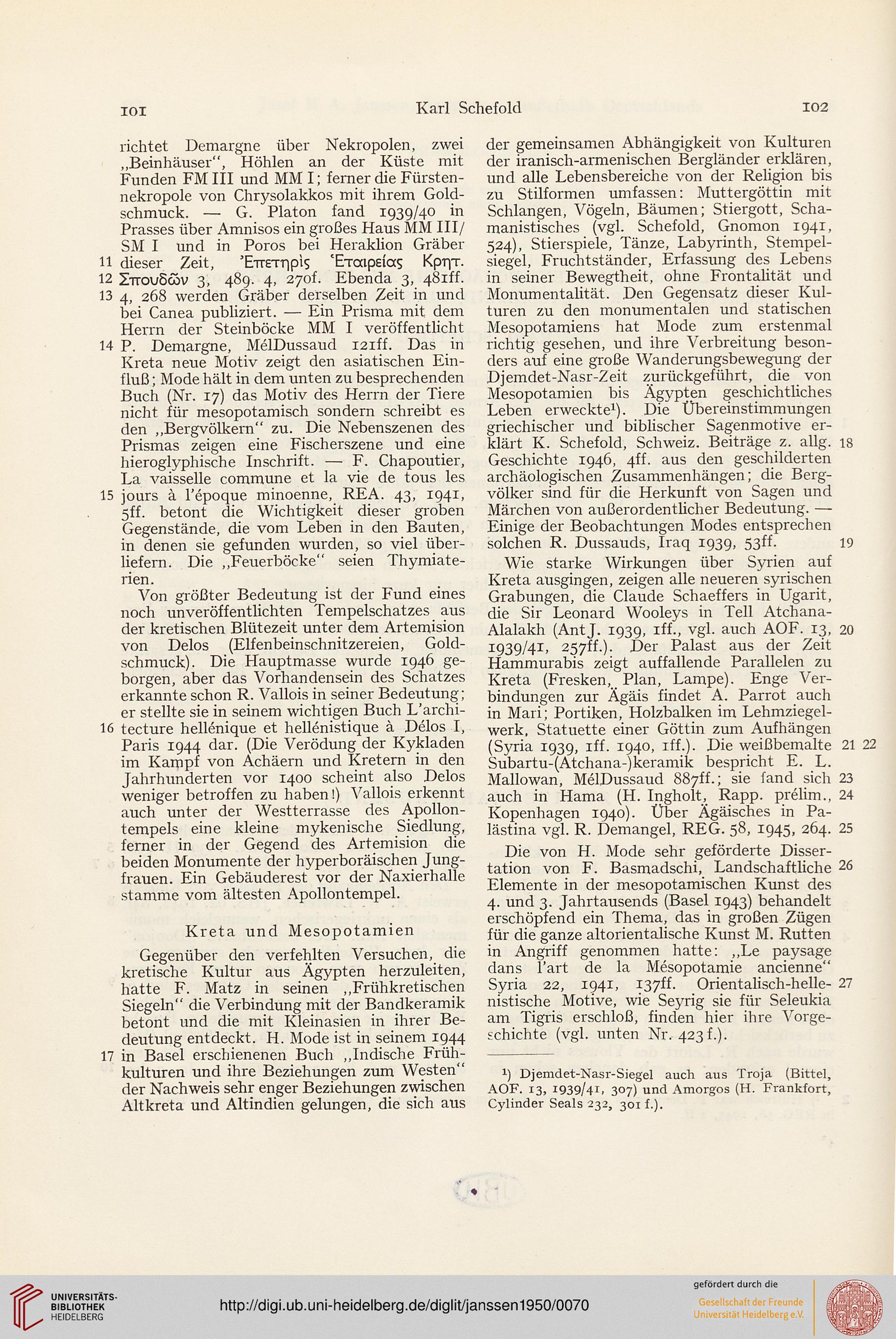101
Karl Schefold
102
richtet Demargne über Nekropolen, zwei
„Beinhäuser“, Höhlen an der Küste mit
Funden FMIII und MM I; ferner die Fürsten-
nekropole von Chrysolakkos mit ihrem Gold-
schmuck. — G. Platon fand 1939/40 in
Prasses über Amnisos ein großes Haus MM III/
SM I und in Poros bei Heraklion Gräber
11 dieser Zeit, ’EireTT|pi$ 'E-raipeia$ Kprfr.
12 SttouSwv 3, 489. 4, 270t. Ebenda 3, 48iff.
13 4, 268 werden Gräber derselben Zeit in und
bei Canea publiziert. — Ein Prisma mit dem
Herrn der Steinböcke MM I veröffentlicht
14 P. Demargne, MelDussaud I2iff. Das in
Kreta neue Motiv zeigt den asiatischen Ein-
fluß ; Mode hält in dem unten zu besprechenden
Buch (Nr. 17) das Motiv des Herrn der Tiere
nicht für mesopotamisch sondern schreibt es
den „Bergvölkern" zu. Die Nebenszenen des
Prismas zeigen eine Fischerszene und eine
hieroglyphische Inschrift. — F. Chapoutier,
La vaisselle commune et la vie de tous les
15 jours ä l’epoque minoenne, REA. 43, 1941,
5ff. betont die Wichtigkeit dieser groben
Gegenstände, die vom Leben in den Bauten,
in denen sie gefunden wurden, so viel über-
liefern. Die „Feuerböcke" seien Thymiate-
rien.
Von größter Bedeutung ist der Fund eines
noch unveröffentlichten Tempelschatzes aus
der kretischen Blütezeit unter dem Artemision
von Delos (Elfenbeinschnitzereien, Gold-
schmuck). Die Hauptmasse wurde 1946 ge-
borgen, aber das Vorhandensein des Schatzes
erkannte schon R. Vallois in seiner Bedeutung;
er stellte sie in seinem wichtigen Buch L’archi-
16 tecture hellenique et hellenistique ä Delos I,
Paris 1944 dar. (Die Verödung der Kykladen
im Kampf von Achäern und Kretern in den
Jahrhunderten vor 1400 scheint also Delos
weniger betroffen zu haben 1) Vallois erkennt
auch unter der Westterrasse des Apollon-
tempels eine kleine mykenische Siedlung,
ferner in der Gegend des Artemision die
beiden Monumente der hyperboräischen Jung-
frauen. Ein Gebäuderest vor der Naxierhalle
stamme vom ältesten Apollontempel.
Kreta und Mesopotamien
Gegenüber den verfehlten Versuchen, die
kretische Kultur aus Ägypten herzuleiten,
hatte F. Matz in seinen „Frühkretischen
Siegeln“ die Verbindung mit der Bandkeramik
betont und die mit Kleinasien in ihrer Be-
deutung entdeckt. H. Mode ist in seinem 1944
17 in Basel erschienenen Buch „Indische Früh-
kulturen und ihre Beziehungen zum Westen“
der Nachweis sehr enger Beziehungen zwischen
Altkreta und Altindien gelungen, die sich aus
der gemeinsamen Abhängigkeit von Kulturen
der iranisch-armenischen Bergländer erklären,
und alle Lebensbereiche von der Religion bis
zu Stilformen umfassen: Muttergöttin mit
Schlangen, Vögeln, Bäumen; Stiergott, Scha-
manistisches (vgl. Schefold, Gnomon 1941,
524), Stierspiele, Tänze, Labyrinth, Stempel-
siegel, Fruchtständer, Erfassung des Lebens
in seiner Bewegtheit, ohne Frontalität und
Monumentalität. Den Gegensatz dieser Kul-
turen zu den monumentalen und statischen
Mesopotamiens hat Mode zum erstenmal
richtig gesehen, und ihre Verbreitung beson-
ders auf eine große Wanderungsbewegung der
Djemdet-Nasr-Zeit zurückgeführt, die von
Mesopotamien bis Ägypten geschichtliches
Leben erweckte1). Die Übereinstimmungen
griechischer und biblischer Sagenmotive er-
klärt K. Schefold, Schweiz. Beiträge z. allg. 18
Geschichte 1946, 4ff. aus den geschilderten
archäologischen Zusammenhängen; die Berg-
völker sind für die Herkunft von Sagen und
Märchen von außerordentlicher Bedeutung. —
Einige der Beobachtungen Modes entsprechen
solchen R. Dussauds, Iraq 1939, 53ff- 19
Wie starke Wirkungen über Syrien auf
Kreta ausgingen, zeigen alle neueren syrischen
Grabungen, die Claude Schaeffers in Ugarit,
die Sir Leonard Wooleys in Teil Atchana-
Alalakh (AntJ. 1939, iff., vgl. auch AOF. 13, 20
1939/41, 257ff.). Der Palast aus der Zeit
Hammurabis zeigt auffallende Parallelen zu
Kreta (Fresken, Plan, Lampe). Enge Ver-
bindungen zur Ägäis findet A. Parrot auch
in Mari; Portiken, Holzbalken im Lehmziegel-
werk, Statuette einer Göttin zum Aufhängen
(Syria 1939, iff. 1940, iff.). Die weißbemalte 21 22
Subartu-(Atchana-)keramik bespricht E. L.
Mallowan, MelDussaud Sßyff.; sie fand sich 23
auch in Hama (H. Ingholt, Rapp, prelim., 24
Kopenhagen 1940). Über Ägäisches in Pa-
lästina vgl. R. Demangel, REG. 58, 1945, 264. 25
Die von H. Mode sehr geförderte Disser-
tation von F. Basmadschi, Landschaftliche 26
Elemente in der mesopotamischen Kunst des
4. und 3. Jahrtausends (Basel 1943) behandelt
erschöpfend ein Thema, das in großen Zügen
für die ganze altorientalische Kunst M. Rutten
in Angriff genommen hatte: „Le paysage
dans l’art de la Mesopotamie ancienne“
Syria 22, 1941, i37ff. Orientalisch-helle- 27
nistische Motive, wie Seyrig sie für Seleukia
am Tigris erschloß, finden hier ihre Vorge-
schichte (vgl. unten Nr. 423!.).
Djemdet-Nasr-Siegel auch aus Troja (Bittet,
AOF. 13, 1939/41, 307) und Amorgos (H. Frankfort,
Cylinder Seals 232, 301 f.).
Karl Schefold
102
richtet Demargne über Nekropolen, zwei
„Beinhäuser“, Höhlen an der Küste mit
Funden FMIII und MM I; ferner die Fürsten-
nekropole von Chrysolakkos mit ihrem Gold-
schmuck. — G. Platon fand 1939/40 in
Prasses über Amnisos ein großes Haus MM III/
SM I und in Poros bei Heraklion Gräber
11 dieser Zeit, ’EireTT|pi$ 'E-raipeia$ Kprfr.
12 SttouSwv 3, 489. 4, 270t. Ebenda 3, 48iff.
13 4, 268 werden Gräber derselben Zeit in und
bei Canea publiziert. — Ein Prisma mit dem
Herrn der Steinböcke MM I veröffentlicht
14 P. Demargne, MelDussaud I2iff. Das in
Kreta neue Motiv zeigt den asiatischen Ein-
fluß ; Mode hält in dem unten zu besprechenden
Buch (Nr. 17) das Motiv des Herrn der Tiere
nicht für mesopotamisch sondern schreibt es
den „Bergvölkern" zu. Die Nebenszenen des
Prismas zeigen eine Fischerszene und eine
hieroglyphische Inschrift. — F. Chapoutier,
La vaisselle commune et la vie de tous les
15 jours ä l’epoque minoenne, REA. 43, 1941,
5ff. betont die Wichtigkeit dieser groben
Gegenstände, die vom Leben in den Bauten,
in denen sie gefunden wurden, so viel über-
liefern. Die „Feuerböcke" seien Thymiate-
rien.
Von größter Bedeutung ist der Fund eines
noch unveröffentlichten Tempelschatzes aus
der kretischen Blütezeit unter dem Artemision
von Delos (Elfenbeinschnitzereien, Gold-
schmuck). Die Hauptmasse wurde 1946 ge-
borgen, aber das Vorhandensein des Schatzes
erkannte schon R. Vallois in seiner Bedeutung;
er stellte sie in seinem wichtigen Buch L’archi-
16 tecture hellenique et hellenistique ä Delos I,
Paris 1944 dar. (Die Verödung der Kykladen
im Kampf von Achäern und Kretern in den
Jahrhunderten vor 1400 scheint also Delos
weniger betroffen zu haben 1) Vallois erkennt
auch unter der Westterrasse des Apollon-
tempels eine kleine mykenische Siedlung,
ferner in der Gegend des Artemision die
beiden Monumente der hyperboräischen Jung-
frauen. Ein Gebäuderest vor der Naxierhalle
stamme vom ältesten Apollontempel.
Kreta und Mesopotamien
Gegenüber den verfehlten Versuchen, die
kretische Kultur aus Ägypten herzuleiten,
hatte F. Matz in seinen „Frühkretischen
Siegeln“ die Verbindung mit der Bandkeramik
betont und die mit Kleinasien in ihrer Be-
deutung entdeckt. H. Mode ist in seinem 1944
17 in Basel erschienenen Buch „Indische Früh-
kulturen und ihre Beziehungen zum Westen“
der Nachweis sehr enger Beziehungen zwischen
Altkreta und Altindien gelungen, die sich aus
der gemeinsamen Abhängigkeit von Kulturen
der iranisch-armenischen Bergländer erklären,
und alle Lebensbereiche von der Religion bis
zu Stilformen umfassen: Muttergöttin mit
Schlangen, Vögeln, Bäumen; Stiergott, Scha-
manistisches (vgl. Schefold, Gnomon 1941,
524), Stierspiele, Tänze, Labyrinth, Stempel-
siegel, Fruchtständer, Erfassung des Lebens
in seiner Bewegtheit, ohne Frontalität und
Monumentalität. Den Gegensatz dieser Kul-
turen zu den monumentalen und statischen
Mesopotamiens hat Mode zum erstenmal
richtig gesehen, und ihre Verbreitung beson-
ders auf eine große Wanderungsbewegung der
Djemdet-Nasr-Zeit zurückgeführt, die von
Mesopotamien bis Ägypten geschichtliches
Leben erweckte1). Die Übereinstimmungen
griechischer und biblischer Sagenmotive er-
klärt K. Schefold, Schweiz. Beiträge z. allg. 18
Geschichte 1946, 4ff. aus den geschilderten
archäologischen Zusammenhängen; die Berg-
völker sind für die Herkunft von Sagen und
Märchen von außerordentlicher Bedeutung. —
Einige der Beobachtungen Modes entsprechen
solchen R. Dussauds, Iraq 1939, 53ff- 19
Wie starke Wirkungen über Syrien auf
Kreta ausgingen, zeigen alle neueren syrischen
Grabungen, die Claude Schaeffers in Ugarit,
die Sir Leonard Wooleys in Teil Atchana-
Alalakh (AntJ. 1939, iff., vgl. auch AOF. 13, 20
1939/41, 257ff.). Der Palast aus der Zeit
Hammurabis zeigt auffallende Parallelen zu
Kreta (Fresken, Plan, Lampe). Enge Ver-
bindungen zur Ägäis findet A. Parrot auch
in Mari; Portiken, Holzbalken im Lehmziegel-
werk, Statuette einer Göttin zum Aufhängen
(Syria 1939, iff. 1940, iff.). Die weißbemalte 21 22
Subartu-(Atchana-)keramik bespricht E. L.
Mallowan, MelDussaud Sßyff.; sie fand sich 23
auch in Hama (H. Ingholt, Rapp, prelim., 24
Kopenhagen 1940). Über Ägäisches in Pa-
lästina vgl. R. Demangel, REG. 58, 1945, 264. 25
Die von H. Mode sehr geförderte Disser-
tation von F. Basmadschi, Landschaftliche 26
Elemente in der mesopotamischen Kunst des
4. und 3. Jahrtausends (Basel 1943) behandelt
erschöpfend ein Thema, das in großen Zügen
für die ganze altorientalische Kunst M. Rutten
in Angriff genommen hatte: „Le paysage
dans l’art de la Mesopotamie ancienne“
Syria 22, 1941, i37ff. Orientalisch-helle- 27
nistische Motive, wie Seyrig sie für Seleukia
am Tigris erschloß, finden hier ihre Vorge-
schichte (vgl. unten Nr. 423!.).
Djemdet-Nasr-Siegel auch aus Troja (Bittet,
AOF. 13, 1939/41, 307) und Amorgos (H. Frankfort,
Cylinder Seals 232, 301 f.).