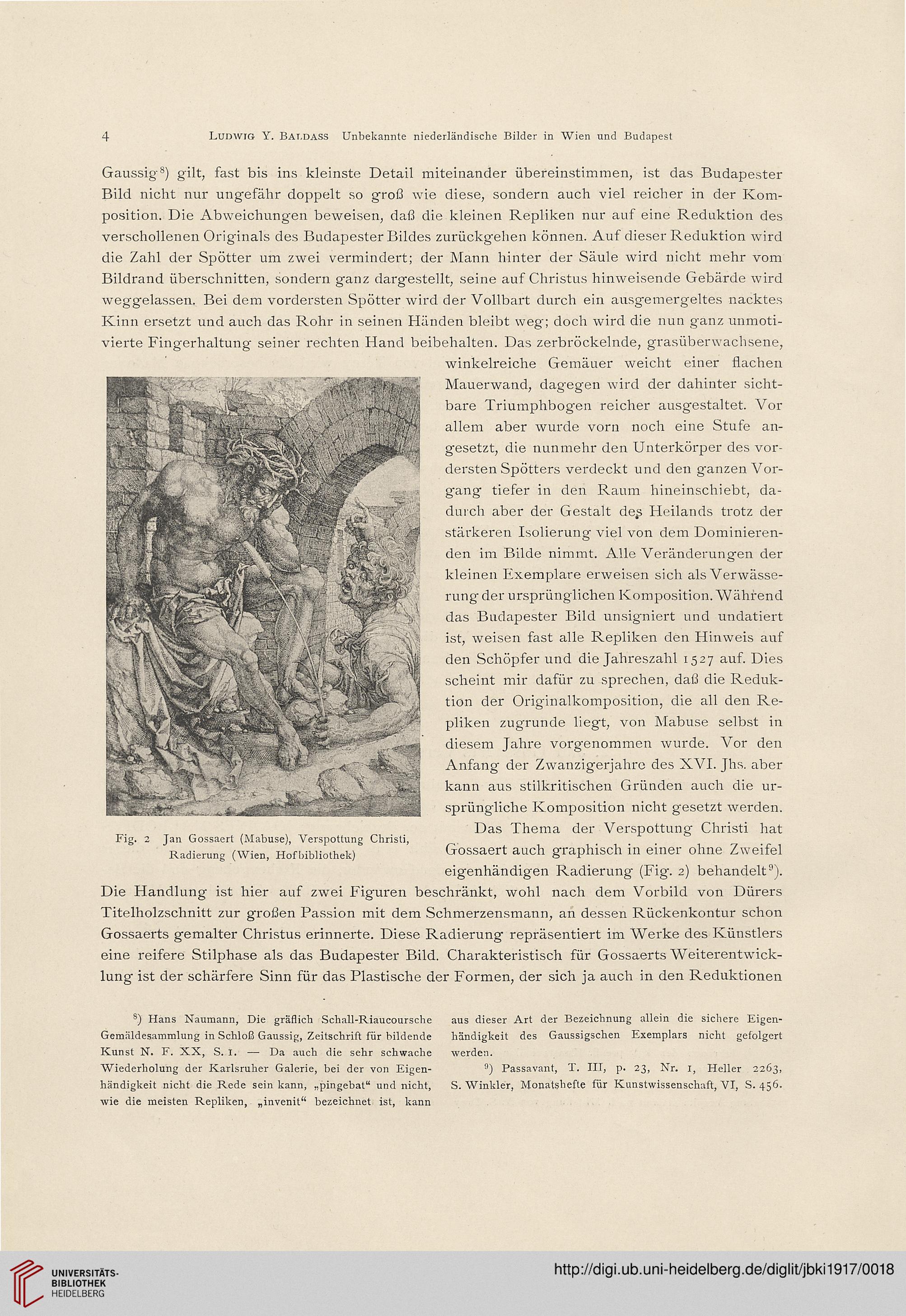4
Ludwig Y. Baldass Unbekannte niederländische Bilder in Wien und Budapest
Gaussig8) gilt, fast bis ins kleinste Detail miteinander übereinstimmen, ist das Budapester
Bild nicht nur ungefähr doppelt so groß wie diese, sondern auch viel reicher in der Kom-
position. Die Abweichungen beweisen, daß die kleinen Repliken nur auf eine Reduktion des
verschollenen Originals des Budapester Bildes zurückgehen können. Auf dieser Reduktion wird
die Zahl der Spötter um zwei vermindert; der Mann hinter der Säule wird nicht mehr vom
Bildrand überschnitten, sondern ganz dargestellt, seine auf Christus hinweisende Gebärde wird
weggelassen. Bei dem vordersten Spötter wird der Vollbart durch ein ausgemergeltes nacktes
Kinn ersetzt und auch das Rohr in seinen Händen bleibt weg; doch wird die nun ganz unmoti-
vierte Fingerhaltung seiner rechten Hand beibehalten. Das zerbröckelnde, grasüberwachsene,
winkelreiche Gemäuer weicht einer flachen
Mauerwand, dag'egen wird der dahinter sicht-
bare Triumphbogen reicher ausgestaltet. Vor
allem aber wurde vorn noch eine Stufe an-
gesetzt, die nunmehr den Unterkörper des vor-
dersten Spötters verdeckt und den ganzen Vor-
gang tiefer in den Raum hineinschiebt, da-
durch aber der Gestalt deß Heilands trotz der
stärkeren Isolierung viel von dem Dominieren-
den im Bilde nimmt. Alle Veränderungen der
kleinen Exemplare erweisen sich als Verwässe-
rung der ursprünglichen Komposition. Während
das Budapester Bild unsigniert und undatiert
ist, weisen fast alle Repliken den Hinweis auf
den Schöpfer und die Jahreszahl 1527 auf. Dies
scheint mir dafür zu sprechen, daß die Reduk-
tion der Originalkomposition, die all den Re-
pliken zugrunde liegt, von Mabuse selbst in
diesem Jahre vorgenommen wurde. Vor den
Anfang der Zwanzigerjahre des XVI. Jhs. aber
kann aus stilkritischen Gründen auch die ur-
sprüngliche Komposition nicht gesetzt werden.
Das Thema der Verspottung Christi hat
Gossaert auch graphisch in einer ohne Zweifel
eigenhändigen Radierung (Fig. 2) behandelt9).
Die Handlung ist hier auf zwei Figuren beschränkt, wohl nach dem Vorbild von Dürers
Titelholzschnitt zur großen Passion mit dem Schmerzensmann, an dessen Rückenkontur schon
Gossaerts gemalter Christus erinnerte. Diese Radierung repräsentiert im Werke des Künstlers
eine reifere Stilphase als das Budapester Bild. Charakteristisch für Gossaerts Weiterentwick-
lung ist der schärfere Sinn für das Plastische der Formen, der sich ja auch in den Reduktionen
Fig. 2 Jan Gossaert (Mabuse), Verspottung Christi,
Radierung (Wien, Hofbibliothek)
8) Hans Naumann, Die gräflich Schall-Riaucoursche
Gemäldesammlung in Schloß Gaussig, Zeitschrift für bildende
Kunst N. F. XX, S. I. — Da auch die sehr schwache
Wiederholung der Karlsruher Galerie, bei der von Eigen-
händigkeit nicht die Rede sein kann, „pingebat“ und nicht,
wie die meisten Repliken, „invenit“ bezeichnet ist, kann
aus dieser Art der Bezeichnung allein die sichere Eigen-
händigkeit des Gaussigschen Exemplars nicht gefolgert
werden.
9) Passavant, T. III, p. 23, Nr. 1, Heller 2263,
S. Winkler, Monatshefte für Kunstwissenschaft, VI, S. 456.
Ludwig Y. Baldass Unbekannte niederländische Bilder in Wien und Budapest
Gaussig8) gilt, fast bis ins kleinste Detail miteinander übereinstimmen, ist das Budapester
Bild nicht nur ungefähr doppelt so groß wie diese, sondern auch viel reicher in der Kom-
position. Die Abweichungen beweisen, daß die kleinen Repliken nur auf eine Reduktion des
verschollenen Originals des Budapester Bildes zurückgehen können. Auf dieser Reduktion wird
die Zahl der Spötter um zwei vermindert; der Mann hinter der Säule wird nicht mehr vom
Bildrand überschnitten, sondern ganz dargestellt, seine auf Christus hinweisende Gebärde wird
weggelassen. Bei dem vordersten Spötter wird der Vollbart durch ein ausgemergeltes nacktes
Kinn ersetzt und auch das Rohr in seinen Händen bleibt weg; doch wird die nun ganz unmoti-
vierte Fingerhaltung seiner rechten Hand beibehalten. Das zerbröckelnde, grasüberwachsene,
winkelreiche Gemäuer weicht einer flachen
Mauerwand, dag'egen wird der dahinter sicht-
bare Triumphbogen reicher ausgestaltet. Vor
allem aber wurde vorn noch eine Stufe an-
gesetzt, die nunmehr den Unterkörper des vor-
dersten Spötters verdeckt und den ganzen Vor-
gang tiefer in den Raum hineinschiebt, da-
durch aber der Gestalt deß Heilands trotz der
stärkeren Isolierung viel von dem Dominieren-
den im Bilde nimmt. Alle Veränderungen der
kleinen Exemplare erweisen sich als Verwässe-
rung der ursprünglichen Komposition. Während
das Budapester Bild unsigniert und undatiert
ist, weisen fast alle Repliken den Hinweis auf
den Schöpfer und die Jahreszahl 1527 auf. Dies
scheint mir dafür zu sprechen, daß die Reduk-
tion der Originalkomposition, die all den Re-
pliken zugrunde liegt, von Mabuse selbst in
diesem Jahre vorgenommen wurde. Vor den
Anfang der Zwanzigerjahre des XVI. Jhs. aber
kann aus stilkritischen Gründen auch die ur-
sprüngliche Komposition nicht gesetzt werden.
Das Thema der Verspottung Christi hat
Gossaert auch graphisch in einer ohne Zweifel
eigenhändigen Radierung (Fig. 2) behandelt9).
Die Handlung ist hier auf zwei Figuren beschränkt, wohl nach dem Vorbild von Dürers
Titelholzschnitt zur großen Passion mit dem Schmerzensmann, an dessen Rückenkontur schon
Gossaerts gemalter Christus erinnerte. Diese Radierung repräsentiert im Werke des Künstlers
eine reifere Stilphase als das Budapester Bild. Charakteristisch für Gossaerts Weiterentwick-
lung ist der schärfere Sinn für das Plastische der Formen, der sich ja auch in den Reduktionen
Fig. 2 Jan Gossaert (Mabuse), Verspottung Christi,
Radierung (Wien, Hofbibliothek)
8) Hans Naumann, Die gräflich Schall-Riaucoursche
Gemäldesammlung in Schloß Gaussig, Zeitschrift für bildende
Kunst N. F. XX, S. I. — Da auch die sehr schwache
Wiederholung der Karlsruher Galerie, bei der von Eigen-
händigkeit nicht die Rede sein kann, „pingebat“ und nicht,
wie die meisten Repliken, „invenit“ bezeichnet ist, kann
aus dieser Art der Bezeichnung allein die sichere Eigen-
händigkeit des Gaussigschen Exemplars nicht gefolgert
werden.
9) Passavant, T. III, p. 23, Nr. 1, Heller 2263,
S. Winkler, Monatshefte für Kunstwissenschaft, VI, S. 456.