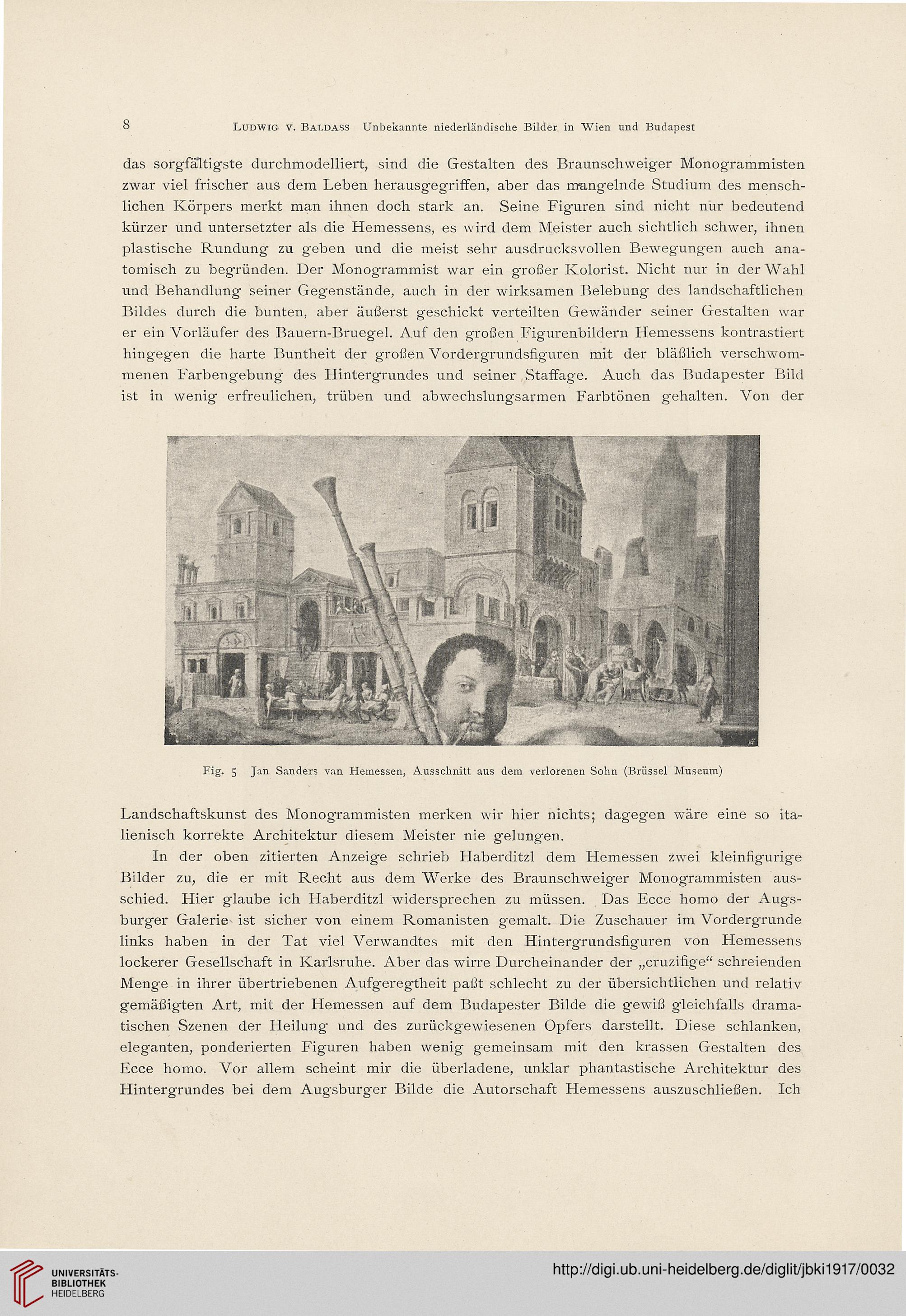Ludwig v. Baldass Unbekannte niederländische Bilder in Wien und Budapest
das sorgfältigste durchmodelliert, sind die Gestalten des Braunschweiger Monogrammisten
zwar viel frischer aus dem Leben herausgegriffen, aber das mangelnde Studium des mensch-
lichen Körpers merkt man ihnen doch stark an. Seine Figuren sind nicht nur bedeutend
kürzer und untersetzter als die Hemessens, es wird dem Meister auch sichtlich schwer, ihnen
plastische Rundung zu geben und die meist sehr ausdrucksvollen Bewegungen auch ana-
tomisch zu begründen. Der Monogrammist war ein großer Kolorist. Nicht nur in der Wahl
und Behandlung seiner Gegenstände, auch in der wirksamen Belebung des landschaftlichen
Bildes durch die bunten, aber äußerst geschickt verteilten Gewänder seiner Gestalten war
er ein Vorläufer des Bauern-Bruegel. Auf den großen Figurenbildern Hemessens kontrastiert
hingegen die harte Buntheit der großen Vordergrundsfiguren mit der bläßlich verschwom-
menen Farbengebung des Hintergrundes und seiner Staffage. Auch das Budapester Bild
ist in wenig erfreulichen, trüben und abwechslungsarmen Farbtönen gehalten. Von der
Fig. 5 Jan Sanders van Hemessen, Ausschnitt aus dem verlorenen Sohn (Brüssel Museum)
Landschaftskunst des Monogrammisten merken wir hier nichts; dagegen wäre eine so ita-
lienisch korrekte Architektur diesem Meister nie gelungen.
In der oben zitierten Anzeige schrieb Haberditzl dem Hemessen zwei kleinfigurige
Bilder zu, die er mit Recht aus dem Werke des Braunschweiger Monogrammisten aus-
schied. Hier glaube ich Haberditzl widersprechen zu müssen. Das Ecce homo der Augs-
burger Galerie- ist sicher von einem Romanisten gemalt. Die Zuschauer im Vordergründe
links haben in der Tat viel Verwandtes mit den Hintergrundsfiguren von Hemessens
lockerer Gesellschaft in Karlsruhe. Aber das wirre Durcheinander der „cruzifige“ schreienden
Menge in ihrer übertriebenen Aufgeregtheit paßt schlecht zu der übersichtlichen und relativ
gemäßigten Art, mit der Hemessen auf dem Budapester Bilde die gewiß gleichfalls drama-
tischen Szenen der Heilung und des zurückgewiesenen Opfers darstellt. Diese schlanken,
eleganten, ponderierten Figuren haben wenig gemeinsam mit den krassen Gestalten des
Ecce homo. Vor allem scheint mir die überladene, unklar phantastische Architektur des
Hintergrundes bei dem Augsburger Bilde die Autorschaft Hemessens auszuschließen. Ich
das sorgfältigste durchmodelliert, sind die Gestalten des Braunschweiger Monogrammisten
zwar viel frischer aus dem Leben herausgegriffen, aber das mangelnde Studium des mensch-
lichen Körpers merkt man ihnen doch stark an. Seine Figuren sind nicht nur bedeutend
kürzer und untersetzter als die Hemessens, es wird dem Meister auch sichtlich schwer, ihnen
plastische Rundung zu geben und die meist sehr ausdrucksvollen Bewegungen auch ana-
tomisch zu begründen. Der Monogrammist war ein großer Kolorist. Nicht nur in der Wahl
und Behandlung seiner Gegenstände, auch in der wirksamen Belebung des landschaftlichen
Bildes durch die bunten, aber äußerst geschickt verteilten Gewänder seiner Gestalten war
er ein Vorläufer des Bauern-Bruegel. Auf den großen Figurenbildern Hemessens kontrastiert
hingegen die harte Buntheit der großen Vordergrundsfiguren mit der bläßlich verschwom-
menen Farbengebung des Hintergrundes und seiner Staffage. Auch das Budapester Bild
ist in wenig erfreulichen, trüben und abwechslungsarmen Farbtönen gehalten. Von der
Fig. 5 Jan Sanders van Hemessen, Ausschnitt aus dem verlorenen Sohn (Brüssel Museum)
Landschaftskunst des Monogrammisten merken wir hier nichts; dagegen wäre eine so ita-
lienisch korrekte Architektur diesem Meister nie gelungen.
In der oben zitierten Anzeige schrieb Haberditzl dem Hemessen zwei kleinfigurige
Bilder zu, die er mit Recht aus dem Werke des Braunschweiger Monogrammisten aus-
schied. Hier glaube ich Haberditzl widersprechen zu müssen. Das Ecce homo der Augs-
burger Galerie- ist sicher von einem Romanisten gemalt. Die Zuschauer im Vordergründe
links haben in der Tat viel Verwandtes mit den Hintergrundsfiguren von Hemessens
lockerer Gesellschaft in Karlsruhe. Aber das wirre Durcheinander der „cruzifige“ schreienden
Menge in ihrer übertriebenen Aufgeregtheit paßt schlecht zu der übersichtlichen und relativ
gemäßigten Art, mit der Hemessen auf dem Budapester Bilde die gewiß gleichfalls drama-
tischen Szenen der Heilung und des zurückgewiesenen Opfers darstellt. Diese schlanken,
eleganten, ponderierten Figuren haben wenig gemeinsam mit den krassen Gestalten des
Ecce homo. Vor allem scheint mir die überladene, unklar phantastische Architektur des
Hintergrundes bei dem Augsburger Bilde die Autorschaft Hemessens auszuschließen. Ich