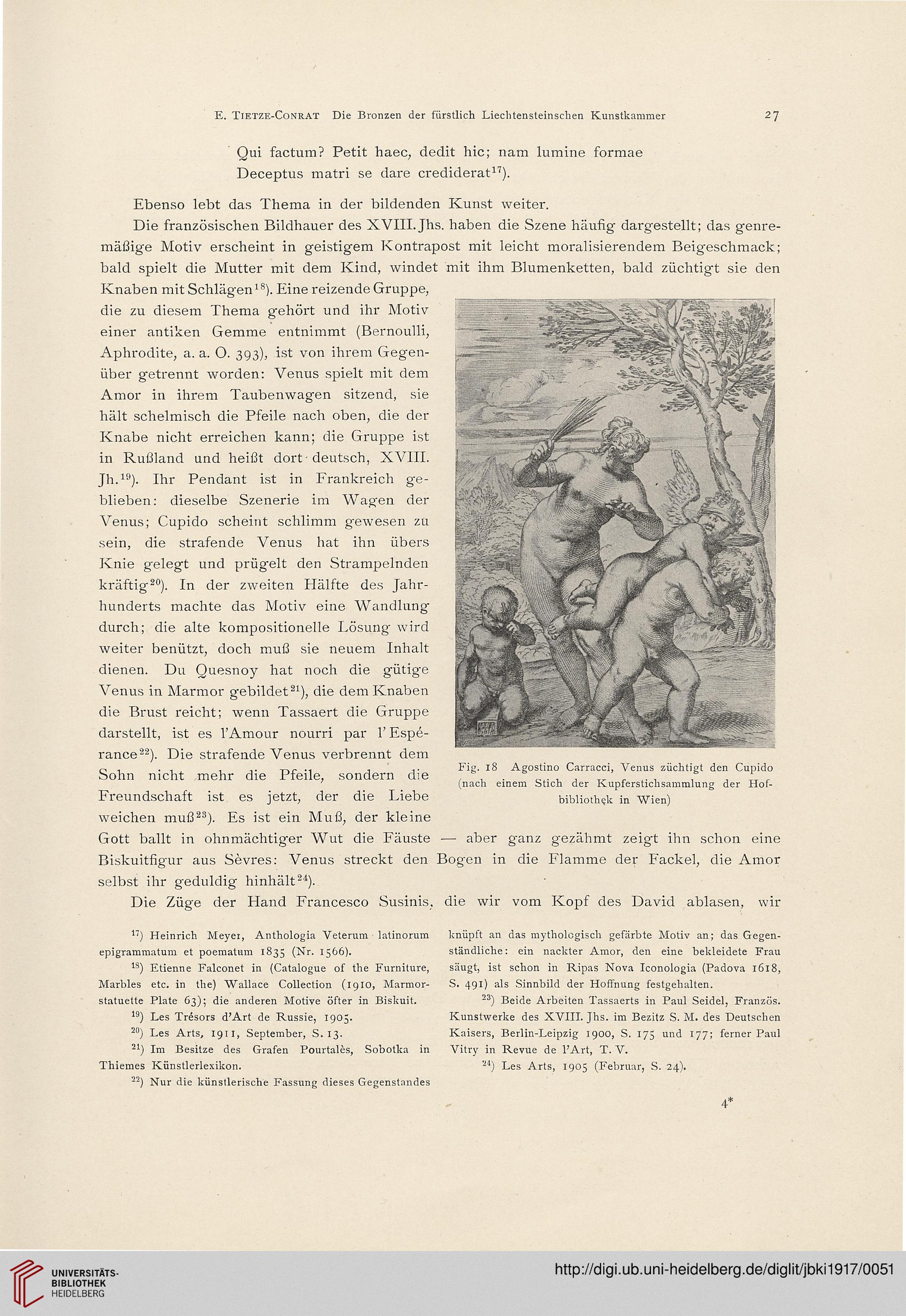E. Tietze-Conrat Die Bronzen der fürstlich Liechtensteinschen Kunstkammer
27
Qui factum? Petit haec, dedit hic; nam lumine formae
Deceptus matri se dare crediderat17).
Ebenso lebt das Thema in der bildenden Kunst weiter.
Die französischen Bildhauer des XVIII.Jhs. haben die Szene häufig dargestellt; das genre-
mäßige Motiv erscheint in geistigem Kontrapost mit leicht moralisierendem Beigeschmack;
bald spielt die Mutter mit dem Kind, windet mit ihm Blumenketten, bald züchtigt sie den
Knaben mit Schlägen18). Eine reizende Gruppe,
die zu diesem Thema g'ehört und ihr Motiv
einer antiken Gemme entnimmt (Bernoulli,
Aphrodite, a. a. O. 393), ist von ihrem Gegen-
über getrennt worden: Venus spielt mit dem
Amor in ihrem Taubenwagen sitzend, sie
hält schelmisch die Pfeile nach oben, die der
Knabe nicht erreichen kann; die Gruppe ist
in Rußland und heißt dort - deutsch, XVIII.
Jh.19). Ihr Pendant ist in Frankreich ge-
blieben: dieselbe Szenerie im Wagen der
Venus; Cupido scheint schlimm gewesen zu
sein, die strafende Venus hat ihn übers
Knie gelegt und prügelt den Strampelnden
kräftig20). In der zweiten Hälfte des Jahr-
hunderts machte das Motiv eine Wandlung
durch; die alte kompositionelle Lösung wird
weiter benützt, doch muß sie neuem Inhalt
dienen. Du Quesnoy hat noch die gütige
Venus in Marmor gebildet21), die dem Knaben
die Brust reicht; wenn Tassaert die Gruppe
darstellt, ist es l’Amour nourri par 1’ Espe-
rance22). Die strafende Venus verbrennt dem
Sohn nicht mehr die Pfeile, sondern die
Freundschaft ist es jetzt, der die Liebe
weichen muß23). Es ist ein Muß, der kleine
Gott ballt in ohnmächtiger Wut die Fäuste — aber ganz gezähmt zeigt ihn schon eine
Biskuitfigur aus Sevres: Venus streckt den Bogen in die Flamme der Fackel, die Amor
selbst ihr geduldig hinhält24).
Die Züge der Hand Francesco Susinis, die wir vom Kopf des David ablasen, wir
17) Heinrich Meyei, Anthologia Yeterum latinorum
epigrammatum et poematum 1835 (Nr. 1566).
18) Etienne Falconet in (Catalogue of the Furniture,
Marbles etc. in the) Wallace Collection (19IO, Marmor-
statuette Plate 63); die anderen Motive öfter in Biskuit.
19) Les Tresors d’Art de Russie, 1905.
20) Les Arts, 19II, September, S. 13.
21) Im Besitze des Grafen Pourtalös, Sobotka in
Thiemes Künstlerlexikon.
22) Nur die künstlerische Fassung dieses Gegenstandes
knüpft an das mythologisch gefärbte Motiv an; das Gegen-
ständliche : ein nackter Amor, den eine bekleidete Frau
säugt, ist schon in Ripas Nova Iconologia (Padova 1618,
S. 491) als Sinnbild der Hoffnung festgehalten.
23) Beide Arbeiten Tassaerts in Paul Seidel, Franzos.
Kunstwerke des XVIII. Jhs. im Bezitz S. M. des Deutschen
Kaisers, Berlin-Leipzig 1900, S. 175 und 177; ferner Paul
Vitry in Revue de PArt, T. Y.
24) Les Arts, 1905 (Februar, S. 24).
Fig. 18 Agostino Carracci, Venus züchtigt den Cupido
(nach einem Stich der Kupferstichsammlung der Hof-
bibliothek in Wien)
4'
27
Qui factum? Petit haec, dedit hic; nam lumine formae
Deceptus matri se dare crediderat17).
Ebenso lebt das Thema in der bildenden Kunst weiter.
Die französischen Bildhauer des XVIII.Jhs. haben die Szene häufig dargestellt; das genre-
mäßige Motiv erscheint in geistigem Kontrapost mit leicht moralisierendem Beigeschmack;
bald spielt die Mutter mit dem Kind, windet mit ihm Blumenketten, bald züchtigt sie den
Knaben mit Schlägen18). Eine reizende Gruppe,
die zu diesem Thema g'ehört und ihr Motiv
einer antiken Gemme entnimmt (Bernoulli,
Aphrodite, a. a. O. 393), ist von ihrem Gegen-
über getrennt worden: Venus spielt mit dem
Amor in ihrem Taubenwagen sitzend, sie
hält schelmisch die Pfeile nach oben, die der
Knabe nicht erreichen kann; die Gruppe ist
in Rußland und heißt dort - deutsch, XVIII.
Jh.19). Ihr Pendant ist in Frankreich ge-
blieben: dieselbe Szenerie im Wagen der
Venus; Cupido scheint schlimm gewesen zu
sein, die strafende Venus hat ihn übers
Knie gelegt und prügelt den Strampelnden
kräftig20). In der zweiten Hälfte des Jahr-
hunderts machte das Motiv eine Wandlung
durch; die alte kompositionelle Lösung wird
weiter benützt, doch muß sie neuem Inhalt
dienen. Du Quesnoy hat noch die gütige
Venus in Marmor gebildet21), die dem Knaben
die Brust reicht; wenn Tassaert die Gruppe
darstellt, ist es l’Amour nourri par 1’ Espe-
rance22). Die strafende Venus verbrennt dem
Sohn nicht mehr die Pfeile, sondern die
Freundschaft ist es jetzt, der die Liebe
weichen muß23). Es ist ein Muß, der kleine
Gott ballt in ohnmächtiger Wut die Fäuste — aber ganz gezähmt zeigt ihn schon eine
Biskuitfigur aus Sevres: Venus streckt den Bogen in die Flamme der Fackel, die Amor
selbst ihr geduldig hinhält24).
Die Züge der Hand Francesco Susinis, die wir vom Kopf des David ablasen, wir
17) Heinrich Meyei, Anthologia Yeterum latinorum
epigrammatum et poematum 1835 (Nr. 1566).
18) Etienne Falconet in (Catalogue of the Furniture,
Marbles etc. in the) Wallace Collection (19IO, Marmor-
statuette Plate 63); die anderen Motive öfter in Biskuit.
19) Les Tresors d’Art de Russie, 1905.
20) Les Arts, 19II, September, S. 13.
21) Im Besitze des Grafen Pourtalös, Sobotka in
Thiemes Künstlerlexikon.
22) Nur die künstlerische Fassung dieses Gegenstandes
knüpft an das mythologisch gefärbte Motiv an; das Gegen-
ständliche : ein nackter Amor, den eine bekleidete Frau
säugt, ist schon in Ripas Nova Iconologia (Padova 1618,
S. 491) als Sinnbild der Hoffnung festgehalten.
23) Beide Arbeiten Tassaerts in Paul Seidel, Franzos.
Kunstwerke des XVIII. Jhs. im Bezitz S. M. des Deutschen
Kaisers, Berlin-Leipzig 1900, S. 175 und 177; ferner Paul
Vitry in Revue de PArt, T. Y.
24) Les Arts, 1905 (Februar, S. 24).
Fig. 18 Agostino Carracci, Venus züchtigt den Cupido
(nach einem Stich der Kupferstichsammlung der Hof-
bibliothek in Wien)
4'