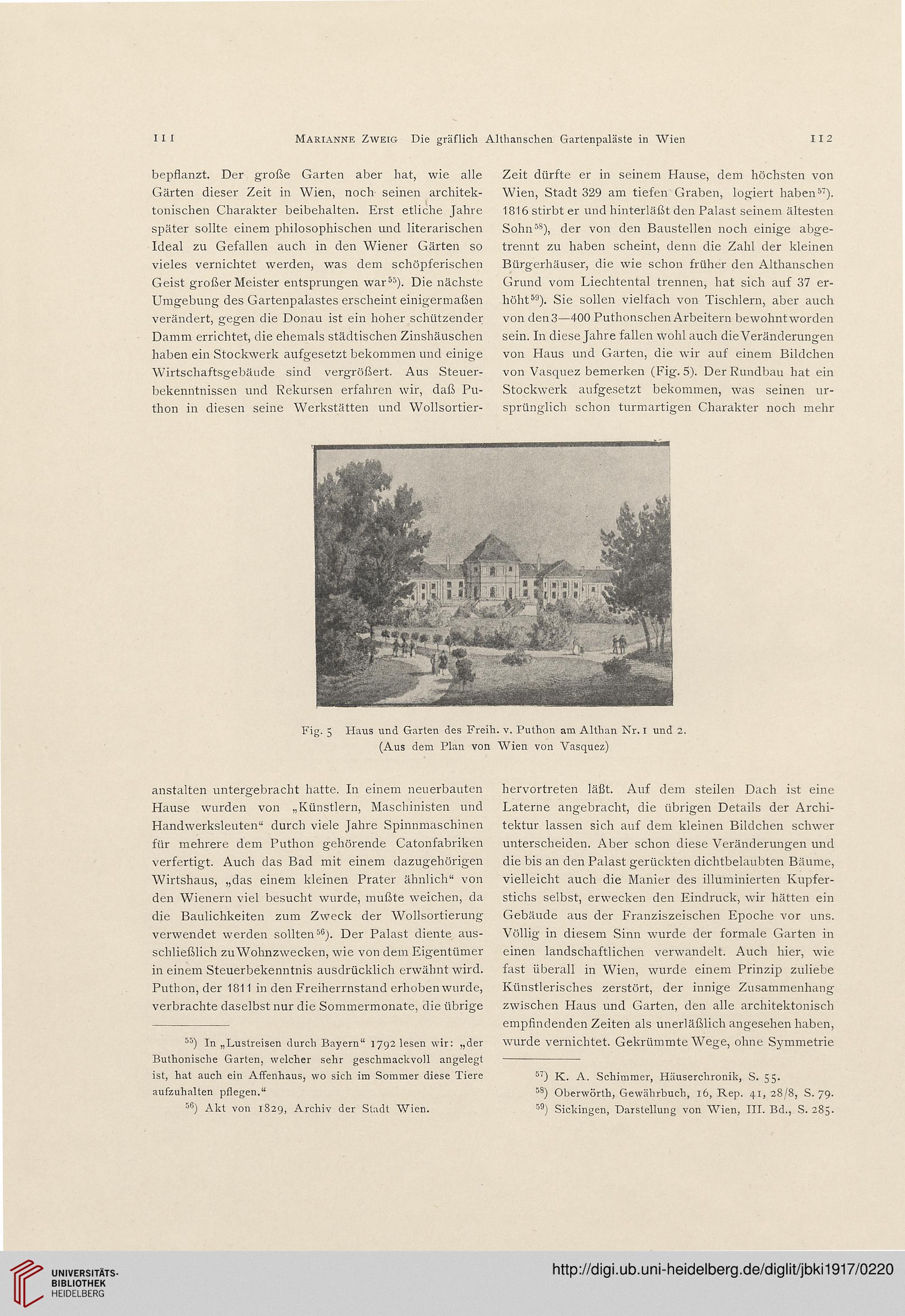111
Marianne Zweig- Die gräflich Althanschen Gartenpaläste in Wien
I 12
bepflanzt. Der große Garten aber hat, wie alle
Gärten dieser Zeit in Wien, noch seinen architek-
tonischen Charakter beibehalten. Erst etliche Jahre
später sollte einem philosophischen und literarischen
Ideal zu Gefallen auch in den Wiener Gärten so
vieles vernichtet werden, was dem schöpferischen
Geist großer Meister entsprungen war55). Die nächste
Umgebung des Gartenpalastes erscheint einigermaßen
verändert, gegen die Donau ist ein hoher schützender
Damm errichtet, die ehemals städtischen Zinshäuschen
haben ein Stockwerk aufgesetzt bekommen und einige
Wirtschaftsgebäude sind vergrößert. Aus Steuer-
bekenntnissen und Rekursen erfahren wir, daß Pu-
thon in diesen seine Werkstätten und Wollsortier-
Zeit dürfte er in seinem Hause, dem höchsten von
Wien, Stadt 329 am tiefen Graben, logiert haben57).
1816 stirbt er und hinterläßt den Palast seinem ältesten
Sohn58), der von den Baustellen noch einige abge-
trennt zu haben scheint, denn die Zahl der kleinen
Bürgerhäuser, die wie schon früher den Althanschen
Grund vom Liechtental trennen, hat sich auf 37 er-
höht69). Sie sollen vielfach von Tischlern, aber auch
von den3—400 Puthonschen Arbeitern bewohntworden
sein. In diese Jahre fallen wohl auch dieVeränderungen
von Haus und Garten, die wir auf einem Bildchen
von Vasquez bemerken (Fig. 5). Der Rundbau hat ein
Stockwerk aufgesetzt bekommen, was seinen ur-
sprünglich schon turmartigen Charakter noch mehr
Fig. 5 Haus und Garten des Freih. v. Puthon am Althan Nr. I und 2.
(Aus dem Plan von Wien von Vasquez)
anstalten untergebracht hatte. In einem neuerbauten
Hause wurden von „Künstlern, Maschinisten und
Handwerksleuten“ durch viele Jahre Spinnmaschinen
für mehrere dem Puthon gehörende Catonfabriken
verfertigt. Auch das Bad mit einem dazugehörigen
Wirtshaus, „das einem kleinen Prater ähnlich“ von
den Wienern viel besucht wurde, mußte weichen, da
die Baulichkeiten zum Zweck der Wollsortierung
verwendet werden sollten56). Der Palast diente aus-
schließlich zuWohnzwecken, wie von dem Eigentümer
in einem Steuerbekenntnis ausdrücklich erwähnt wird.
Puthon, der 1811 in den Freiherrnstand erhoben wurde,
verbrachte daselbst nur die Sommermonate, die übrige
55) In „Lustreisen durch Bayern“ 1792 lesen wir: „der
Buthonische Garten, welcher sehr geschmackvoll angelegt
ist, hat auch ein Affenhaus, wo sich im Sommer diese Tiere
aufzuhalten pflegen.“
56) Akt von 1829, Archiv der Stadt Wien.
hervortreten läßt. Auf dem steilen Dach ist eine
Laterne angebracht, die übrigen Details der Archi-
tektur lassen sich auf dem kleinen Bildchen schwer
unterscheiden. Aber schon diese Veränderungen und
die bis an den Palast gerückten dichtbelaubten Bäume,
vielleicht auch die Manier des illuminierten Kupfer-
stichs selbst, erwecken den Eindruck, wir hätten ein
Gebäude aus der Franziszeischen Epoche vor uns.
Völlig in diesem Sinn wurde der formale Garten in
einen landschaftlichen verwandelt. Auch hier, wie
fast überall in Wien, wurde einem Prinzip zuliebe
Künstlerisches zerstört, der innige Zusammenhang
zwischen Haus und Garten, den alle architektonisch
empfindenden Zeiten als unerläßlich angesehen haben,
wurde vernichtet. Gekrümmte Wege, ohne Symmetrie
57) K. A. Schimmer, Häuserchronik, S. 55.
58) Oberwörth, Gewährbuch, 16, Rep. 41, 28/8, S. 79.
59) Sickingen, Darstellung von Wien, III. Bd., S. 285.
Marianne Zweig- Die gräflich Althanschen Gartenpaläste in Wien
I 12
bepflanzt. Der große Garten aber hat, wie alle
Gärten dieser Zeit in Wien, noch seinen architek-
tonischen Charakter beibehalten. Erst etliche Jahre
später sollte einem philosophischen und literarischen
Ideal zu Gefallen auch in den Wiener Gärten so
vieles vernichtet werden, was dem schöpferischen
Geist großer Meister entsprungen war55). Die nächste
Umgebung des Gartenpalastes erscheint einigermaßen
verändert, gegen die Donau ist ein hoher schützender
Damm errichtet, die ehemals städtischen Zinshäuschen
haben ein Stockwerk aufgesetzt bekommen und einige
Wirtschaftsgebäude sind vergrößert. Aus Steuer-
bekenntnissen und Rekursen erfahren wir, daß Pu-
thon in diesen seine Werkstätten und Wollsortier-
Zeit dürfte er in seinem Hause, dem höchsten von
Wien, Stadt 329 am tiefen Graben, logiert haben57).
1816 stirbt er und hinterläßt den Palast seinem ältesten
Sohn58), der von den Baustellen noch einige abge-
trennt zu haben scheint, denn die Zahl der kleinen
Bürgerhäuser, die wie schon früher den Althanschen
Grund vom Liechtental trennen, hat sich auf 37 er-
höht69). Sie sollen vielfach von Tischlern, aber auch
von den3—400 Puthonschen Arbeitern bewohntworden
sein. In diese Jahre fallen wohl auch dieVeränderungen
von Haus und Garten, die wir auf einem Bildchen
von Vasquez bemerken (Fig. 5). Der Rundbau hat ein
Stockwerk aufgesetzt bekommen, was seinen ur-
sprünglich schon turmartigen Charakter noch mehr
Fig. 5 Haus und Garten des Freih. v. Puthon am Althan Nr. I und 2.
(Aus dem Plan von Wien von Vasquez)
anstalten untergebracht hatte. In einem neuerbauten
Hause wurden von „Künstlern, Maschinisten und
Handwerksleuten“ durch viele Jahre Spinnmaschinen
für mehrere dem Puthon gehörende Catonfabriken
verfertigt. Auch das Bad mit einem dazugehörigen
Wirtshaus, „das einem kleinen Prater ähnlich“ von
den Wienern viel besucht wurde, mußte weichen, da
die Baulichkeiten zum Zweck der Wollsortierung
verwendet werden sollten56). Der Palast diente aus-
schließlich zuWohnzwecken, wie von dem Eigentümer
in einem Steuerbekenntnis ausdrücklich erwähnt wird.
Puthon, der 1811 in den Freiherrnstand erhoben wurde,
verbrachte daselbst nur die Sommermonate, die übrige
55) In „Lustreisen durch Bayern“ 1792 lesen wir: „der
Buthonische Garten, welcher sehr geschmackvoll angelegt
ist, hat auch ein Affenhaus, wo sich im Sommer diese Tiere
aufzuhalten pflegen.“
56) Akt von 1829, Archiv der Stadt Wien.
hervortreten läßt. Auf dem steilen Dach ist eine
Laterne angebracht, die übrigen Details der Archi-
tektur lassen sich auf dem kleinen Bildchen schwer
unterscheiden. Aber schon diese Veränderungen und
die bis an den Palast gerückten dichtbelaubten Bäume,
vielleicht auch die Manier des illuminierten Kupfer-
stichs selbst, erwecken den Eindruck, wir hätten ein
Gebäude aus der Franziszeischen Epoche vor uns.
Völlig in diesem Sinn wurde der formale Garten in
einen landschaftlichen verwandelt. Auch hier, wie
fast überall in Wien, wurde einem Prinzip zuliebe
Künstlerisches zerstört, der innige Zusammenhang
zwischen Haus und Garten, den alle architektonisch
empfindenden Zeiten als unerläßlich angesehen haben,
wurde vernichtet. Gekrümmte Wege, ohne Symmetrie
57) K. A. Schimmer, Häuserchronik, S. 55.
58) Oberwörth, Gewährbuch, 16, Rep. 41, 28/8, S. 79.
59) Sickingen, Darstellung von Wien, III. Bd., S. 285.