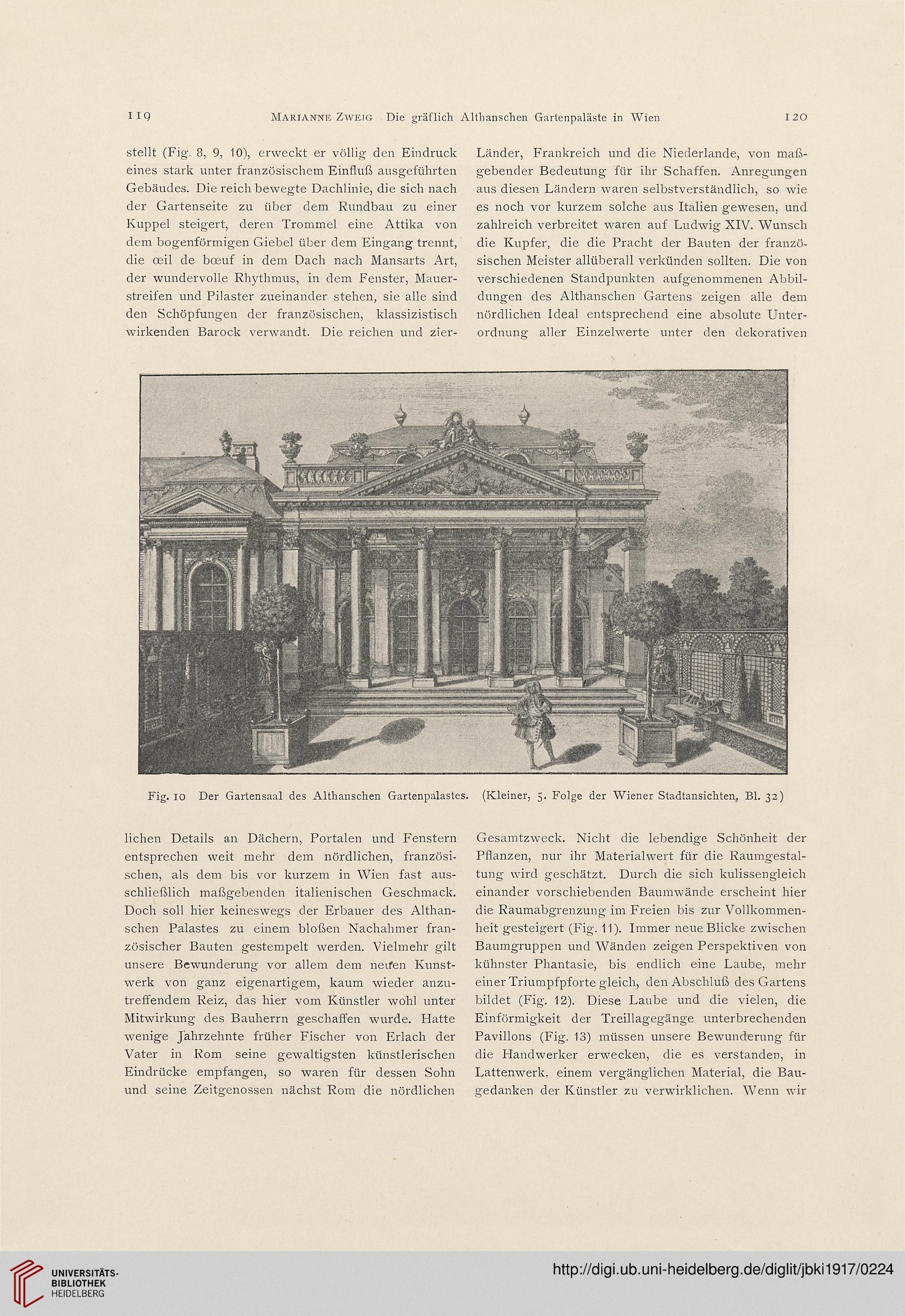Marianne Zweig Die gräflich Althanschen Gartenpaläste in Wien
120
I IQ
stellt (Fig\ 8, 9, 10), erweckt er völlig den Eindruck
eines stark unter französischem Einfluß ausgeführten
Gebäudes. Die reich bewegte Dachlinie, die sich nach
der Gartenseite zu über dem Rundbau zu einer
Kuppel steigert, deren Trommel eine Attika von
dem bogenförmigen Giebel über dem Eingang trennt,
die oeil de boeuf in dem Dach nach Mansarts Art,
der wundervolle Rhythmus, in dem Fenster, Mauer-
streifen und Pilaster zueinander stehen, sie alle sind
den Schöpfungen der französischen, klassizistisch
wirkenden Barock verwandt. Die reichen und zier-
Länder, Frankreich und die Niederlande, von maß-
gebender Bedeutung für ihr Schaffen. Anregungen
aus diesen Ländern waren selbstverständlich, so wie
es noch vor kurzem solche aus Italien gewesen, und
zahlreich verbreitet waren auf Ludwig XIV. Wunsch
die Kupfer, die die Pracht der Bauten der franzö-
sischen Meister allüberall verkünden sollten. Die von
verschiedenen Standpunkten aufgenommenen Abbil-
dungen des Althanschen Gartens zeigen alle dem
nördlichen Ideal entsprechend eine absolute Unter-
ordnung aller Einzelwerte unter den dekorativen
Fig. io Der Gartensaal des Althanschen Gartenpalastes. (Kleiner, 5. Folge der Wiener Stadtansichten, Bl. 32)
liehen Details an Dächern, Portalen und Fenstern
entsprechen weit mehr dem nördlichen, französi-
schen, als dem bis vor kurzem in Wien fast aus-
schließlich maßgebenden italienischen Geschmack.
Doch soll hier keineswegs der Erbauer des Althan-
schen Palastes zu einem bloßen Nachahmer fran-
zösischer Bauten gestempelt werden. Vielmehr gilt
unsere Bewunderung vor allem dem nerfen Kunst-
werk von ganz eigenartigem, kaum wieder anzu-
treffendem Reiz, das hier vom Künstler wohl unter
Mitwirkung des Bauherrn geschaffen wurde. Platte
wenige Jahrzehnte früher Fischer von Erlach der
Vater in Rom seine gewaltigsten künstlerischen
Eindrücke empfangen, so waren für dessen Sohn
und seine Zeitgenossen nächst Rom die nördlichen
Gesamtzweck. Nicht die lebendige Schönheit der
Pflanzen, nur ihr Materialwert für die Raumgestal-
tung wird geschätzt. Durch die sich kulissengleich
einander vorschiebenden Baumwände erscheint hier
die Raumabgrenzung im Freien bis zur Vollkommen-
heit gesteigert (Fig. 11). Immer neue Blicke zwischen
Baumgruppen und Wänden zeigen Perspektiven von
kühnster Phantasie, bis endlich eine Laube, mehr
einer Triumpfpforte gleich, den Abschluß des Gartens
bildet (Fig. 12). Diese Laube und die vielen, die
Einförmigkeit der Treillagegänge unterbrechenden
Pavillons (Fig. 13) müssen unsere Bewunderung für
die Handwerker erwecken, die es verstanden, in
Lattenwerk, einem vergänglichen Material, die Bau-
gedanken der Künstler zu verwirklichen. Wenn wir
120
I IQ
stellt (Fig\ 8, 9, 10), erweckt er völlig den Eindruck
eines stark unter französischem Einfluß ausgeführten
Gebäudes. Die reich bewegte Dachlinie, die sich nach
der Gartenseite zu über dem Rundbau zu einer
Kuppel steigert, deren Trommel eine Attika von
dem bogenförmigen Giebel über dem Eingang trennt,
die oeil de boeuf in dem Dach nach Mansarts Art,
der wundervolle Rhythmus, in dem Fenster, Mauer-
streifen und Pilaster zueinander stehen, sie alle sind
den Schöpfungen der französischen, klassizistisch
wirkenden Barock verwandt. Die reichen und zier-
Länder, Frankreich und die Niederlande, von maß-
gebender Bedeutung für ihr Schaffen. Anregungen
aus diesen Ländern waren selbstverständlich, so wie
es noch vor kurzem solche aus Italien gewesen, und
zahlreich verbreitet waren auf Ludwig XIV. Wunsch
die Kupfer, die die Pracht der Bauten der franzö-
sischen Meister allüberall verkünden sollten. Die von
verschiedenen Standpunkten aufgenommenen Abbil-
dungen des Althanschen Gartens zeigen alle dem
nördlichen Ideal entsprechend eine absolute Unter-
ordnung aller Einzelwerte unter den dekorativen
Fig. io Der Gartensaal des Althanschen Gartenpalastes. (Kleiner, 5. Folge der Wiener Stadtansichten, Bl. 32)
liehen Details an Dächern, Portalen und Fenstern
entsprechen weit mehr dem nördlichen, französi-
schen, als dem bis vor kurzem in Wien fast aus-
schließlich maßgebenden italienischen Geschmack.
Doch soll hier keineswegs der Erbauer des Althan-
schen Palastes zu einem bloßen Nachahmer fran-
zösischer Bauten gestempelt werden. Vielmehr gilt
unsere Bewunderung vor allem dem nerfen Kunst-
werk von ganz eigenartigem, kaum wieder anzu-
treffendem Reiz, das hier vom Künstler wohl unter
Mitwirkung des Bauherrn geschaffen wurde. Platte
wenige Jahrzehnte früher Fischer von Erlach der
Vater in Rom seine gewaltigsten künstlerischen
Eindrücke empfangen, so waren für dessen Sohn
und seine Zeitgenossen nächst Rom die nördlichen
Gesamtzweck. Nicht die lebendige Schönheit der
Pflanzen, nur ihr Materialwert für die Raumgestal-
tung wird geschätzt. Durch die sich kulissengleich
einander vorschiebenden Baumwände erscheint hier
die Raumabgrenzung im Freien bis zur Vollkommen-
heit gesteigert (Fig. 11). Immer neue Blicke zwischen
Baumgruppen und Wänden zeigen Perspektiven von
kühnster Phantasie, bis endlich eine Laube, mehr
einer Triumpfpforte gleich, den Abschluß des Gartens
bildet (Fig. 12). Diese Laube und die vielen, die
Einförmigkeit der Treillagegänge unterbrechenden
Pavillons (Fig. 13) müssen unsere Bewunderung für
die Handwerker erwecken, die es verstanden, in
Lattenwerk, einem vergänglichen Material, die Bau-
gedanken der Künstler zu verwirklichen. Wenn wir