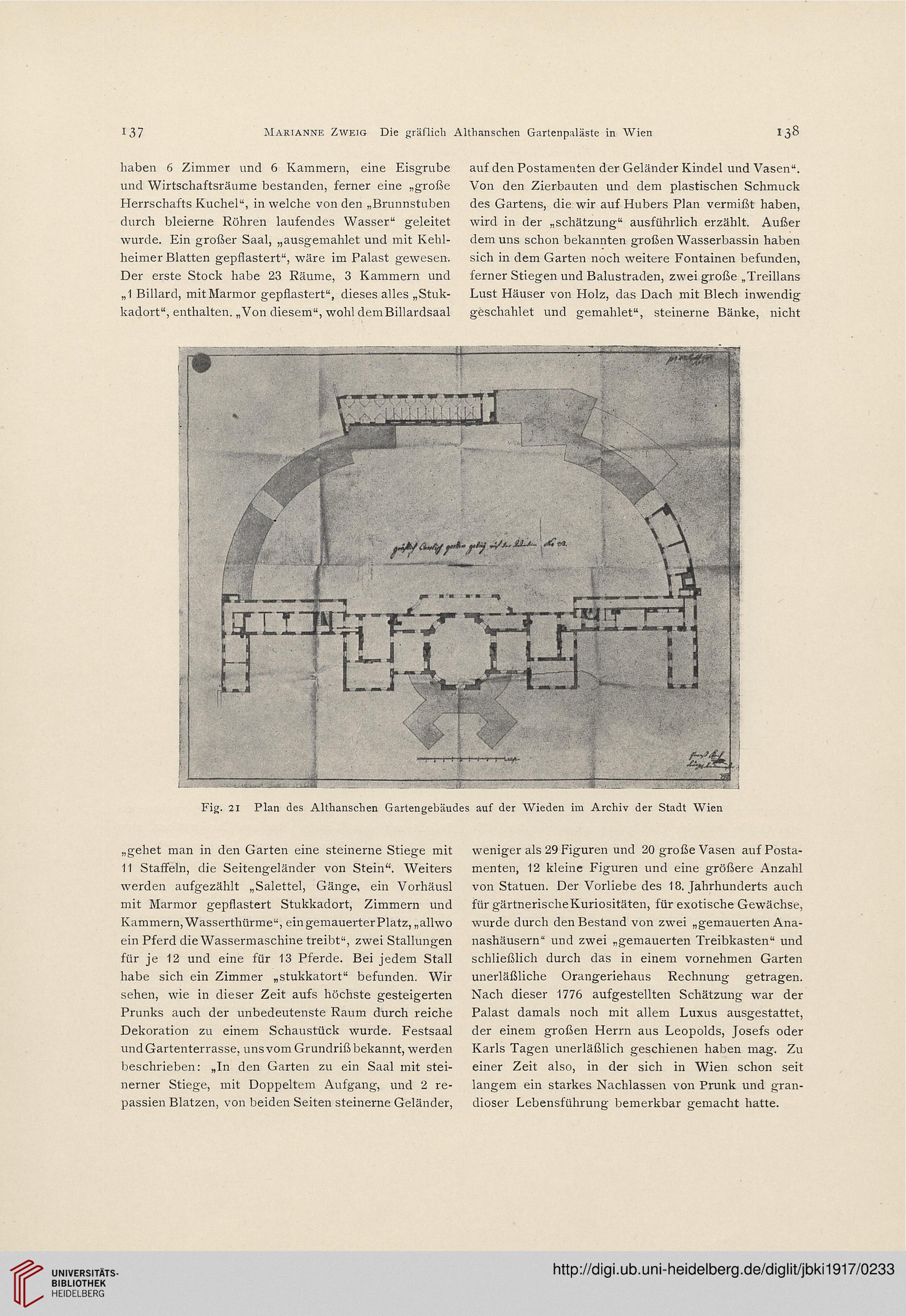i37
Marianne Zweig Die gräflich Althanschen Gartenpaläste in Wien
138
haben 6 Zimmer und 6 Kammern, eine Eisgrube
und Wirtschaftsräume bestanden, ferner eine „große
Herrschafts Küchel“, in welche von den „Brunnstuben
durch bleierne Röhren laufendes Wasser“ geleitet
wurde. Ein großer Saal, „ausgemahlet und mit Kehl-
heimer Blatten gepflastert“, wäre im Palast gewesen.
Der erste Stock habe 23 Räume, 3 Kammern und
„1 Billard, mit Marmor gepflastert“, dieses alles „Stuk-
kadort“, enthalten. „Von diesem“, wohl demBillardsaal
auf den Postamenten der Geländer Kindel und Vasen“.
Von den Zierbauten und dem plastischen Schmuck
des Gartens, die wir auf Hubers Plan vermißt haben,
wird in der „Schätzung“ ausführlich erzählt. Außer
dem uns schon bekannten großen Wasserbassin haben
sich in dem Garten noch weitere Fontainen befunden,
ferner Stiegen und Balustraden, zwei große „Treillans
Lust Häuser von Holz, das Dach mit Blech inwendig
geschahlet und gemalilet“, steinerne Bänke, nicht
Fig. 21 Plan des Althanschen Gartengebäudes auf der Wieden im Archiv der Stadt Wien
„gehet man in den Garten eine steinerne Stiege mit
11 Staffeln, die Seitengeländer von Stein“. Weiters
werden aufgezählt „Salettel, Gänge, ein Vorhäusl
mit Marmor gepflastert Stukkadort, Zimmern und
Kammern, Wasserthürme“, ein gemauerter Platz, „allwo
ein Pferd die Wassermaschine treibt“, zwei Stallungen
für je 12 und eine für 13 Pferde. Bei jedem Stall
habe sich ein Zimmer „stukkatort“ befunden. Wir
sehen, wie in dieser Zeit aufs höchste gesteigerten
Prunks auch der unbedeutenste Raum durch reiche
Dekoration zu einem Schaustück wurde. Festsaal
und Gartenterrasse, uns vom Grundriß bekannt, werden
beschrieben: „In den Garten zu ein Saal mit stei-
nerner Stiege, mit Doppeltem Aufgang, und 2 re-
passien Blatzen, von beiden Seiten steinerne Geländer,
weniger als 29 Figuren und 20 große Vasen auf Posta-
menten, 12 kleine Figuren und eine größere Anzahl
von Statuen. Der Vorliebe des 18. Jahrhunderts auch
für gärtnerische Kuriositäten, für exotische Gewächse,
wurde durch den Bestand von zwei „gemauerten Ana-
nashäusern“ und zwei „gemauerten Treibkasten“ und
schließlich durch das in einem vornehmen Garten
unerläßliche Orangeriehaus Rechnung getragen.
Nach dieser 1776 aufgestellten Schätzung war der
Palast damals noch mit allem Luxus ausgestattet,
der einem großen Herrn aus Leopolds, Josefs oder
Karls Tagen unerläßlich geschienen haben mag. Zu
einer Zeit also, in der sich in Wien schon seit
langem ein starkes Nachlassen von Prunk und gran-
dioser Lebensführung bemerkbar gemacht hatte.
Marianne Zweig Die gräflich Althanschen Gartenpaläste in Wien
138
haben 6 Zimmer und 6 Kammern, eine Eisgrube
und Wirtschaftsräume bestanden, ferner eine „große
Herrschafts Küchel“, in welche von den „Brunnstuben
durch bleierne Röhren laufendes Wasser“ geleitet
wurde. Ein großer Saal, „ausgemahlet und mit Kehl-
heimer Blatten gepflastert“, wäre im Palast gewesen.
Der erste Stock habe 23 Räume, 3 Kammern und
„1 Billard, mit Marmor gepflastert“, dieses alles „Stuk-
kadort“, enthalten. „Von diesem“, wohl demBillardsaal
auf den Postamenten der Geländer Kindel und Vasen“.
Von den Zierbauten und dem plastischen Schmuck
des Gartens, die wir auf Hubers Plan vermißt haben,
wird in der „Schätzung“ ausführlich erzählt. Außer
dem uns schon bekannten großen Wasserbassin haben
sich in dem Garten noch weitere Fontainen befunden,
ferner Stiegen und Balustraden, zwei große „Treillans
Lust Häuser von Holz, das Dach mit Blech inwendig
geschahlet und gemalilet“, steinerne Bänke, nicht
Fig. 21 Plan des Althanschen Gartengebäudes auf der Wieden im Archiv der Stadt Wien
„gehet man in den Garten eine steinerne Stiege mit
11 Staffeln, die Seitengeländer von Stein“. Weiters
werden aufgezählt „Salettel, Gänge, ein Vorhäusl
mit Marmor gepflastert Stukkadort, Zimmern und
Kammern, Wasserthürme“, ein gemauerter Platz, „allwo
ein Pferd die Wassermaschine treibt“, zwei Stallungen
für je 12 und eine für 13 Pferde. Bei jedem Stall
habe sich ein Zimmer „stukkatort“ befunden. Wir
sehen, wie in dieser Zeit aufs höchste gesteigerten
Prunks auch der unbedeutenste Raum durch reiche
Dekoration zu einem Schaustück wurde. Festsaal
und Gartenterrasse, uns vom Grundriß bekannt, werden
beschrieben: „In den Garten zu ein Saal mit stei-
nerner Stiege, mit Doppeltem Aufgang, und 2 re-
passien Blatzen, von beiden Seiten steinerne Geländer,
weniger als 29 Figuren und 20 große Vasen auf Posta-
menten, 12 kleine Figuren und eine größere Anzahl
von Statuen. Der Vorliebe des 18. Jahrhunderts auch
für gärtnerische Kuriositäten, für exotische Gewächse,
wurde durch den Bestand von zwei „gemauerten Ana-
nashäusern“ und zwei „gemauerten Treibkasten“ und
schließlich durch das in einem vornehmen Garten
unerläßliche Orangeriehaus Rechnung getragen.
Nach dieser 1776 aufgestellten Schätzung war der
Palast damals noch mit allem Luxus ausgestattet,
der einem großen Herrn aus Leopolds, Josefs oder
Karls Tagen unerläßlich geschienen haben mag. Zu
einer Zeit also, in der sich in Wien schon seit
langem ein starkes Nachlassen von Prunk und gran-
dioser Lebensführung bemerkbar gemacht hatte.