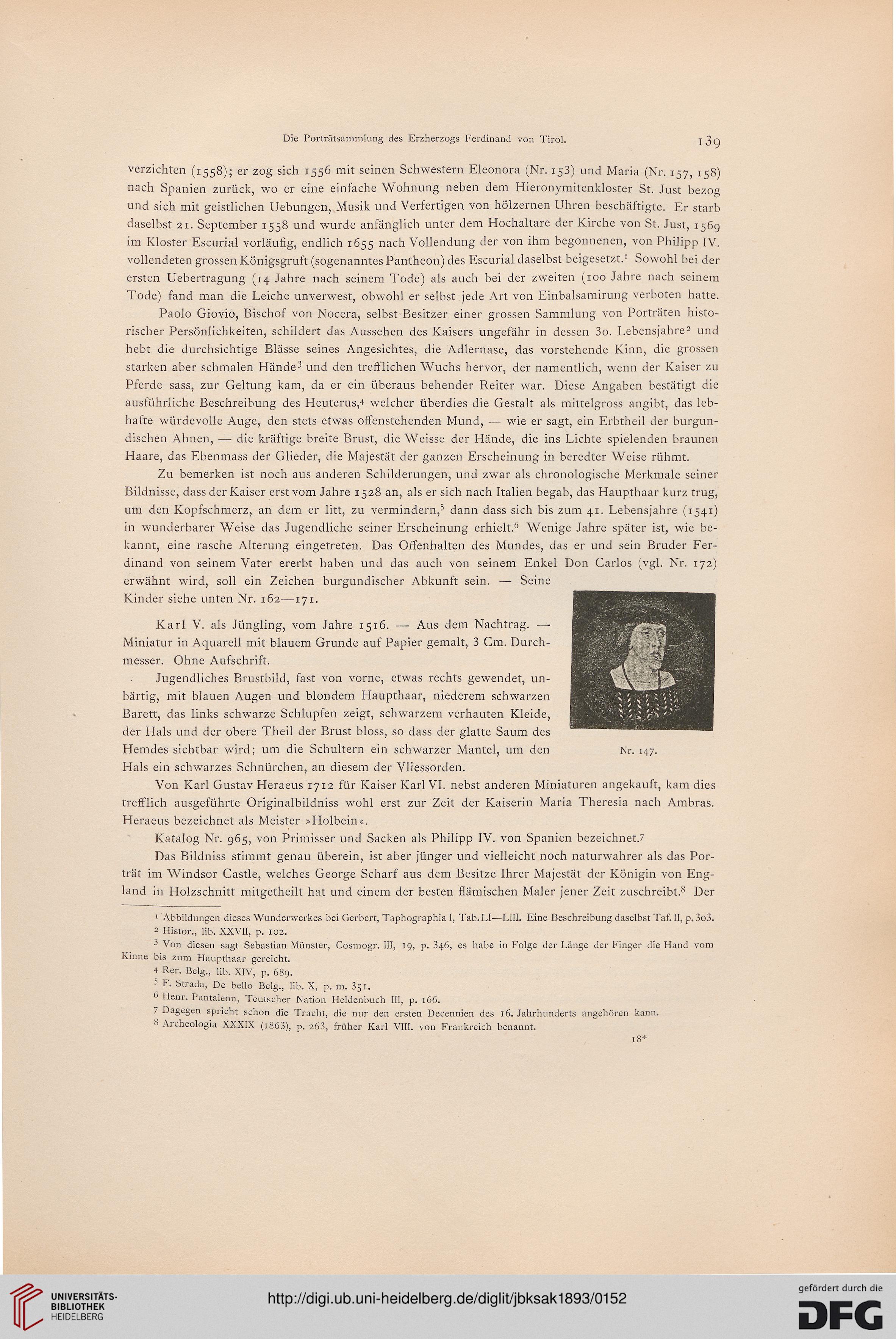Die Porträtsammlung des Erzherzogs Ferdinand von Tirol.
verzichten (1558); er zog sich 1556 mit seinen Schwestern Eleonora (Nr. 153) und Maria (Nr. 157, 158)
nach Spanien zurück, wo er eine einfache Wohnung neben dem Hieronymitenkloster St. Just bezog
und sich mit geistlichen Uebungen, Musik und Verfertigen von hölzernen Uhren beschäftigte. Er starb
daselbst 21. September 1558 und wurde anfänglich unter dem Hochaltare der Kirche von St. Just, 1569
im Kloster Escurial vorläufig, endlich 1655 nach Vollendung der von ihm begonnenen, von Philipp IV.
vollendeten grossen Königsgruft (sogenanntes Pantheon) des Escurial daselbst beigesetzt.' Sowohl bei der
ersten Uebertragung (14 Jahre nach seinem Tode) als auch bei der zweiten (100 Jahre nach seinem
Tode) fand man die Leiche unverwest, obwohl er selbst jede Art von Einbalsamirung verboten hatte.
Paolo Giovio, Bischof von Nocera, selbst Besitzer einer grossen Sammlung von Porträten histo-
rischer Persönlichkeiten, schildert das Aussehen des Kaisers ungefähr in dessen 3o. Lebensjahre2 und
hebt die durchsichtige Blässe seines Angesichtes, die Adlernase, das vorstehende Kinn, die grossen
starken aber schmalen Hände3 und den trefflichen Wuchs hervor, der namentlich, wenn der Kaiser zu
Pferde sass, zur Geltung kam, da er ein überaus behender Reiter war. Diese Angaben bestätigt die
ausführliche Beschreibung des Heuterus,* welcher überdies die Gestalt als mittelgross angibt, das leb-
hafte würdevolle Auge, den stets etwas offenstehenden Mund, — wie er sagt, ein Erbtheil der burgun-
dischen Ahnen, — die kräftige breite Brust, die Weisse der Hände, die ins Lichte spielenden braunen
Haare, das Ebenmass der Glieder, die Majestät der ganzen Erscheinung in beredter Weise rühmt.
Zu bemerken ist noch aus anderen Schilderungen, und zwar als chronologische Merkmale seiner
Bildnisse, dass der Kaiser erst vom Jahre 1528 an, als er sich nach Italien begab, das Haupthaar kurz trug,
um den Kopfschmerz, an dem er litt, zu vermindern,3 dann dass sich bis zum 41. Lebensjahre (1541)
in wunderbarer Weise das Jugendliche seiner Erscheinung erhielt.6 Wenige Jahre später ist, wie be-
kannt, eine rasche Alterung eingetreten. Das Offenhalten des Mundes, das er und sein Bruder Fer-
dinand von seinem Vater ererbt haben und das auch von seinem Enkel Don Carlos (vgl. Nr. 172)
erwähnt wird, soll ein Zeichen burgundischer Abkunft sein. — Seine
Kinder siehe unten Nr. 162—171.
Karl V. als Jüngling, vom Jahre 1516. — Aus dem Nachtrag. —
Miniatur in Aquarell mit blauem Grunde auf Papier gemalt, 3 Cm. Durch-
messer. Ohne Aufschrift.
Jugendliches Brustbild, fast von vorne, etwas rechts gewendet, un-
bärtig, mit blauen Augen und blondem Haupthaar, niederem schwarzen
Barett, das links schwarze Schlupfen zeigt, schwarzem verhauten Kleide,
der Hals und der obere Theil der Brust bloss, so dass der glatte Saum des
Hemdes sichtbar wird; um die Schultern ein schwarzer Mantel, um den Nr. 147.
Hals ein schwarzes Schnürchen, an diesem der Vliessorden.
Von Karl Gustav Heraeus 1712 für Kaiser Karl VI. nebst anderen Miniaturen angekauft, kam dies
trefflich ausgeführte Originalbildniss wohl erst zur Zeit der Kaiserin Maria Theresia nach Ambras.
Heraeus bezeichnet als Meister »Holbein«.
Katalog Nr. 965, von Primisser und Sacken als Philipp IV. von Spanien bezeichnet.7
Das Bildniss stimmt genau überein, ist aber jünger und vielleicht noch naturwahrer als das Por-
trät im Windsor Castle, welches George Scharf aus dem Besitze Ihrer Majestät der Königin von Eng-
land in Holzschnitt mitgetheilt hat und einem der besten flämischen Maler jener Zeit zuschreibt.8 Der
1 Abbildungen dieses Wunderwerkes bei Gerbert, Taphographia I, Tab. LI—I.III. Eine Beschreibung daselbst Taf.II, p. 3o3.
2 Iiistor., lib. XXVII, p. 102.
3 Von diesen sagt Sebastian Münster, Cosmogr. III, 19, p. 346, es habe in Folge der Länge der Finger die Hand vom
Kinne bis zum Haupthaar gereicht.
4 Rer. Belg., Hb. XIV, p. 689.
5 F. Strada, De hello Belg., lib. X, p. m. 351.
<> Henr. Pantaleon, Teutscher Nation Heldenbuch III, p. 166.
7 Dagegen spricht schon die Tracht, die nur den ersten Decennien des 16. Jahrhunderts angehören kann.
8 Archeologia XXXIX (1863), p. 263, früher Karl VIII. von Frankreich benannt.
18*
verzichten (1558); er zog sich 1556 mit seinen Schwestern Eleonora (Nr. 153) und Maria (Nr. 157, 158)
nach Spanien zurück, wo er eine einfache Wohnung neben dem Hieronymitenkloster St. Just bezog
und sich mit geistlichen Uebungen, Musik und Verfertigen von hölzernen Uhren beschäftigte. Er starb
daselbst 21. September 1558 und wurde anfänglich unter dem Hochaltare der Kirche von St. Just, 1569
im Kloster Escurial vorläufig, endlich 1655 nach Vollendung der von ihm begonnenen, von Philipp IV.
vollendeten grossen Königsgruft (sogenanntes Pantheon) des Escurial daselbst beigesetzt.' Sowohl bei der
ersten Uebertragung (14 Jahre nach seinem Tode) als auch bei der zweiten (100 Jahre nach seinem
Tode) fand man die Leiche unverwest, obwohl er selbst jede Art von Einbalsamirung verboten hatte.
Paolo Giovio, Bischof von Nocera, selbst Besitzer einer grossen Sammlung von Porträten histo-
rischer Persönlichkeiten, schildert das Aussehen des Kaisers ungefähr in dessen 3o. Lebensjahre2 und
hebt die durchsichtige Blässe seines Angesichtes, die Adlernase, das vorstehende Kinn, die grossen
starken aber schmalen Hände3 und den trefflichen Wuchs hervor, der namentlich, wenn der Kaiser zu
Pferde sass, zur Geltung kam, da er ein überaus behender Reiter war. Diese Angaben bestätigt die
ausführliche Beschreibung des Heuterus,* welcher überdies die Gestalt als mittelgross angibt, das leb-
hafte würdevolle Auge, den stets etwas offenstehenden Mund, — wie er sagt, ein Erbtheil der burgun-
dischen Ahnen, — die kräftige breite Brust, die Weisse der Hände, die ins Lichte spielenden braunen
Haare, das Ebenmass der Glieder, die Majestät der ganzen Erscheinung in beredter Weise rühmt.
Zu bemerken ist noch aus anderen Schilderungen, und zwar als chronologische Merkmale seiner
Bildnisse, dass der Kaiser erst vom Jahre 1528 an, als er sich nach Italien begab, das Haupthaar kurz trug,
um den Kopfschmerz, an dem er litt, zu vermindern,3 dann dass sich bis zum 41. Lebensjahre (1541)
in wunderbarer Weise das Jugendliche seiner Erscheinung erhielt.6 Wenige Jahre später ist, wie be-
kannt, eine rasche Alterung eingetreten. Das Offenhalten des Mundes, das er und sein Bruder Fer-
dinand von seinem Vater ererbt haben und das auch von seinem Enkel Don Carlos (vgl. Nr. 172)
erwähnt wird, soll ein Zeichen burgundischer Abkunft sein. — Seine
Kinder siehe unten Nr. 162—171.
Karl V. als Jüngling, vom Jahre 1516. — Aus dem Nachtrag. —
Miniatur in Aquarell mit blauem Grunde auf Papier gemalt, 3 Cm. Durch-
messer. Ohne Aufschrift.
Jugendliches Brustbild, fast von vorne, etwas rechts gewendet, un-
bärtig, mit blauen Augen und blondem Haupthaar, niederem schwarzen
Barett, das links schwarze Schlupfen zeigt, schwarzem verhauten Kleide,
der Hals und der obere Theil der Brust bloss, so dass der glatte Saum des
Hemdes sichtbar wird; um die Schultern ein schwarzer Mantel, um den Nr. 147.
Hals ein schwarzes Schnürchen, an diesem der Vliessorden.
Von Karl Gustav Heraeus 1712 für Kaiser Karl VI. nebst anderen Miniaturen angekauft, kam dies
trefflich ausgeführte Originalbildniss wohl erst zur Zeit der Kaiserin Maria Theresia nach Ambras.
Heraeus bezeichnet als Meister »Holbein«.
Katalog Nr. 965, von Primisser und Sacken als Philipp IV. von Spanien bezeichnet.7
Das Bildniss stimmt genau überein, ist aber jünger und vielleicht noch naturwahrer als das Por-
trät im Windsor Castle, welches George Scharf aus dem Besitze Ihrer Majestät der Königin von Eng-
land in Holzschnitt mitgetheilt hat und einem der besten flämischen Maler jener Zeit zuschreibt.8 Der
1 Abbildungen dieses Wunderwerkes bei Gerbert, Taphographia I, Tab. LI—I.III. Eine Beschreibung daselbst Taf.II, p. 3o3.
2 Iiistor., lib. XXVII, p. 102.
3 Von diesen sagt Sebastian Münster, Cosmogr. III, 19, p. 346, es habe in Folge der Länge der Finger die Hand vom
Kinne bis zum Haupthaar gereicht.
4 Rer. Belg., Hb. XIV, p. 689.
5 F. Strada, De hello Belg., lib. X, p. m. 351.
<> Henr. Pantaleon, Teutscher Nation Heldenbuch III, p. 166.
7 Dagegen spricht schon die Tracht, die nur den ersten Decennien des 16. Jahrhunderts angehören kann.
8 Archeologia XXXIX (1863), p. 263, früher Karl VIII. von Frankreich benannt.
18*