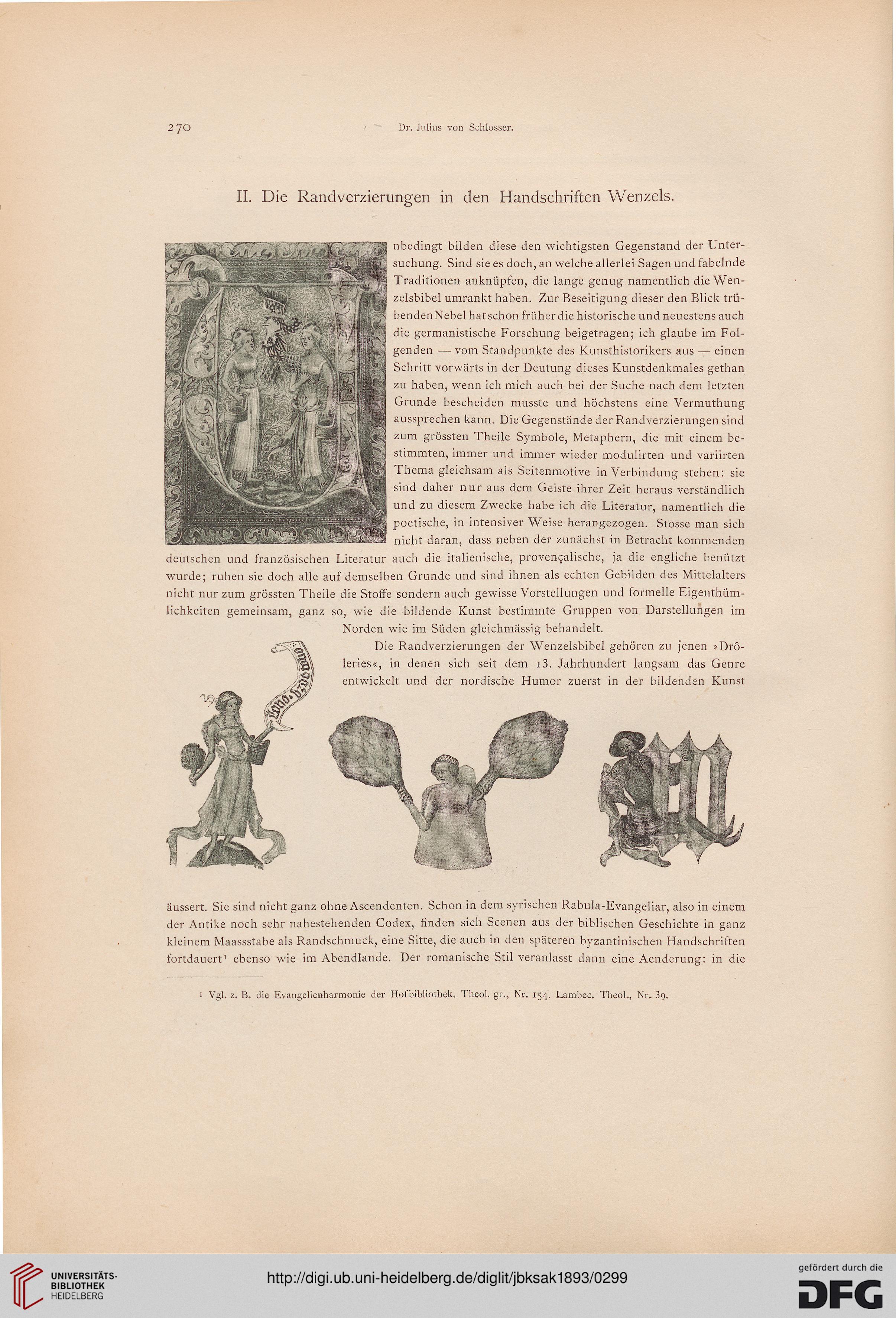270
Dr. Julius von Schlosser.
II. Die Randverzierungen in den Handschriften Wenzels.
nbedingt bilden diese den wichtigsten Gegenstand der Unter-
suchung. Sind sie es doch, an welche allerlei Sagen und fabelnde
Traditionen anknüpfen, die lange genug namentlich die Wen-
zelsbibel umrankt haben. Zur Beseitigung dieser den Blick trü-
bendenNebel hatschon früher die historische und neuestens auch
die germanistische Forschung beigetragen; ich glaube im Fol-
genden — vom Standpunkte des Kunsthistorikers aus — einen
Schritt vorwärts in der Deutung dieses Kunstdenkmales gethan
zu haben, wenn ich mich auch bei der Suche nach dem letzten
Grunde bescheiden musste und höchstens eine Vermuthung
aussprechen kann. Die Gegenstände der Randverzierungen sind
zum grössten Theile Symbole, Metaphern, die mit einem be-
stimmten, immer und immer wieder modulirten und variirten
Thema gleichsam als Seitenmotive in Verbindung stehen: sie
sind daher nur aus dem Geiste ihrer Zeit heraus verständlich
und zu diesem Zwecke habe ich die Literatur, namentlich die
poetische, in intensiver Weise herangezogen. Stosse man sich
nicht daran, dass neben der zunächst in Betracht kommenden
deutschen und französischen Literatur auch die italienische, provencalische, ja die engliche benützt
wurde; ruhen sie doch alle auf demselben Grunde und sind ihnen als echten Gebilden des Mittelalters
nicht nur zum grössten Theile die Stoffe sondern auch gewisse Vorstellungen und formelle Eigenthüm-
lichkeiten gemeinsam, ganz so, wie die bildende Kunst bestimmte Gruppen von Darstellungen im
Norden wie im Süden gleichmässig behandelt.
äussert. Sie sind nicht ganz ohne Ascendenten. Schon in dem syrischen Rabula-Evangeliar, also in einem
der Antike noch sehr nahestehenden Codex, finden sich Scenen aus der biblischen Geschichte in ganz
kleinem Maassstabe als Randschmuck, eine Sitte, die auch in den späteren byzantinischen Handschriften
fortdauert1 ebenso wie im Abendlande. Der romanische Stil veranlasst dann eine Aenderung: in die
1 Vgl. z. B. die Evangclicnharmonie der Hofbibliothek. Theol. gr., Nr. 154. Lambec. Theol., Nr. 3g.
Dr. Julius von Schlosser.
II. Die Randverzierungen in den Handschriften Wenzels.
nbedingt bilden diese den wichtigsten Gegenstand der Unter-
suchung. Sind sie es doch, an welche allerlei Sagen und fabelnde
Traditionen anknüpfen, die lange genug namentlich die Wen-
zelsbibel umrankt haben. Zur Beseitigung dieser den Blick trü-
bendenNebel hatschon früher die historische und neuestens auch
die germanistische Forschung beigetragen; ich glaube im Fol-
genden — vom Standpunkte des Kunsthistorikers aus — einen
Schritt vorwärts in der Deutung dieses Kunstdenkmales gethan
zu haben, wenn ich mich auch bei der Suche nach dem letzten
Grunde bescheiden musste und höchstens eine Vermuthung
aussprechen kann. Die Gegenstände der Randverzierungen sind
zum grössten Theile Symbole, Metaphern, die mit einem be-
stimmten, immer und immer wieder modulirten und variirten
Thema gleichsam als Seitenmotive in Verbindung stehen: sie
sind daher nur aus dem Geiste ihrer Zeit heraus verständlich
und zu diesem Zwecke habe ich die Literatur, namentlich die
poetische, in intensiver Weise herangezogen. Stosse man sich
nicht daran, dass neben der zunächst in Betracht kommenden
deutschen und französischen Literatur auch die italienische, provencalische, ja die engliche benützt
wurde; ruhen sie doch alle auf demselben Grunde und sind ihnen als echten Gebilden des Mittelalters
nicht nur zum grössten Theile die Stoffe sondern auch gewisse Vorstellungen und formelle Eigenthüm-
lichkeiten gemeinsam, ganz so, wie die bildende Kunst bestimmte Gruppen von Darstellungen im
Norden wie im Süden gleichmässig behandelt.
äussert. Sie sind nicht ganz ohne Ascendenten. Schon in dem syrischen Rabula-Evangeliar, also in einem
der Antike noch sehr nahestehenden Codex, finden sich Scenen aus der biblischen Geschichte in ganz
kleinem Maassstabe als Randschmuck, eine Sitte, die auch in den späteren byzantinischen Handschriften
fortdauert1 ebenso wie im Abendlande. Der romanische Stil veranlasst dann eine Aenderung: in die
1 Vgl. z. B. die Evangclicnharmonie der Hofbibliothek. Theol. gr., Nr. 154. Lambec. Theol., Nr. 3g.