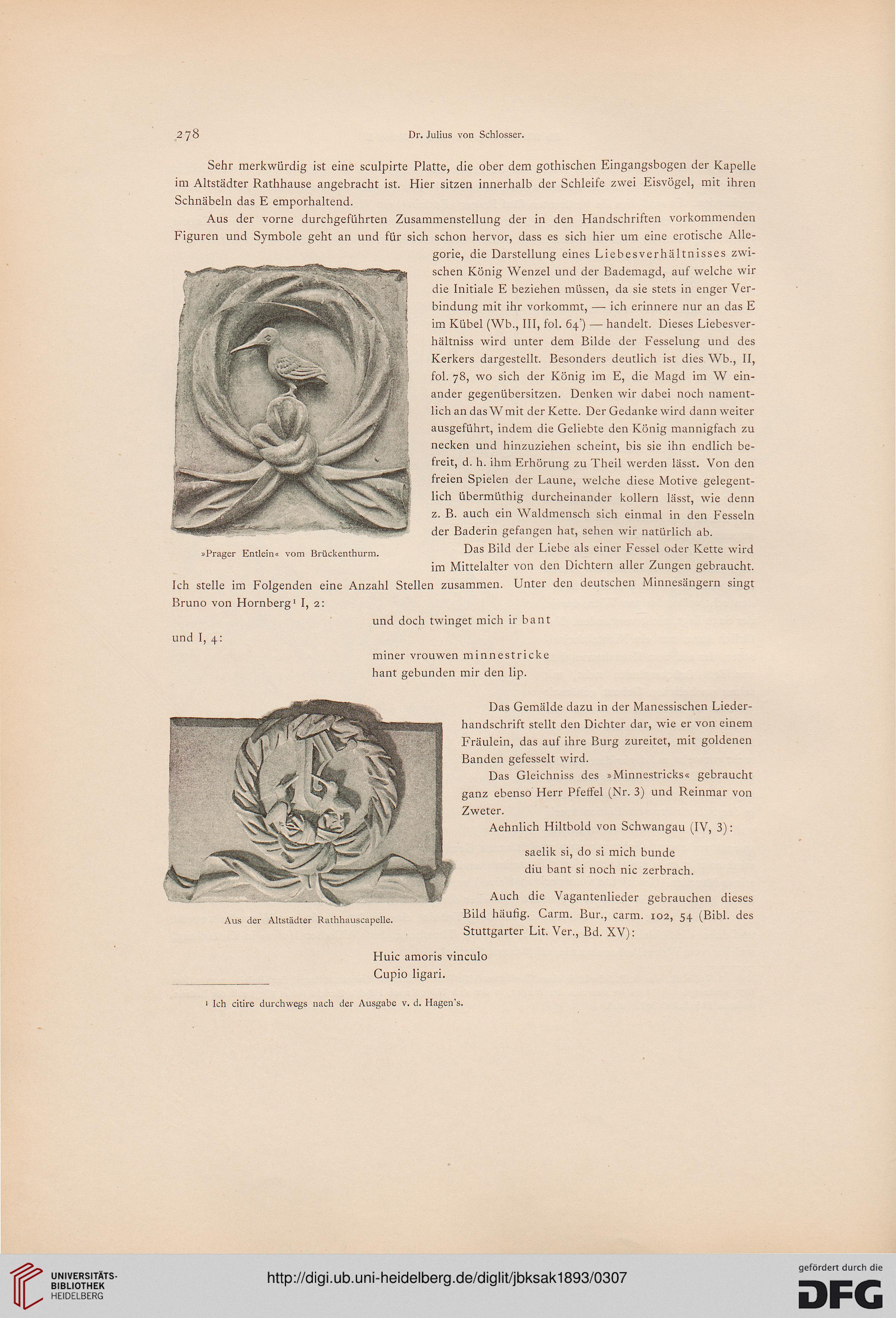278
Dr. Julius von Schlosser.
Sehr merkwürdig ist eine sculpirte Platte, die ober dem gothischen Eingangsbogen der Kapelle
im Altstädter Rathhause angebracht ist. Hier sitzen innerhalb der Schleife zwei Eisvögel, mit ihren
Schnäbeln das E emporhaltend.
Aus der vorne durchgeführten Zusammenstellung der in den Handschriften vorkommenden
Figuren und Symbole geht an und für sich schon hervor, dass es sich hier um eine erotische Alle-
gorie, die Darstellung eines Liebesverhältnisses zwi-
schen König Wenzel und der Bademagd, auf welche wir
die Initiale E beziehen müssen, da sie stets in enger Ver-
bindung mit ihr vorkommt, — ich erinnere nur an das E
im Kübel (Wb., III, fol. 64') — handelt. Dieses Liebesver-
hältniss wird unter dem Bilde der Fesselung und des
Kerkers dargestellt. Besonders deutlich ist dies Wb., II,
Ial^rsSjj: fol. 78, wo sich der König im E, die Magd im W ein-
W.qp*W 0fi ander gegenübersitzen. Denken wir dabei noch nament-
lich an das W mit der Kette. Der Gedanke wird dann weiter
ausgeführt, indem die Geliebte den König mannigfach zu
necken und hinzuziehen scheint, bis sie ihn endlich be-
freit, d. h. ihm Erhörung zu Theil werden lässt. Von den
freien Spielen der Laune, welche diese Motive gelegent-
lich übermüthig durcheinander kollern lässt, wie denn
z. B. auch ein Waldmensch sich einmal in den Fesseln
der Baderin gefangen hat, sehen wir natürlich ab.
Das Bild der Liebe als einer Fessel oder Kette wird
im Mittelalter von den Dichtern aller Zungen gebraucht.
Ich stelle im Folgenden eine Anzahl Stellen zusammen. Unter den deutschen Minnesängern singt
Bruno von Hornberg1 I, 2:
und doch twinget mich ir bant
und I, 4:
miner vrouwen minnestricke
hant gebunden mir den lip.
»Prager Entlein« vom Brückenthurm.
Aus der Altstädter Rathhauscapelle.
Das Gemälde dazu in der Manessischen Lieder-
handschrift stellt den Dichter dar, wie er von einem
Fräulein, das auf ihre Burg zureitet, mit goldenen
Banden gefesselt wird.
Das Gleichniss des »Minnestricks« gebraucht
ganz ebenso Herr Pfeffel (Nr. 3) und Reinmar von
Zweter.
Aehnlich Hiltbold von Schwangau (IV, 3):
saelik si, do si mich bunde
diu bant si noch nie zerbrach.
Auch die Vagantenlieder gebrauchen dieses
Bild häufig. Carm. Bur., carm. 102, 54 (Bibl. des
Stuttgarter Lit. Ver., Bd. XV):
Huic amoris vineulo
Cupio ligari.
1 Ich citire durchwegs nach der Ausgabe v. d. Hagen's.
Dr. Julius von Schlosser.
Sehr merkwürdig ist eine sculpirte Platte, die ober dem gothischen Eingangsbogen der Kapelle
im Altstädter Rathhause angebracht ist. Hier sitzen innerhalb der Schleife zwei Eisvögel, mit ihren
Schnäbeln das E emporhaltend.
Aus der vorne durchgeführten Zusammenstellung der in den Handschriften vorkommenden
Figuren und Symbole geht an und für sich schon hervor, dass es sich hier um eine erotische Alle-
gorie, die Darstellung eines Liebesverhältnisses zwi-
schen König Wenzel und der Bademagd, auf welche wir
die Initiale E beziehen müssen, da sie stets in enger Ver-
bindung mit ihr vorkommt, — ich erinnere nur an das E
im Kübel (Wb., III, fol. 64') — handelt. Dieses Liebesver-
hältniss wird unter dem Bilde der Fesselung und des
Kerkers dargestellt. Besonders deutlich ist dies Wb., II,
Ial^rsSjj: fol. 78, wo sich der König im E, die Magd im W ein-
W.qp*W 0fi ander gegenübersitzen. Denken wir dabei noch nament-
lich an das W mit der Kette. Der Gedanke wird dann weiter
ausgeführt, indem die Geliebte den König mannigfach zu
necken und hinzuziehen scheint, bis sie ihn endlich be-
freit, d. h. ihm Erhörung zu Theil werden lässt. Von den
freien Spielen der Laune, welche diese Motive gelegent-
lich übermüthig durcheinander kollern lässt, wie denn
z. B. auch ein Waldmensch sich einmal in den Fesseln
der Baderin gefangen hat, sehen wir natürlich ab.
Das Bild der Liebe als einer Fessel oder Kette wird
im Mittelalter von den Dichtern aller Zungen gebraucht.
Ich stelle im Folgenden eine Anzahl Stellen zusammen. Unter den deutschen Minnesängern singt
Bruno von Hornberg1 I, 2:
und doch twinget mich ir bant
und I, 4:
miner vrouwen minnestricke
hant gebunden mir den lip.
»Prager Entlein« vom Brückenthurm.
Aus der Altstädter Rathhauscapelle.
Das Gemälde dazu in der Manessischen Lieder-
handschrift stellt den Dichter dar, wie er von einem
Fräulein, das auf ihre Burg zureitet, mit goldenen
Banden gefesselt wird.
Das Gleichniss des »Minnestricks« gebraucht
ganz ebenso Herr Pfeffel (Nr. 3) und Reinmar von
Zweter.
Aehnlich Hiltbold von Schwangau (IV, 3):
saelik si, do si mich bunde
diu bant si noch nie zerbrach.
Auch die Vagantenlieder gebrauchen dieses
Bild häufig. Carm. Bur., carm. 102, 54 (Bibl. des
Stuttgarter Lit. Ver., Bd. XV):
Huic amoris vineulo
Cupio ligari.
1 Ich citire durchwegs nach der Ausgabe v. d. Hagen's.