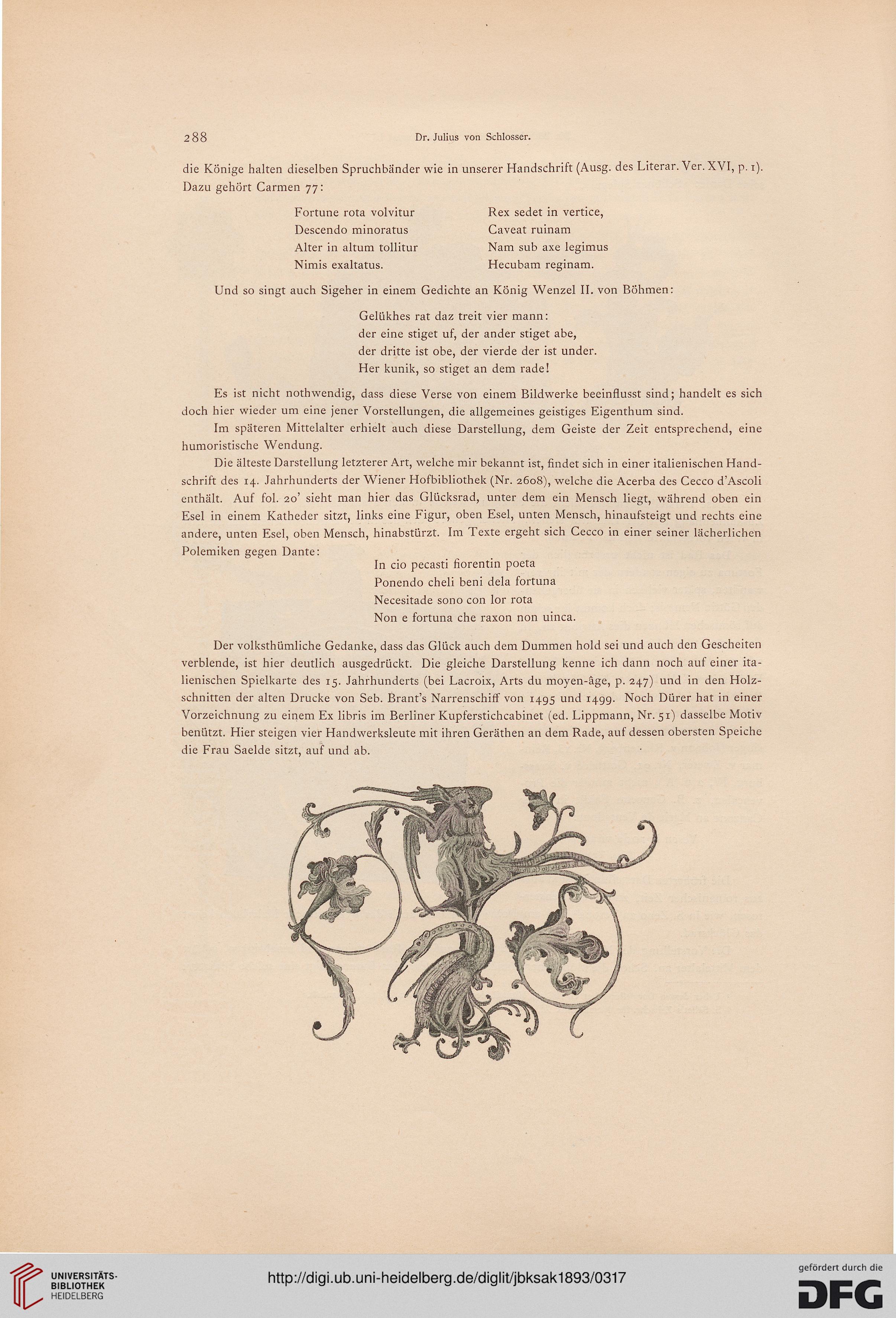288
Dr. Julius von Schlosser.
die Könige halten dieselben Spruchbänder wie in unserer Handschrift (Ausg. des Literar. Ver. XVI, p. i).
Dazu gehört Carmen 77:
Fortune rota volvitur Rex sedet in vertice,
Descendo minoratus Caveat ruinam
Alter in altum tollitur Nam sub axe legimus
Nimis exaltatus. Hecubam reginam.
Und so singt auch Sigeher in einem Gedichte an König Wenzel II. von Böhmen:
Gelükhes rat daz treit vier mann:
der eine stiget uf, der ander stiget abe,
der dritte ist obe, der vierde der ist under.
Her kunik, so stiget an dem rade!
Es ist nicht nothwendig, dass diese Verse von einem Bildwerke beeinflusst sind; handelt es sich
doch hier wieder um eine jener Vorstellungen, die allgemeines geistiges Eigenthum sind.
Im späteren Mittelalter erhielt auch diese Darstellung, dem Geiste der Zeit entsprechend, eine
humoristische Wendung.
Die älteste Darstellung letzterer Art, welche mir bekannt ist, findet sich in einer italienischen Hand-
schrift des 14. Jahrhunderts der Wiener Hofbibliothek (Nr. 2608), welche die Acerba des Cecco d'Ascoli
enthält. Auf fol. 20' sieht man hier das Glücksrad, unter dem ein Mensch liegt, während oben ein
Esel in einem Katheder sitzt, links eine Figur, oben Esel, unten Mensch, hinaufsteigt und rechts eine
andere, unten Esel, oben Mensch, hinabstürzt. Im Texte ergeht sich Cecco in einer seiner lächerlichen
Polemiken gegen Dante:
In cio pecasti fiorentin poeta
Ponendo cheli beni dela fortuna
Necesitade sono con lor rota
Non e fortuna che raxon non uinca.
Der volksthümliche Gedanke, dass das Glück auch dem Dummen hold sei und auch den Gescheiten
verblende, ist hier deutlich ausgedrückt. Die gleiche Darstellung kenne ich dann noch auf einer ita-
lienischen Spielkarte des 15. Jahrhunderts (bei Lacroix, Arts du moyen-äge, p. 247) und in den Holz-
schnitten der alten Drucke von Seb. Brant's Narrenschiff von 1495 und 1499. Noch Dürer hat in einer
Vorzeichnung zu einem Ex libris im Berliner Kupferstichcabinet (ed. Lippmann, Nr. 51) dasselbe Motiv
benützt. Hier steigen vier Handwerksleute mit ihren Geräthen an dem Rade, auf dessen obersten Speiche
die Frau Saelde sitzt, auf und ab.
Dr. Julius von Schlosser.
die Könige halten dieselben Spruchbänder wie in unserer Handschrift (Ausg. des Literar. Ver. XVI, p. i).
Dazu gehört Carmen 77:
Fortune rota volvitur Rex sedet in vertice,
Descendo minoratus Caveat ruinam
Alter in altum tollitur Nam sub axe legimus
Nimis exaltatus. Hecubam reginam.
Und so singt auch Sigeher in einem Gedichte an König Wenzel II. von Böhmen:
Gelükhes rat daz treit vier mann:
der eine stiget uf, der ander stiget abe,
der dritte ist obe, der vierde der ist under.
Her kunik, so stiget an dem rade!
Es ist nicht nothwendig, dass diese Verse von einem Bildwerke beeinflusst sind; handelt es sich
doch hier wieder um eine jener Vorstellungen, die allgemeines geistiges Eigenthum sind.
Im späteren Mittelalter erhielt auch diese Darstellung, dem Geiste der Zeit entsprechend, eine
humoristische Wendung.
Die älteste Darstellung letzterer Art, welche mir bekannt ist, findet sich in einer italienischen Hand-
schrift des 14. Jahrhunderts der Wiener Hofbibliothek (Nr. 2608), welche die Acerba des Cecco d'Ascoli
enthält. Auf fol. 20' sieht man hier das Glücksrad, unter dem ein Mensch liegt, während oben ein
Esel in einem Katheder sitzt, links eine Figur, oben Esel, unten Mensch, hinaufsteigt und rechts eine
andere, unten Esel, oben Mensch, hinabstürzt. Im Texte ergeht sich Cecco in einer seiner lächerlichen
Polemiken gegen Dante:
In cio pecasti fiorentin poeta
Ponendo cheli beni dela fortuna
Necesitade sono con lor rota
Non e fortuna che raxon non uinca.
Der volksthümliche Gedanke, dass das Glück auch dem Dummen hold sei und auch den Gescheiten
verblende, ist hier deutlich ausgedrückt. Die gleiche Darstellung kenne ich dann noch auf einer ita-
lienischen Spielkarte des 15. Jahrhunderts (bei Lacroix, Arts du moyen-äge, p. 247) und in den Holz-
schnitten der alten Drucke von Seb. Brant's Narrenschiff von 1495 und 1499. Noch Dürer hat in einer
Vorzeichnung zu einem Ex libris im Berliner Kupferstichcabinet (ed. Lippmann, Nr. 51) dasselbe Motiv
benützt. Hier steigen vier Handwerksleute mit ihren Geräthen an dem Rade, auf dessen obersten Speiche
die Frau Saelde sitzt, auf und ab.