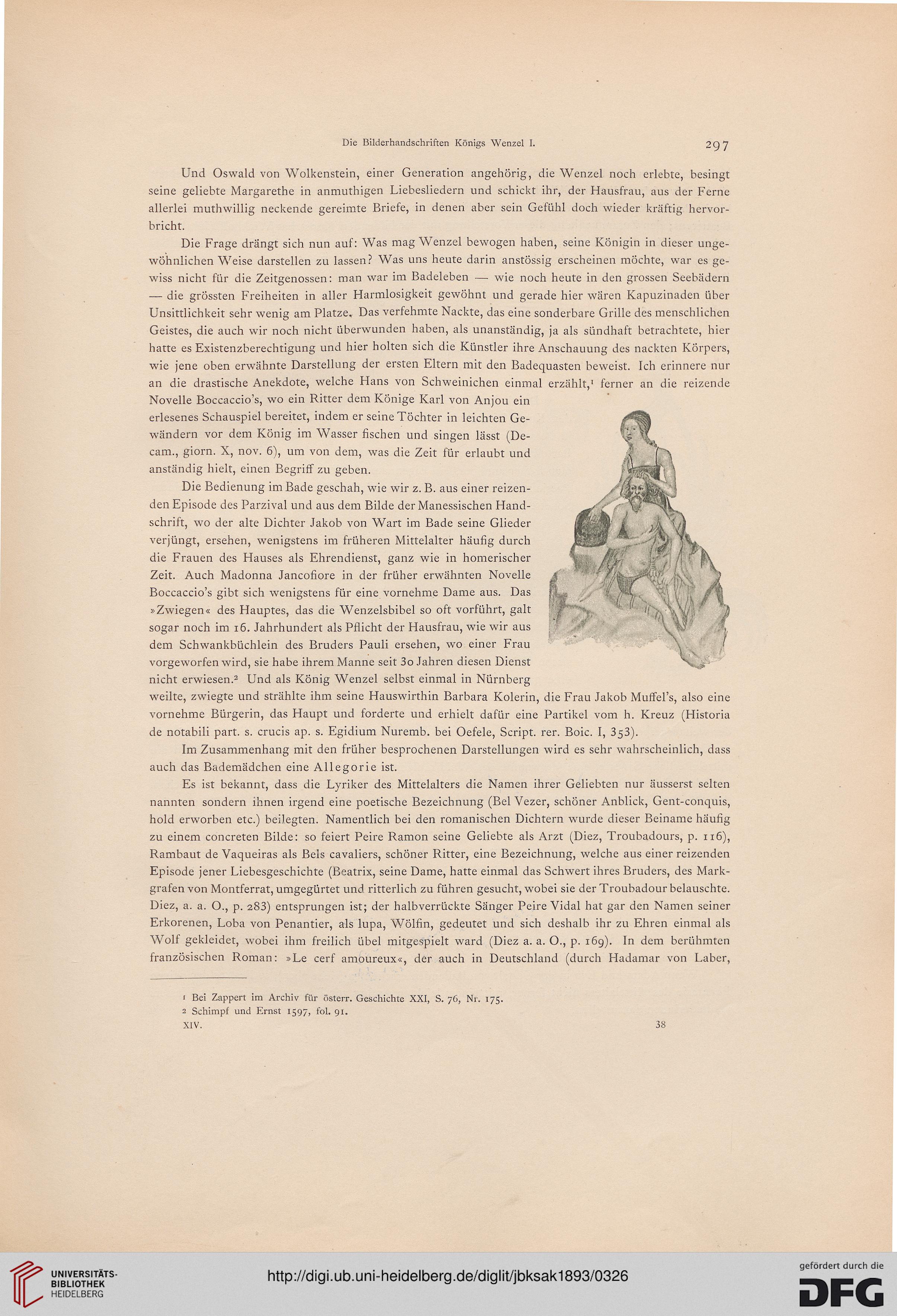Die Bilderhandschriften Königs Wenzel I.
297
Und Oswald von Wolkenstein, einer Generation angehörig, die Wenzel noch erlebte, besingt
seine geliebte Margarethe in anmuthigen Liebesliedern und schickt ihr, der Hausfrau, aus der Ferne
allerlei muthwillig neckende gereimte Briefe, in denen aber sein Gefühl doch wieder kräftig hervor-
bricht.
Die Frage drängt sich nun auf: Was mag Wenzel bewogen haben, seine Königin in dieser unge-
wöhnlichen Weise darstellen zu lassen? Was uns heute darin anstössig erscheinen möchte, war es ge-
wiss nicht für die Zeitgenossen: man war im Badeleben — wie noch heute in den grossen Seebädern
— die grössten Freiheiten in aller Harmlosigkeit gewöhnt und gerade hier wären Kapuzinaden über
Unsittlichkeit sehr wenig am Platze. Das verfehmte Nackte, das eine sonderbare Grille des menschlichen
Geistes, die auch wir noch nicht überwunden haben, als unanständig, ja als sündhaft betrachtete, hier
hatte es Existenzberechtigung und hier holten sich die Künstler ihre Anschauung des nackten Körpers,
wie jene oben erwähnte Darstellung der ersten Eltern mit den Badequasten beweist. Ich erinnere nur
an die drastische Anekdote, welche Hans von Schweinichen einmal erzählt,' ferner an die reizende
Novelle Boccaccio's, wo ein Ritter dem Könige Karl von Anjou ein
erlesenes Schauspiel bereitet, indem er seine Töchter in leichten Ge-
wändern vor dem König im Wasser fischen und singen lässt (De-
cam., giorn. X, nov. 6), um von dem, was die Zeit für erlaubt und
anständig hielt, einen Begriff zu geben.
Die Bedienung im Bade geschah, wie wir z. B. aus einer reizen-
den Episode des Parzival und aus dem Bilde der Manessischen Hand-
schrift, wo der alte Dichter Jakob von Wart im Bade seine Glieder
verjüngt, ersehen, wenigstens im früheren Mittelalter häufig durch
die Frauen des Hauses als Ehrendienst, ganz wie in homerischer \ h |K
Zeit. Auch Madonna Jancofiore in der früher erwähnten Novelle
Boccaccio's gibt sich wenigstens für eine vornehme Dame aus. Das
»Zwiegen« des Hauptes, das die Wenzelsbibel so oft vorführt, galt
sogar noch im 16. Jahrhundert als Pflicht der Hausfrau, wie wir aus
dem Schwankbüchlein des Bruders Pauli ersehen, wo einer Frau
vorgeworfen wird, sie habe ihrem Manne seit 3o Jahren diesen Dienst
nicht erwiesen.2 Und als König Wenzel selbst einmal in Nürnberg
weilte, zwiegte und strählte ihm seine Hauswirthin Barbara Kolerin, die Frau Jakob Muffel's, also eine
vornehme Bürgerin, das Haupt und forderte und erhielt dafür eine Partikel vom h. Kreuz (Historia
de notabili part. s. crucis ap. s. Egidium Nuremb. bei Oefele, Script, rer. Boic. I, 353).
Im Zusammenhang mit den früher besprochenen Darstellungen wird es sehr wahrscheinlich, dass
auch das Bademädchen eine Allegorie ist.
Es ist bekannt, dass die Lyriker des Mittelalters die Namen ihrer Geliebten nur äusserst selten
nannten sondern ihnen irgend eine poetische Bezeichnung (Bei Vezer, schöner Anblick, Gent-conquis,
hold erworben etc.) beilegten. Namentlich bei den romanischen Dichtern wurde dieser Beiname häufig
zu einem concreten Bilde: so feiert Peire Ramon seine Geliebte als Arzt (Diez, Troubadours, p. 116),
Rambaut de Vaqueiras als Bels cavaliers, schöner Ritter, eine Bezeichnung, welche aus einer reizenden
Episode jener Liebesgeschichte (Beatrix, seine Dame, hatte einmal das Schwert ihres Bruders, des Mark-
grafen von Montferrat, umgegürtet und ritterlich zu führen gesucht, wobei sie der Troubadour belauschte.
Diez, a. a. O., p. 283) entsprungen ist; der halbverrückte Sänger Peire Vidal hat gar den Namen seiner
Erkorenen, Loba von Penantier, als lupa, Wölfin, gedeutet und sich deshalb ihr zu Ehren einmal als
Wolf gekleidet, wobei ihm freilich übel mitgespielt ward (Diez a. a. O., p. 169). In dem berühmten
französischen Roman: »Le cerf amoureux«, der auch in Deutschland (durch Hadamar von Laber,
1
1 Bei Zappert im Archiv für österr. Geschichte XXI, S. 76, Nr. 175.
2 Schimpf und Ernst 1597, fol. 91.
XIV.
38
297
Und Oswald von Wolkenstein, einer Generation angehörig, die Wenzel noch erlebte, besingt
seine geliebte Margarethe in anmuthigen Liebesliedern und schickt ihr, der Hausfrau, aus der Ferne
allerlei muthwillig neckende gereimte Briefe, in denen aber sein Gefühl doch wieder kräftig hervor-
bricht.
Die Frage drängt sich nun auf: Was mag Wenzel bewogen haben, seine Königin in dieser unge-
wöhnlichen Weise darstellen zu lassen? Was uns heute darin anstössig erscheinen möchte, war es ge-
wiss nicht für die Zeitgenossen: man war im Badeleben — wie noch heute in den grossen Seebädern
— die grössten Freiheiten in aller Harmlosigkeit gewöhnt und gerade hier wären Kapuzinaden über
Unsittlichkeit sehr wenig am Platze. Das verfehmte Nackte, das eine sonderbare Grille des menschlichen
Geistes, die auch wir noch nicht überwunden haben, als unanständig, ja als sündhaft betrachtete, hier
hatte es Existenzberechtigung und hier holten sich die Künstler ihre Anschauung des nackten Körpers,
wie jene oben erwähnte Darstellung der ersten Eltern mit den Badequasten beweist. Ich erinnere nur
an die drastische Anekdote, welche Hans von Schweinichen einmal erzählt,' ferner an die reizende
Novelle Boccaccio's, wo ein Ritter dem Könige Karl von Anjou ein
erlesenes Schauspiel bereitet, indem er seine Töchter in leichten Ge-
wändern vor dem König im Wasser fischen und singen lässt (De-
cam., giorn. X, nov. 6), um von dem, was die Zeit für erlaubt und
anständig hielt, einen Begriff zu geben.
Die Bedienung im Bade geschah, wie wir z. B. aus einer reizen-
den Episode des Parzival und aus dem Bilde der Manessischen Hand-
schrift, wo der alte Dichter Jakob von Wart im Bade seine Glieder
verjüngt, ersehen, wenigstens im früheren Mittelalter häufig durch
die Frauen des Hauses als Ehrendienst, ganz wie in homerischer \ h |K
Zeit. Auch Madonna Jancofiore in der früher erwähnten Novelle
Boccaccio's gibt sich wenigstens für eine vornehme Dame aus. Das
»Zwiegen« des Hauptes, das die Wenzelsbibel so oft vorführt, galt
sogar noch im 16. Jahrhundert als Pflicht der Hausfrau, wie wir aus
dem Schwankbüchlein des Bruders Pauli ersehen, wo einer Frau
vorgeworfen wird, sie habe ihrem Manne seit 3o Jahren diesen Dienst
nicht erwiesen.2 Und als König Wenzel selbst einmal in Nürnberg
weilte, zwiegte und strählte ihm seine Hauswirthin Barbara Kolerin, die Frau Jakob Muffel's, also eine
vornehme Bürgerin, das Haupt und forderte und erhielt dafür eine Partikel vom h. Kreuz (Historia
de notabili part. s. crucis ap. s. Egidium Nuremb. bei Oefele, Script, rer. Boic. I, 353).
Im Zusammenhang mit den früher besprochenen Darstellungen wird es sehr wahrscheinlich, dass
auch das Bademädchen eine Allegorie ist.
Es ist bekannt, dass die Lyriker des Mittelalters die Namen ihrer Geliebten nur äusserst selten
nannten sondern ihnen irgend eine poetische Bezeichnung (Bei Vezer, schöner Anblick, Gent-conquis,
hold erworben etc.) beilegten. Namentlich bei den romanischen Dichtern wurde dieser Beiname häufig
zu einem concreten Bilde: so feiert Peire Ramon seine Geliebte als Arzt (Diez, Troubadours, p. 116),
Rambaut de Vaqueiras als Bels cavaliers, schöner Ritter, eine Bezeichnung, welche aus einer reizenden
Episode jener Liebesgeschichte (Beatrix, seine Dame, hatte einmal das Schwert ihres Bruders, des Mark-
grafen von Montferrat, umgegürtet und ritterlich zu führen gesucht, wobei sie der Troubadour belauschte.
Diez, a. a. O., p. 283) entsprungen ist; der halbverrückte Sänger Peire Vidal hat gar den Namen seiner
Erkorenen, Loba von Penantier, als lupa, Wölfin, gedeutet und sich deshalb ihr zu Ehren einmal als
Wolf gekleidet, wobei ihm freilich übel mitgespielt ward (Diez a. a. O., p. 169). In dem berühmten
französischen Roman: »Le cerf amoureux«, der auch in Deutschland (durch Hadamar von Laber,
1
1 Bei Zappert im Archiv für österr. Geschichte XXI, S. 76, Nr. 175.
2 Schimpf und Ernst 1597, fol. 91.
XIV.
38