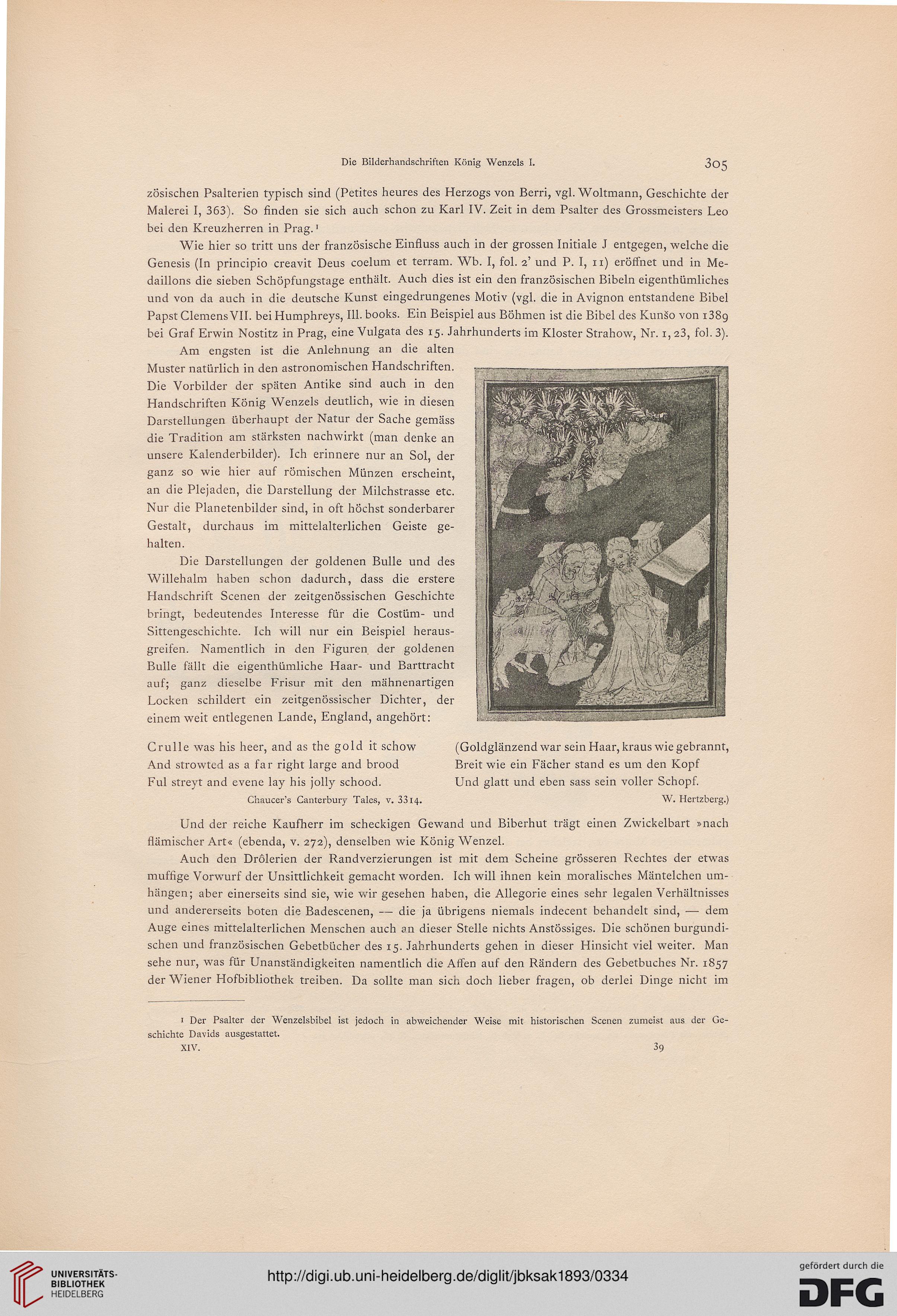Die Bilderhandschriften König Wenzels I.
305
zösischen Psalterien typisch sind (Petites heures des Herzogs von Berri, vgl. Woltmann, Geschichte der
Malerei I, 363). So finden sie sich auch schon zu Karl IV. Zeit in dem Psalter des Grossmeisters Leo
bei den Kreuzherren in Prag.1
Wie hier so tritt uns der französische Einfluss auch in der grossen Initiale J entgegen, welche die
Genesis (In principio creavit Deus coelum et terram. Wb. I, fol. 2' und P. I, 11) eröffnet und in Me-
daillons die sieben Schöpfungstage enthält. Auch dies ist ein den französischen Bibeln eigenthümliches
und von da auch in die deutsche Kunst eingedrungenes Motiv (vgl. die in Avignon entstandene Bibel
Papst Clemens VII. bei Humphreys, III. books. Ein Beispiel aus Böhmen ist die Bibel des Kunso von i38g
bei Graf Erwin Nostitz in Prag, eine Vulgata des 15. Jahrhunderts im Kloster Strahow, Nr. 1, 23, fol. 3).
Am engsten ist die Anlehnung an die alten
Muster natürlich in den astronomischen Handschriften.
Die Vorbilder der späten Antike sind auch in den
Handschriften König Wenzels deutlich, wie in diesen
Darstellungen überhaupt der Natur der Sache gemäss
die Tradition am stärksten nachwirkt (man denke an
unsere Kalenderbilder). Ich erinnere nur an Sol, der
ganz so wie hier auf römischen Münzen erscheint,
an die Plejaden, die Darstellung der Milchstrasse etc.
Nur die Planetenbilder sind, in oft höchst sonderbarer
Gestalt, durchaus im mittelalterlichen Geiste ge-
halten.
Die Darstellungen der goldenen Bulle und des
Willehalm haben schon dadurch, dass die erstere
Handschrift Scenen der zeitgenössischen Geschichte
bringt, bedeutendes Interesse für die Costüm- und
Sittengeschichte. Ich will nur ein Beispiel heraus-
greifen. Namentlich in den Figuren der goldenen
Bulle fällt die eigenthümliche Haar- und Barttracht
auf; ganz dieselbe Frisur mit den mähnenartigen
Locken schildert ein zeitgenössischer Dichter, der
einem weit entlegenen Lande, England, angehört:
Crulle was his heer, and as the gold it schow
And strowted as a far right large and brood
Ful streyt and evene lay his jolly schood.
Chaucer's Canterbury Tales, v. 3314.
(Goldglänzend war sein Haar, kraus wie gebrannt,
Breit wie ein Fächer stand es um den Kopf
Und glatt und eben sass sein voller Schopf.
W. Hertzberg.)
Und der reiche Kaufherr im scheckigen Gewand und Biberhut trägt einen Zwickelbart »nach
flämischer Art« (ebenda, v. 272), denselben wie König Wenzel.
Auch den Drolerien der Randverzierungen ist mit dem Scheine grösseren Rechtes der etwas
muffige Vorwurf der Unsittlichkeit gemacht worden. Ich will ihnen kein moralisches Mäntelchen um-
hängen; aber einerseits sind sie, wie wir gesehen haben, die Allegorie eines sehr legalen Verhältnisses
und andererseits boten die Badescenen, — die ja übrigens niemals indecent behandelt sind, ■— dem
Auge eines mittelalterlichen Menschen auch an dieser Stelle nichts Anstössiges. Die schönen burgundi-
schen und französischen Gebetbücher des 15. Jahrhunderts gehen in dieser Hinsicht viel weiter. Man
sehe nur, was für Unanständigkeiten namentlich die Affen auf den Rändern des Gebetbuches Nr. 1857
der Wiener Hofbibliothek treiben. Da sollte man sich doch lieber fragen, ob derlei Dinge nicht im
1 Der Psalter der Wenzelsbibel ist jedoch in abweichender Weise mit historischen Scenen zumeist aus der Ge-
schichte Davids ausgestattet.
XIV. 39
305
zösischen Psalterien typisch sind (Petites heures des Herzogs von Berri, vgl. Woltmann, Geschichte der
Malerei I, 363). So finden sie sich auch schon zu Karl IV. Zeit in dem Psalter des Grossmeisters Leo
bei den Kreuzherren in Prag.1
Wie hier so tritt uns der französische Einfluss auch in der grossen Initiale J entgegen, welche die
Genesis (In principio creavit Deus coelum et terram. Wb. I, fol. 2' und P. I, 11) eröffnet und in Me-
daillons die sieben Schöpfungstage enthält. Auch dies ist ein den französischen Bibeln eigenthümliches
und von da auch in die deutsche Kunst eingedrungenes Motiv (vgl. die in Avignon entstandene Bibel
Papst Clemens VII. bei Humphreys, III. books. Ein Beispiel aus Böhmen ist die Bibel des Kunso von i38g
bei Graf Erwin Nostitz in Prag, eine Vulgata des 15. Jahrhunderts im Kloster Strahow, Nr. 1, 23, fol. 3).
Am engsten ist die Anlehnung an die alten
Muster natürlich in den astronomischen Handschriften.
Die Vorbilder der späten Antike sind auch in den
Handschriften König Wenzels deutlich, wie in diesen
Darstellungen überhaupt der Natur der Sache gemäss
die Tradition am stärksten nachwirkt (man denke an
unsere Kalenderbilder). Ich erinnere nur an Sol, der
ganz so wie hier auf römischen Münzen erscheint,
an die Plejaden, die Darstellung der Milchstrasse etc.
Nur die Planetenbilder sind, in oft höchst sonderbarer
Gestalt, durchaus im mittelalterlichen Geiste ge-
halten.
Die Darstellungen der goldenen Bulle und des
Willehalm haben schon dadurch, dass die erstere
Handschrift Scenen der zeitgenössischen Geschichte
bringt, bedeutendes Interesse für die Costüm- und
Sittengeschichte. Ich will nur ein Beispiel heraus-
greifen. Namentlich in den Figuren der goldenen
Bulle fällt die eigenthümliche Haar- und Barttracht
auf; ganz dieselbe Frisur mit den mähnenartigen
Locken schildert ein zeitgenössischer Dichter, der
einem weit entlegenen Lande, England, angehört:
Crulle was his heer, and as the gold it schow
And strowted as a far right large and brood
Ful streyt and evene lay his jolly schood.
Chaucer's Canterbury Tales, v. 3314.
(Goldglänzend war sein Haar, kraus wie gebrannt,
Breit wie ein Fächer stand es um den Kopf
Und glatt und eben sass sein voller Schopf.
W. Hertzberg.)
Und der reiche Kaufherr im scheckigen Gewand und Biberhut trägt einen Zwickelbart »nach
flämischer Art« (ebenda, v. 272), denselben wie König Wenzel.
Auch den Drolerien der Randverzierungen ist mit dem Scheine grösseren Rechtes der etwas
muffige Vorwurf der Unsittlichkeit gemacht worden. Ich will ihnen kein moralisches Mäntelchen um-
hängen; aber einerseits sind sie, wie wir gesehen haben, die Allegorie eines sehr legalen Verhältnisses
und andererseits boten die Badescenen, — die ja übrigens niemals indecent behandelt sind, ■— dem
Auge eines mittelalterlichen Menschen auch an dieser Stelle nichts Anstössiges. Die schönen burgundi-
schen und französischen Gebetbücher des 15. Jahrhunderts gehen in dieser Hinsicht viel weiter. Man
sehe nur, was für Unanständigkeiten namentlich die Affen auf den Rändern des Gebetbuches Nr. 1857
der Wiener Hofbibliothek treiben. Da sollte man sich doch lieber fragen, ob derlei Dinge nicht im
1 Der Psalter der Wenzelsbibel ist jedoch in abweichender Weise mit historischen Scenen zumeist aus der Ge-
schichte Davids ausgestattet.
XIV. 39