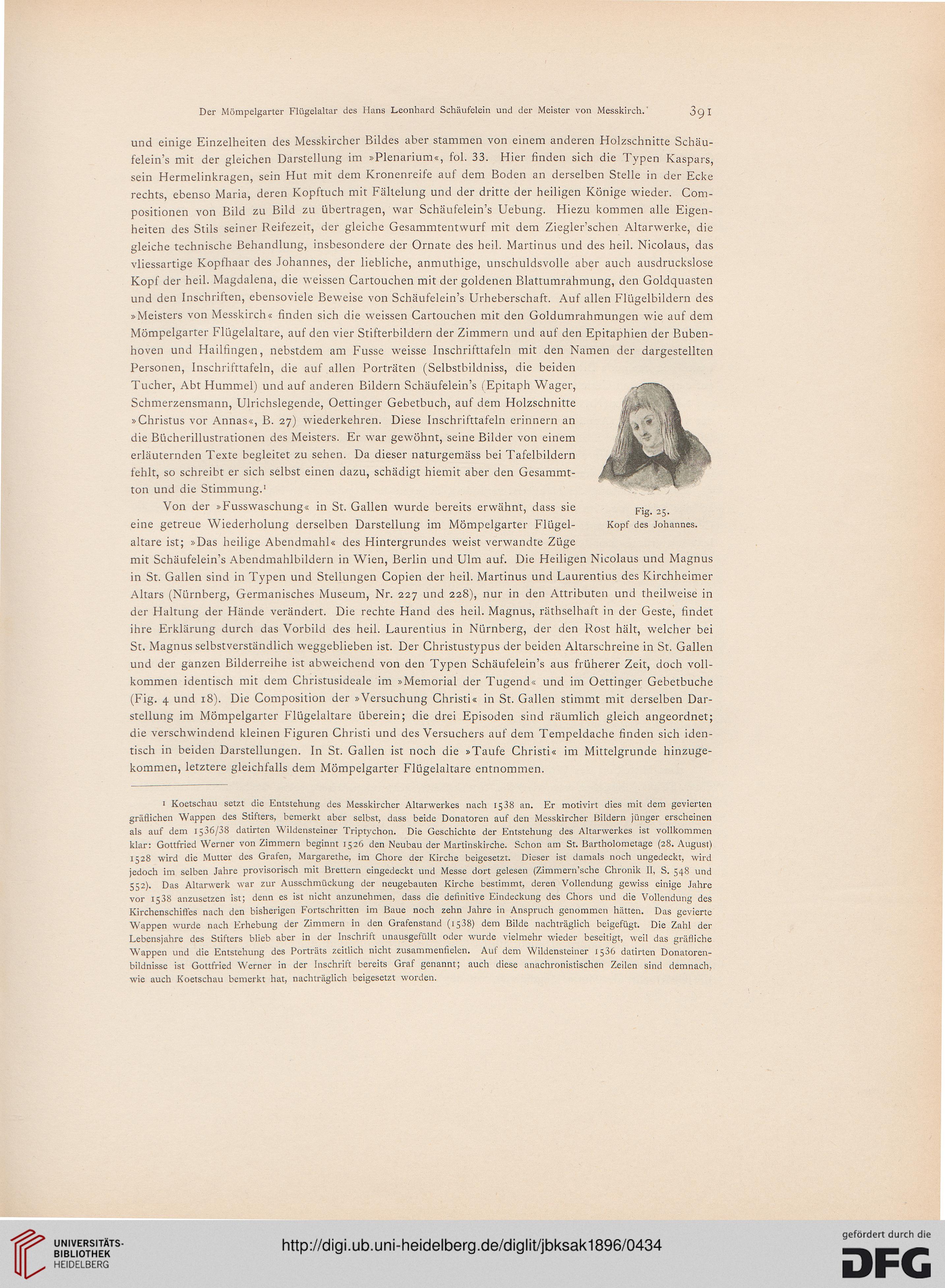Der Mömpelgarter Flügelaltar des Hans Leonhard Schäufelein und der Meister von Messkirch.
391
und einige Einzelheiten des Messkircher Bildes aber stammen von einem anderen Holzschnitte Schäu-
felein's mit der gleichen Darstellung im »Plenarium«, fol. 33. Hier rinden sich die Typen Kaspars,
sein Hermelinkragen, sein Hut mit dem Kronenreife auf dem Boden an derselben Stelle in der Ecke
rechts, ebenso Maria, deren Kopftuch mit Fältelung und der dritte der heiligen Könige wieder. Com-
positionen von Bild zu Bild zu übertragen, war Schäufelein's Uebung. Hiezu kommen alle Eigen-
heiten des Stils seiner Reifezeit, der gleiche Gesammtentwurf mit dem Ziegler'schen Altarwerke, die
gleiche technische Behandlung, insbesondere der Ornate des heil. Martinus und des heil. Nicolaus, das
vliessartige Kopfhaar des Johannes, der liebliche, anmuthige, unschuldsvolle aber auch ausdruckslose
Kopf der heil. Magdalena, die weissen Cartouchen mit der goldenen Blattumrahmung, den Goldquasten
und den Inschriften, ebensoviele Beweise von Schäufelein's Urheberschaft. Auf allen Flügelbildern des
»Meisters von Messkirch« finden sich die weissen Cartouchen mit den Goldumrahmungen wie auf dem
Mömpelgarter Flügelaltare, auf den vier Stifterbildern der Zimmern und auf den Epitaphien der Buben-
hoven und Hailfingen, nebstdem am Fusse weisse Inschrifttafeln mit den Namen der dargestellten
Personen, Inschrifttafeln, die auf allen Porträten (Selbstbildniss, die beiden
Tucher, Abt Hummel) und auf anderen Bildern Schäufelein's (Epitaph Wager,
Schmerzensmann, Ulrichslegende, Oettinger Gebetbuch, auf dem Holzschnitte
»Christus vor Annas«, B. 27) wiederkehren. Diese Inschrifttafeln erinnern an
die Bücherillustrationen des Meisters. Er war gewöhnt, seine Bilder von einem
erläuternden Texte begleitet zu sehen. Da dieser naturgemäss bei Tafelbildern
fehlt, so schreibt er sich selbst einen dazu, schädigt hiemit aber den Gesammt-
ton und die Stimmung.1
Von der »Fusswaschung« in St. Gallen wurde bereits erwähnt, dass sie
eine getreue Wiederholung derselben Darstellung im Mömpelgarter Flügel- Kopf des Johannes,
altare ist; »Das heilige Abendmahl« des Hintergrundes weist verwandte Züge
mit Schäufelein's Abendmahlbildern in Wien, Berlin und Ulm auf. Die Heiligen Nicolaus und Magnus
in St. Gallen sind in Typen und Stellungen Copien der heil. Martinus und Laurentius des Kirchheimer
Altars (Nürnberg, Germanisches Museum, Nr. 227 und 228), nur in den Attributen und theilweise in
der Haltung der Hände verändert. Die rechte Hand des heil. Magnus, räthselhaft in der Geste, findet
ihre Erklärung durch das Vorbild des heil. Laurentius in Nürnberg, der den Rost hält, welcher bei
St. Magnus selbstverständlich weggeblieben ist. Der Christustypus der beiden Altarschreine in St. Gallen
und der ganzen Bilderreihe ist abweichend von den Typen Schäufelein's aus früherer Zeit, doch voll-
kommen identisch mit dem Christusideale im »Memorial der Tugend« und im Oettinger Gebetbuche
(Fig. 4 und 18). Die Composition der »Versuchung Christi« in St. Gallen stimmt mit derselben Dar-
stellung im Mömpelgarter Flügelaltare überein; die drei Episoden sind räumlich gleich angeordnet;
die verschwindend kleinen Figuren Christi und des Versuchers auf dem Tempeldache finden sich iden-
tisch in beiden Darstellungen. In St. Gallen ist noch die »Taufe Christi« im Mittelgrunde hinzuge-
kommen, letztere gleichfalls dem Mömpelgarter Flügelaltare entnommen.
1 Koetschau setzt die Entstehung des Messkircher Altarwerkes nach 1538 an. Er motivirt dies mit dem gevierten
gräflichen Wappen des Stifters, bemerkt aber selbst, dass beide Donatoren auf den Messkircher Bildern jünger erscheinen
als auf dem 1536/38 datirten Wildensteiner Triptychon. Die Geschichte der Entstehung des Altarwerkes ist vollkommen
klar: Gottfried Werner von Zimmern beginnt 1526 den Neubau der Martinskirche. Schon am St. Bartholometage (28. August)
1528 wird die Mutter des Grafen, »Margarethe, im Chore der Kirche beigesetzt. Dieser ist damals noch ungedeckt, wird
jedoch im selben Jahre provisorisch mit Brettern eingedeckt und Messe dort gelesen (Zimmern'sche Chronik II, S. 548 und
552). Das Altarwerk war zur Ausschmückung der neugebauten Kirche bestimmt, deren Vollendung gewiss einige Jahre
vor 1538 anzusetzen ist; denn es ist nicht anzunehmen, dass die definitive Eindeckung des Chors und die Vollendung des
Kirchenschiffes nach den bisherigen Fortschritten im Baue noch zehn Jahre in Anspruch genommen hätten. Das gevierte
Wappen wurde nach Erhebung der Zimmern in den Grafenstand (i538) dem Bilde nachträglich beigefügt. Die Zahl der
Lebensjahre des Stifters blieb aber in der Inschrift unausgefüllt oder wurde vielmehr wieder beseitigt, weil das gräfliche
Wappen und die Entstehung des Porträts zeitlich nicht zusammenfielen. Auf dem Wildensteiner 1536 datirten Donatoren-
bildnisse ist Gottfried Werner in der Inschrift bereits Graf genannt; auch diese anachronistischen Zeilen sind demnach,
wie auch Koetschau bemerkt hat, nachträglich beigesetzt worden.
391
und einige Einzelheiten des Messkircher Bildes aber stammen von einem anderen Holzschnitte Schäu-
felein's mit der gleichen Darstellung im »Plenarium«, fol. 33. Hier rinden sich die Typen Kaspars,
sein Hermelinkragen, sein Hut mit dem Kronenreife auf dem Boden an derselben Stelle in der Ecke
rechts, ebenso Maria, deren Kopftuch mit Fältelung und der dritte der heiligen Könige wieder. Com-
positionen von Bild zu Bild zu übertragen, war Schäufelein's Uebung. Hiezu kommen alle Eigen-
heiten des Stils seiner Reifezeit, der gleiche Gesammtentwurf mit dem Ziegler'schen Altarwerke, die
gleiche technische Behandlung, insbesondere der Ornate des heil. Martinus und des heil. Nicolaus, das
vliessartige Kopfhaar des Johannes, der liebliche, anmuthige, unschuldsvolle aber auch ausdruckslose
Kopf der heil. Magdalena, die weissen Cartouchen mit der goldenen Blattumrahmung, den Goldquasten
und den Inschriften, ebensoviele Beweise von Schäufelein's Urheberschaft. Auf allen Flügelbildern des
»Meisters von Messkirch« finden sich die weissen Cartouchen mit den Goldumrahmungen wie auf dem
Mömpelgarter Flügelaltare, auf den vier Stifterbildern der Zimmern und auf den Epitaphien der Buben-
hoven und Hailfingen, nebstdem am Fusse weisse Inschrifttafeln mit den Namen der dargestellten
Personen, Inschrifttafeln, die auf allen Porträten (Selbstbildniss, die beiden
Tucher, Abt Hummel) und auf anderen Bildern Schäufelein's (Epitaph Wager,
Schmerzensmann, Ulrichslegende, Oettinger Gebetbuch, auf dem Holzschnitte
»Christus vor Annas«, B. 27) wiederkehren. Diese Inschrifttafeln erinnern an
die Bücherillustrationen des Meisters. Er war gewöhnt, seine Bilder von einem
erläuternden Texte begleitet zu sehen. Da dieser naturgemäss bei Tafelbildern
fehlt, so schreibt er sich selbst einen dazu, schädigt hiemit aber den Gesammt-
ton und die Stimmung.1
Von der »Fusswaschung« in St. Gallen wurde bereits erwähnt, dass sie
eine getreue Wiederholung derselben Darstellung im Mömpelgarter Flügel- Kopf des Johannes,
altare ist; »Das heilige Abendmahl« des Hintergrundes weist verwandte Züge
mit Schäufelein's Abendmahlbildern in Wien, Berlin und Ulm auf. Die Heiligen Nicolaus und Magnus
in St. Gallen sind in Typen und Stellungen Copien der heil. Martinus und Laurentius des Kirchheimer
Altars (Nürnberg, Germanisches Museum, Nr. 227 und 228), nur in den Attributen und theilweise in
der Haltung der Hände verändert. Die rechte Hand des heil. Magnus, räthselhaft in der Geste, findet
ihre Erklärung durch das Vorbild des heil. Laurentius in Nürnberg, der den Rost hält, welcher bei
St. Magnus selbstverständlich weggeblieben ist. Der Christustypus der beiden Altarschreine in St. Gallen
und der ganzen Bilderreihe ist abweichend von den Typen Schäufelein's aus früherer Zeit, doch voll-
kommen identisch mit dem Christusideale im »Memorial der Tugend« und im Oettinger Gebetbuche
(Fig. 4 und 18). Die Composition der »Versuchung Christi« in St. Gallen stimmt mit derselben Dar-
stellung im Mömpelgarter Flügelaltare überein; die drei Episoden sind räumlich gleich angeordnet;
die verschwindend kleinen Figuren Christi und des Versuchers auf dem Tempeldache finden sich iden-
tisch in beiden Darstellungen. In St. Gallen ist noch die »Taufe Christi« im Mittelgrunde hinzuge-
kommen, letztere gleichfalls dem Mömpelgarter Flügelaltare entnommen.
1 Koetschau setzt die Entstehung des Messkircher Altarwerkes nach 1538 an. Er motivirt dies mit dem gevierten
gräflichen Wappen des Stifters, bemerkt aber selbst, dass beide Donatoren auf den Messkircher Bildern jünger erscheinen
als auf dem 1536/38 datirten Wildensteiner Triptychon. Die Geschichte der Entstehung des Altarwerkes ist vollkommen
klar: Gottfried Werner von Zimmern beginnt 1526 den Neubau der Martinskirche. Schon am St. Bartholometage (28. August)
1528 wird die Mutter des Grafen, »Margarethe, im Chore der Kirche beigesetzt. Dieser ist damals noch ungedeckt, wird
jedoch im selben Jahre provisorisch mit Brettern eingedeckt und Messe dort gelesen (Zimmern'sche Chronik II, S. 548 und
552). Das Altarwerk war zur Ausschmückung der neugebauten Kirche bestimmt, deren Vollendung gewiss einige Jahre
vor 1538 anzusetzen ist; denn es ist nicht anzunehmen, dass die definitive Eindeckung des Chors und die Vollendung des
Kirchenschiffes nach den bisherigen Fortschritten im Baue noch zehn Jahre in Anspruch genommen hätten. Das gevierte
Wappen wurde nach Erhebung der Zimmern in den Grafenstand (i538) dem Bilde nachträglich beigefügt. Die Zahl der
Lebensjahre des Stifters blieb aber in der Inschrift unausgefüllt oder wurde vielmehr wieder beseitigt, weil das gräfliche
Wappen und die Entstehung des Porträts zeitlich nicht zusammenfielen. Auf dem Wildensteiner 1536 datirten Donatoren-
bildnisse ist Gottfried Werner in der Inschrift bereits Graf genannt; auch diese anachronistischen Zeilen sind demnach,
wie auch Koetschau bemerkt hat, nachträglich beigesetzt worden.