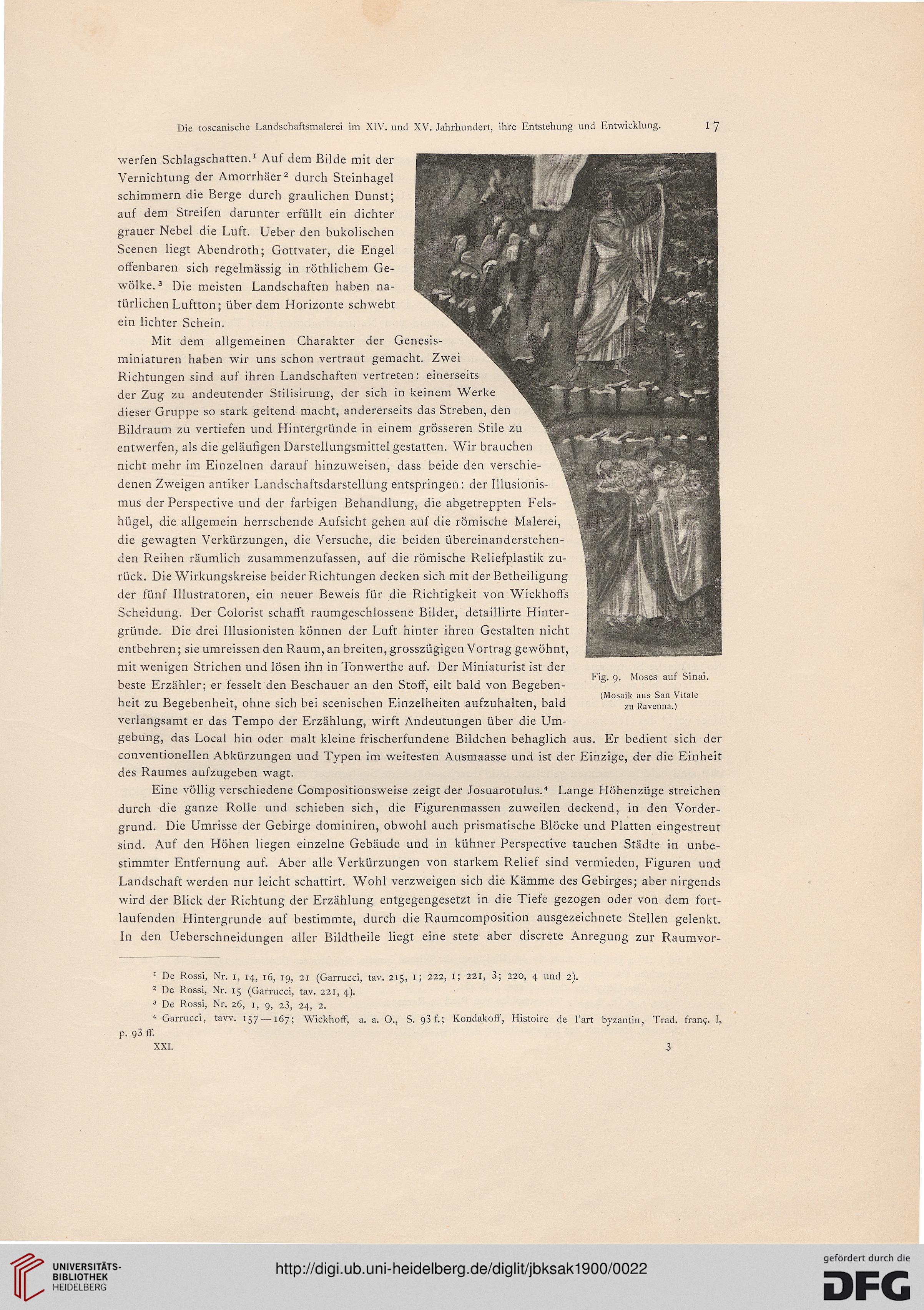Die toscanische Landschaftsmalerei im XIV. und XV. Jahrhundert, ihre Entstehung und Entwicklung.
i 7
werfen Schlagschatten.1 Auf dem Bilde mit der
Vernichtung der Amorrhäer2 durch Steinhagel
schimmern die Berge durch graulichen Dunst;
auf dem Streifen darunter erfüllt ein dichter
grauer Nebel die Luft. Ueber den bukolischen
Scenen liegt Abendroth; Gottvater, die Engel
offenbaren sich regelmässig in röthlichem Ge-
wölke.3 Die meisten Landschaften haben na-
türlichen Luftton; über dem Horizonte schwebt
ein lichter Schein.
Mit dem allgemeinen Charakter der Genesis-
miniaturen haben wir uns schon vertraut gemacht. Zwei
Richtungen sind auf ihren Landschaften vertreten: einerseits
der Zug zu andeutender Stilisirung, der sich in keinem Werke
dieser Gruppe so stark geltend macht, andererseits das Streben, den
Bildraum zu vertiefen und Hintergründe in einem grösseren Stile zu
entwerfen, als die geläufigen Darstellungsmittel gestatten. Wir brauchen
nicht mehr im Einzelnen darauf hinzuweisen, dass beide den verschie-
denen Zweigen antiker Landschaftsdarstellung entspringen: der Illusionis-
mus der Perspective und der farbigen Behandlung, die abgetreppten Fels
hügel, die allgemein herrschende Aufsicht gehen auf die römische Malerei,
die gewagten Verkürzungen, die Versuche, die beiden übereinanderstehen-
den Reihen räumlich zusammenzufassen, auf die römische Reliefplastik zu-
rück. Die Wirkungskreise beider Richtungen decken sich mit der Betheiligung
der fünf Illustratoren, ein neuer Beweis für die Richtigkeit von Wickhoffs
Scheidung. Der Colorist schafft raumgeschlossene Bilder, detaillirte Hinter-
gründe. Die drei Illusionisten können der Luft hinter ihren Gestalten nicht
entbehren; sie umreissen den Raum, an breiten, grosszügigen Vortrag gewöhnt,
mit wenigen Strichen und lösen ihn in Tonwerthe auf. Der Miniaturist ist der
Fig.
Moses auf Sinai.
(Mosaik aus San Vitale
zu Ravenna.)
beste Erzähler; er fesselt den Beschauer an den Stoff, eilt bald von Begeben-
heit zu Begebenheit, ohne sich bei scenischen Einzelheiten aufzuhalten, bald
verlangsamt er das Tempo der Erzählung, wirft Andeutungen über die Um-
gebung, das Local hin oder malt kleine frischerfundene Bildchen behaglich aus. Er bedient sich der
Conventionellen Abkürzungen und Typen im weitesten Ausmaasse und ist der Einzige, der die Einheit
des Raumes aufzugeben wagt.
Eine völlig verschiedene Compositionsweise zeigt der Josuarotulus.4 Lange Höhenzüge streichen
durch die ganze Rolle und schieben sich, die Figurenmassen zuweilen deckend, in den Vorder-
grund. Die Umrisse der Gebirge dominiren, obwohl auch prismatische Blöcke und Platten eingestreut
sind. Auf den Höhen liegen einzelne Gebäude und in kühner Perspective tauchen Städte in unbe-
stimmter Entfernung auf. Aber alle Verkürzungen von starkem Relief sind vermieden, Figuren und
Landschaft werden nur leicht schattirt. Wohl verzweigen sich die Kämme des Gebirges; aber nirgends
wird der Blick der Richtung der Erzählung entgegengesetzt in die Tiefe gezogen oder von dem fort-
laufenden Hintergrunde auf bestimmte, durch die Raumcomposition ausgezeichnete Stellen gelenkt.
In den Ueberschneidungen aller Bildtheile liegt eine stete aber discrete Anregung zur Raumvor-
1 De Rossi, Nr. i, 14, 16, 19, 21 (Garrucci, tav. 215, 1; 222, I; 221, 3; 220, 4 und 2).
2 De Rossi, Nr. 15 (Garrucci, tav. 221, 4).
3 De Rossi, Nr. 26, 1, 9, 23, 24, 2.
4 Garrucci, tavv. 157 —167; Wickhoff, a. a. O., S. 93 f.; Kondakoff, Histoire de t'art byzanfin, Trad. franc. I,
P. 93 ff.
XXI. 3
i 7
werfen Schlagschatten.1 Auf dem Bilde mit der
Vernichtung der Amorrhäer2 durch Steinhagel
schimmern die Berge durch graulichen Dunst;
auf dem Streifen darunter erfüllt ein dichter
grauer Nebel die Luft. Ueber den bukolischen
Scenen liegt Abendroth; Gottvater, die Engel
offenbaren sich regelmässig in röthlichem Ge-
wölke.3 Die meisten Landschaften haben na-
türlichen Luftton; über dem Horizonte schwebt
ein lichter Schein.
Mit dem allgemeinen Charakter der Genesis-
miniaturen haben wir uns schon vertraut gemacht. Zwei
Richtungen sind auf ihren Landschaften vertreten: einerseits
der Zug zu andeutender Stilisirung, der sich in keinem Werke
dieser Gruppe so stark geltend macht, andererseits das Streben, den
Bildraum zu vertiefen und Hintergründe in einem grösseren Stile zu
entwerfen, als die geläufigen Darstellungsmittel gestatten. Wir brauchen
nicht mehr im Einzelnen darauf hinzuweisen, dass beide den verschie-
denen Zweigen antiker Landschaftsdarstellung entspringen: der Illusionis-
mus der Perspective und der farbigen Behandlung, die abgetreppten Fels
hügel, die allgemein herrschende Aufsicht gehen auf die römische Malerei,
die gewagten Verkürzungen, die Versuche, die beiden übereinanderstehen-
den Reihen räumlich zusammenzufassen, auf die römische Reliefplastik zu-
rück. Die Wirkungskreise beider Richtungen decken sich mit der Betheiligung
der fünf Illustratoren, ein neuer Beweis für die Richtigkeit von Wickhoffs
Scheidung. Der Colorist schafft raumgeschlossene Bilder, detaillirte Hinter-
gründe. Die drei Illusionisten können der Luft hinter ihren Gestalten nicht
entbehren; sie umreissen den Raum, an breiten, grosszügigen Vortrag gewöhnt,
mit wenigen Strichen und lösen ihn in Tonwerthe auf. Der Miniaturist ist der
Fig.
Moses auf Sinai.
(Mosaik aus San Vitale
zu Ravenna.)
beste Erzähler; er fesselt den Beschauer an den Stoff, eilt bald von Begeben-
heit zu Begebenheit, ohne sich bei scenischen Einzelheiten aufzuhalten, bald
verlangsamt er das Tempo der Erzählung, wirft Andeutungen über die Um-
gebung, das Local hin oder malt kleine frischerfundene Bildchen behaglich aus. Er bedient sich der
Conventionellen Abkürzungen und Typen im weitesten Ausmaasse und ist der Einzige, der die Einheit
des Raumes aufzugeben wagt.
Eine völlig verschiedene Compositionsweise zeigt der Josuarotulus.4 Lange Höhenzüge streichen
durch die ganze Rolle und schieben sich, die Figurenmassen zuweilen deckend, in den Vorder-
grund. Die Umrisse der Gebirge dominiren, obwohl auch prismatische Blöcke und Platten eingestreut
sind. Auf den Höhen liegen einzelne Gebäude und in kühner Perspective tauchen Städte in unbe-
stimmter Entfernung auf. Aber alle Verkürzungen von starkem Relief sind vermieden, Figuren und
Landschaft werden nur leicht schattirt. Wohl verzweigen sich die Kämme des Gebirges; aber nirgends
wird der Blick der Richtung der Erzählung entgegengesetzt in die Tiefe gezogen oder von dem fort-
laufenden Hintergrunde auf bestimmte, durch die Raumcomposition ausgezeichnete Stellen gelenkt.
In den Ueberschneidungen aller Bildtheile liegt eine stete aber discrete Anregung zur Raumvor-
1 De Rossi, Nr. i, 14, 16, 19, 21 (Garrucci, tav. 215, 1; 222, I; 221, 3; 220, 4 und 2).
2 De Rossi, Nr. 15 (Garrucci, tav. 221, 4).
3 De Rossi, Nr. 26, 1, 9, 23, 24, 2.
4 Garrucci, tavv. 157 —167; Wickhoff, a. a. O., S. 93 f.; Kondakoff, Histoire de t'art byzanfin, Trad. franc. I,
P. 93 ff.
XXI. 3