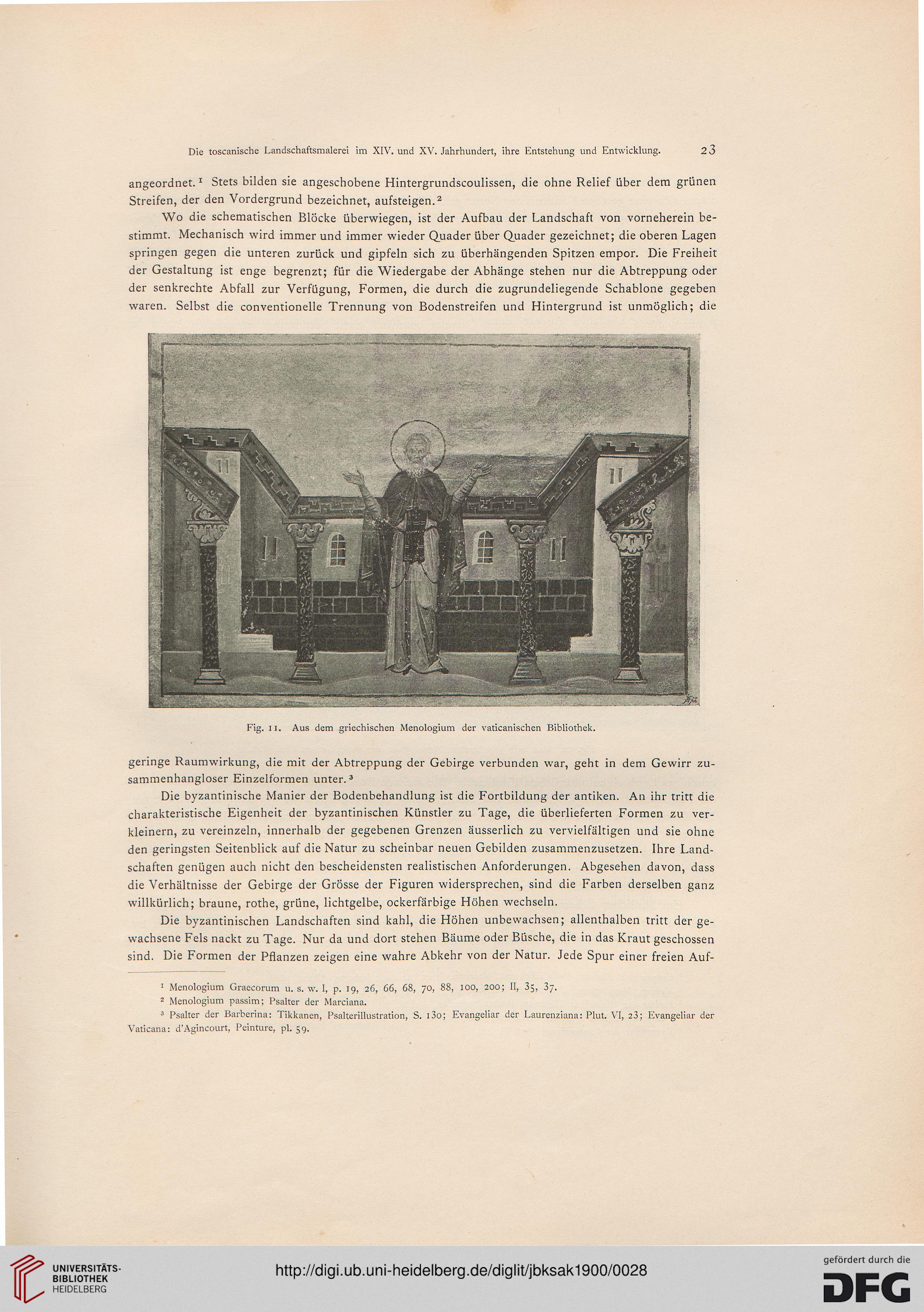Die toscanische Landschaftsmalerei im XIV. und XV. Jahrhundert, ihre Entstehung und Entwicklung.
23
angeordnet.1 Stets bilden sie angeschobene Hintergrundscoulissen, die ohne Relief über dem grünen
Streifen, der den Vordergrund bezeichnet, aufsteigen.2
Wo die schematischen Blöcke überwiegen, ist der Aufbau der Landschaft von vorneherein be-
stimmt. Mechanisch wird immer und immer wieder Quader über Quader gezeichnet; die oberen Lagen
springen gegen die unteren zurück und gipfeln sich zu überhängenden Spitzen empor. Die Freiheit
der Gestaltung ist enge begrenzt; für die Wiedergabe der Abhänge stehen nur die Abtreppung oder
der senkrechte Abfall zur Verfügung, Formen, die durch die zugrundeliegende Schablone gegeben
waren. Selbst die conventioneile Trennung von Bodenstreifen und Hintergrund ist unmöglich; die
Fig. Ii. Aus dem griechischen Menologium der vaticanischen Bibliothek.
geringe Raumwirkung, die mit der Abtreppung der Gebirge verbunden war, geht in dem Gewirr zu-
sammenhangloser Einzelformen unter. 3
Die byzantinische Manier der Bodenbehandlung ist die Fortbildung der antiken. An ihr tritt die
charakteristische Eigenheit der byzantinischen Künstler zu Tage, die überlieferten Formen zu ver-
kleinern, zu vereinzeln, innerhalb der gegebenen Grenzen äusserlich zu vervielfältigen und sie ohne
den geringsten Seitenblick auf die Natur zu scheinbar neuen Gebilden zusammenzusetzen. Ihre Land-
schaften genügen auch nicht den bescheidensten realistischen Anforderungen. Abgesehen davon, dass
die Verhältnisse der Gebirge der Grösse der Figuren widersprechen, sind die Farben derselben ganz
willkürlich; braune, rothe, grüne, lichtgelbe, ockerfarbige Höhen wechseln.
Die byzantinischen Landschaften sind kahl, die Höhen unbewachsen; allenthalben tritt der ge-
wachsene Fels nackt zu Tage. Nur da und dort stehen Bäume oder Büsche, die in das Kraut geschossen
sind. Die Formen der Pflanzen zeigen eine wahre Abkehr von der Natur. Jede Spur einer freien Auf-
1 Menologium Graecorum u. s. w. I, p. 19, 26, 66, 68, 70, 88, 100, 200; 11, 3;, 3j.
2 Menologium passim; Psalter der Marciana.
3 Psalter der Barberina: Tikkanen, Psalterillustration, S. l3o; Evangeliar der Laurenziana: Plut. VI, 23; Evangeliar der
Vaticana: d'Agincourt, Peinture, pl. 59.
23
angeordnet.1 Stets bilden sie angeschobene Hintergrundscoulissen, die ohne Relief über dem grünen
Streifen, der den Vordergrund bezeichnet, aufsteigen.2
Wo die schematischen Blöcke überwiegen, ist der Aufbau der Landschaft von vorneherein be-
stimmt. Mechanisch wird immer und immer wieder Quader über Quader gezeichnet; die oberen Lagen
springen gegen die unteren zurück und gipfeln sich zu überhängenden Spitzen empor. Die Freiheit
der Gestaltung ist enge begrenzt; für die Wiedergabe der Abhänge stehen nur die Abtreppung oder
der senkrechte Abfall zur Verfügung, Formen, die durch die zugrundeliegende Schablone gegeben
waren. Selbst die conventioneile Trennung von Bodenstreifen und Hintergrund ist unmöglich; die
Fig. Ii. Aus dem griechischen Menologium der vaticanischen Bibliothek.
geringe Raumwirkung, die mit der Abtreppung der Gebirge verbunden war, geht in dem Gewirr zu-
sammenhangloser Einzelformen unter. 3
Die byzantinische Manier der Bodenbehandlung ist die Fortbildung der antiken. An ihr tritt die
charakteristische Eigenheit der byzantinischen Künstler zu Tage, die überlieferten Formen zu ver-
kleinern, zu vereinzeln, innerhalb der gegebenen Grenzen äusserlich zu vervielfältigen und sie ohne
den geringsten Seitenblick auf die Natur zu scheinbar neuen Gebilden zusammenzusetzen. Ihre Land-
schaften genügen auch nicht den bescheidensten realistischen Anforderungen. Abgesehen davon, dass
die Verhältnisse der Gebirge der Grösse der Figuren widersprechen, sind die Farben derselben ganz
willkürlich; braune, rothe, grüne, lichtgelbe, ockerfarbige Höhen wechseln.
Die byzantinischen Landschaften sind kahl, die Höhen unbewachsen; allenthalben tritt der ge-
wachsene Fels nackt zu Tage. Nur da und dort stehen Bäume oder Büsche, die in das Kraut geschossen
sind. Die Formen der Pflanzen zeigen eine wahre Abkehr von der Natur. Jede Spur einer freien Auf-
1 Menologium Graecorum u. s. w. I, p. 19, 26, 66, 68, 70, 88, 100, 200; 11, 3;, 3j.
2 Menologium passim; Psalter der Marciana.
3 Psalter der Barberina: Tikkanen, Psalterillustration, S. l3o; Evangeliar der Laurenziana: Plut. VI, 23; Evangeliar der
Vaticana: d'Agincourt, Peinture, pl. 59.