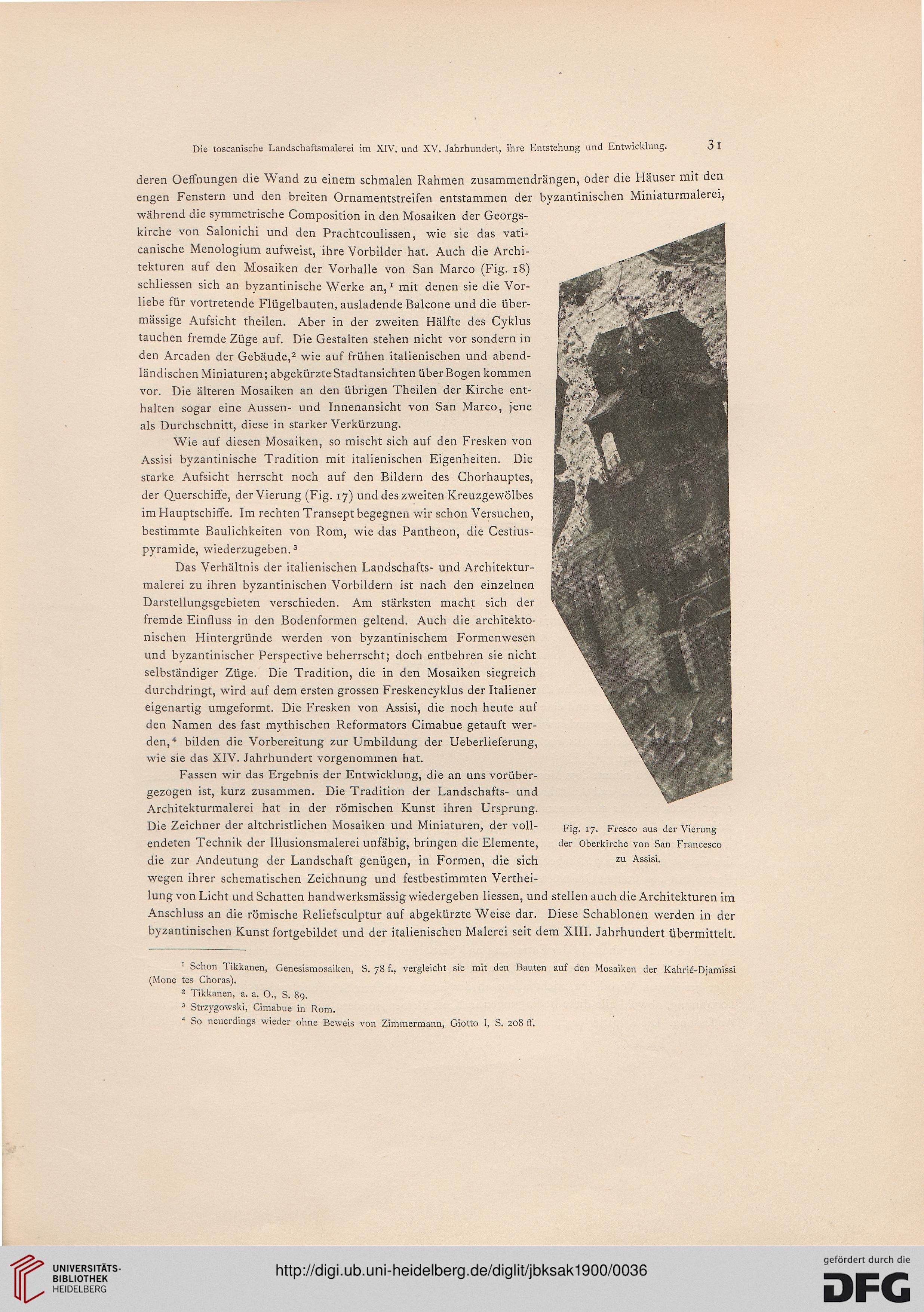Die toscanische Landschaftsmalerei im XIV. und XV. Jahrhundert, ihre Entstehung und Entwicklung.
3i
deren Oeffnungen die Wand zu einem schmalen Rahmen zusammendrängen, oder die Häuser mit den
engen Fenstern und den breiten Ornamentstreifen entstammen der byzantinischen Miniaturmalerei,
während die symmetrische Composition in den Mosaiken der Georgs-
kirche von Salonichi und den Prachtcoulissen, wie sie das vati-
canische Menologium aufweist, ihre Vorbilder hat. Auch die Archi-
tekturen auf den Mosaiken der Vorhalle von San Marco (Fig. 18)
schliessen sich an byzantinische Werke an,1 mit denen sie die Vor-
liebe für vortretende Flügelbauten, ausladende Balcone und die über-
mässige Aufsicht theilen. Aber in der zweiten Hälfte des Cyklus
tauchen fremde Züge auf. Die Gestalten stehen nicht vor sondern in
den Arcaden der Gebäude,2 wie auf frühen italienischen und abend-
ländischen Miniaturen; abgekürzte Stadtansichten über Bogen kommen
vor. Die älteren Mosaiken an den übrigen Theilen der Kirche ent-
halten sogar eine Aussen- und Innenansicht von San Marco, jene
als Durchschnitt, diese in starker Verkürzung.
Wie auf diesen Mosaiken, so mischt sich auf den Fresken von
Assisi byzantinische Tradition mit italienischen Eigenheiten. Die
starke Aufsicht herrscht noch auf den Bildern des Chorhauptes,
der Querschiffe, der Vierung (Fig. 17) und des zweiten Kreuzgewölbes
im Hauptschiffe. Im rechten Transept begegnen wir schon Versuchen,
bestimmte Baulichkeiten von Rom, wie das Pantheon, die Cestius-
pyramide, wiederzugeben.3
Das Verhältnis der italienischen Landschafts- und Architektur-
malerei zu ihren byzantinischen Vorbildern ist nach den einzelnen
Darstellungsgebieten verschieden. Am stärksten macht sich der
fremde Einfluss in den Bodenformen geltend. Auch die architekto-
nischen Hintergründe werden von byzantinischem Formenwesen
und byzantinischer Perspective beherrscht; doch entbehren sie nicht
selbständiger Züge. Die Tradition, die in den Mosaiken siegreich
durchdringt, wird auf dem ersten grossen Freskeneyklus der Italiener
eigenartig umgeformt. Die Fresken von Assisi, die noch heute auf
den Namen des fast mythischen Reformators Cimabue getauft wer-
den,4 bilden die Vorbereitung zur Umbildung der Ueberlieferung,
wie sie das XIV. Jahrhundert vorgenommen hat.
Fassen wir das Ergebnis der Entwicklung, die an uns vorüber-
gezogen ist, kurz zusammen. Die Tradition der Landschafts- und
Architekturmalerei hat in der römischen Kunst ihren Ursprung.
Die Zeichner der altchristlichen Mosaiken und Miniaturen, der voll-
endeten Technik der Illusionsmalerei unfähig, bringen die Elemente,
die zur Andeutung der Landschaft genügen, in Formen, die sich
wegen ihrer schematischen Zeichnung und festbestimmten Verthei-
lung von Licht und Schatten handwerksmässig wiedergeben Hessen, und stellen auch die Architekturen im
Anschluss an die römische Reliefsculptur auf abgekürzte Weise dar. Diese Schablonen werden in der
byzantinischen Kunst fortgebildet und der italienischen Malerei seit dem XIII. Jahrhundert übermittelt.
Fig. 17. Fresco aus der Vierung
der Oberkirche von San Francesco
zu Assisi.
1 Schon Tikkanen, Genesismosaiken, S. 78 f., vergleicht sie mit den Bauten auf den Mosaiken der Kahrie-Djamissi
(Mone tes Choras).
2 Tikkanen, a. a. O., S. 89.
3 Strzygowski, Cimabue in Rom.
4 So neuerdings wieder ohne Beweis von Zimmermann, Giotto I, S. 208 ff.
3i
deren Oeffnungen die Wand zu einem schmalen Rahmen zusammendrängen, oder die Häuser mit den
engen Fenstern und den breiten Ornamentstreifen entstammen der byzantinischen Miniaturmalerei,
während die symmetrische Composition in den Mosaiken der Georgs-
kirche von Salonichi und den Prachtcoulissen, wie sie das vati-
canische Menologium aufweist, ihre Vorbilder hat. Auch die Archi-
tekturen auf den Mosaiken der Vorhalle von San Marco (Fig. 18)
schliessen sich an byzantinische Werke an,1 mit denen sie die Vor-
liebe für vortretende Flügelbauten, ausladende Balcone und die über-
mässige Aufsicht theilen. Aber in der zweiten Hälfte des Cyklus
tauchen fremde Züge auf. Die Gestalten stehen nicht vor sondern in
den Arcaden der Gebäude,2 wie auf frühen italienischen und abend-
ländischen Miniaturen; abgekürzte Stadtansichten über Bogen kommen
vor. Die älteren Mosaiken an den übrigen Theilen der Kirche ent-
halten sogar eine Aussen- und Innenansicht von San Marco, jene
als Durchschnitt, diese in starker Verkürzung.
Wie auf diesen Mosaiken, so mischt sich auf den Fresken von
Assisi byzantinische Tradition mit italienischen Eigenheiten. Die
starke Aufsicht herrscht noch auf den Bildern des Chorhauptes,
der Querschiffe, der Vierung (Fig. 17) und des zweiten Kreuzgewölbes
im Hauptschiffe. Im rechten Transept begegnen wir schon Versuchen,
bestimmte Baulichkeiten von Rom, wie das Pantheon, die Cestius-
pyramide, wiederzugeben.3
Das Verhältnis der italienischen Landschafts- und Architektur-
malerei zu ihren byzantinischen Vorbildern ist nach den einzelnen
Darstellungsgebieten verschieden. Am stärksten macht sich der
fremde Einfluss in den Bodenformen geltend. Auch die architekto-
nischen Hintergründe werden von byzantinischem Formenwesen
und byzantinischer Perspective beherrscht; doch entbehren sie nicht
selbständiger Züge. Die Tradition, die in den Mosaiken siegreich
durchdringt, wird auf dem ersten grossen Freskeneyklus der Italiener
eigenartig umgeformt. Die Fresken von Assisi, die noch heute auf
den Namen des fast mythischen Reformators Cimabue getauft wer-
den,4 bilden die Vorbereitung zur Umbildung der Ueberlieferung,
wie sie das XIV. Jahrhundert vorgenommen hat.
Fassen wir das Ergebnis der Entwicklung, die an uns vorüber-
gezogen ist, kurz zusammen. Die Tradition der Landschafts- und
Architekturmalerei hat in der römischen Kunst ihren Ursprung.
Die Zeichner der altchristlichen Mosaiken und Miniaturen, der voll-
endeten Technik der Illusionsmalerei unfähig, bringen die Elemente,
die zur Andeutung der Landschaft genügen, in Formen, die sich
wegen ihrer schematischen Zeichnung und festbestimmten Verthei-
lung von Licht und Schatten handwerksmässig wiedergeben Hessen, und stellen auch die Architekturen im
Anschluss an die römische Reliefsculptur auf abgekürzte Weise dar. Diese Schablonen werden in der
byzantinischen Kunst fortgebildet und der italienischen Malerei seit dem XIII. Jahrhundert übermittelt.
Fig. 17. Fresco aus der Vierung
der Oberkirche von San Francesco
zu Assisi.
1 Schon Tikkanen, Genesismosaiken, S. 78 f., vergleicht sie mit den Bauten auf den Mosaiken der Kahrie-Djamissi
(Mone tes Choras).
2 Tikkanen, a. a. O., S. 89.
3 Strzygowski, Cimabue in Rom.
4 So neuerdings wieder ohne Beweis von Zimmermann, Giotto I, S. 208 ff.