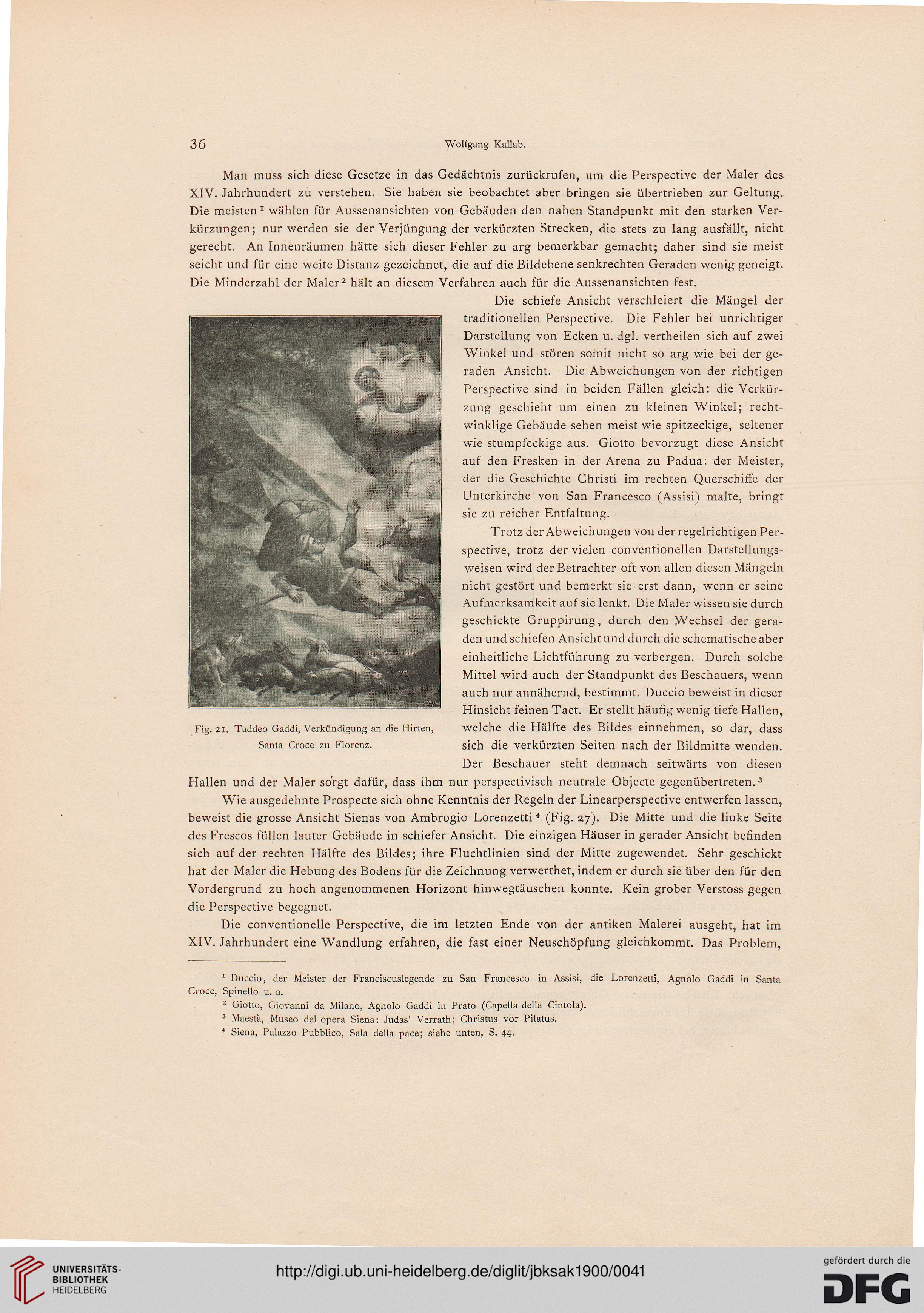36
Wolfgang Kallab.
Man muss sich diese Gesetze in das Gedächtnis zurückrufen, um die Perspective der Maler des
XIV. Jahrhundert zu verstehen. Sie haben sie beobachtet aber bringen sie übertrieben zur Geltung.
Die meisten 1 wählen für Aussenansichten von Gebäuden den nahen Standpunkt mit den starken Ver-
kürzungen; nur werden sie der Verjüngung der verkürzten Strecken, die stets zu lang ausfällt, nicht
gerecht. An Innenräumen hätte sich dieser Fehler zu arg bemerkbar gemacht; daher sind sie meist
seicht und für eine weite Distanz gezeichnet, die auf die Bildebene senkrechten Geraden wenig geneigt.
Die Minderzahl der Maler2 hält an diesem Verfahren auch für die Aussenansichten fest.
Die schiefe Ansicht verschleiert die Mängel der
traditionellen Perspective. Die Fehler bei unrichtiger
Darstellung von Ecken u. dgl. vertheilen sich auf zwei
Winkel und stören somit nicht so arg wie bei der ge-
raden Ansicht. Die Abweichungen von der richtigen
Perspective sind in beiden Fällen gleich: die Verkür-
zung geschieht um einen zu kleinen Winkel; recht-
winklige Gebäude sehen meist wie spitzeckige, seltener
wie stumpfeckige aus. Giotto bevorzugt diese Ansicht
auf den Fresken in der Arena zu Padua: der Meister,
der die Geschichte Christi im rechten Querschiffe der
Unterkirche von San Francesco (Assisi) malte, bringt
sie zu reicher Entfaltung.
Trotz der Abweichungen von der regelrichtigen Per-
spective, trotz der vielen conventioneilen Darstellungs-
weisen wird der Betrachter oft von allen diesen Mängeln
nicht gestört und bemerkt sie erst dann, wenn er seine
Aufmerksamkeit auf sie lenkt. Die Maler wissen sie durch
geschickte Gruppirung, durch den Wechsel der gera-
den und schiefen Ansicht und durch die schematische aber
einheitliche Lichtführung zu verbergen. Durch solche
Mittel wird auch der Standpunkt des Beschauers, wenn
auch nur annähernd, bestimmt. Duccio beweist in dieser
Hinsicht feinen Tact. Er stellt häufig wenig tiefe Hallen,
welche die Hälfte des Bildes einnehmen, so dar, dass
sich die verkürzten Seiten nach der Bildmitte wenden.
Der Beschauer steht demnach seitwärts von diesen
Hallen und der Maler sorgt dafür, dass ihm nur perspectivisch neutrale Objecte gegenübertreten. 3
Wie ausgedehnte Prospecte sich ohne Kenntnis der Regeln der Linearperspective entwerfen lassen,
beweist die grosse Ansicht Sienas von Ambrogio Lorenzetti4 (Fig. 27). Die Mitte und die linke Seite
des Frescos füllen lauter Gebäude in schiefer Ansicht. Die einzigen Häuser in gerader Ansicht befinden
sich auf der rechten Hälfte des Bildes; ihre Fluchtlinien sind der Mitte zugewendet. Sehr geschickt
hat der Maler die Hebung des Bodens für die Zeichnung verwerthet, indem er durch sie über den für den
Vordergrund zu hoch angenommenen Horizont hinwegtäuschen konnte. Kein grober Verstoss gegen
die Perspective begegnet.
Die conventionelle Perspective, die im letzten Ende von der antiken Malerei ausgeht, hat im
XIV. Jahrhundert eine Wandlung erfahren, die fast einer Neuschöpfung gleichkommt. Das Problem,
Fig. 21. Taddeo Gaddi, Verkündigung an die Hirten,
Santa Croce zu Florenz.
1 Duccio, der Meister der Franciscuslegende zu San Francesco in Assisi, die Lorenzetti, Agnolo Gaddi in Santa
Croce, Spinello u. a.
2 Giotto, Giovanni da Milano, Agnolo Gaddi in Prato (Capella della Cintola).
3 Maestä, Museo del opera Siena: Judas' Verrath; Christus vor Pilatus.
4 Siena, Palazzo Pubblico, Sala della pace; siehe unten, S. 44.
Wolfgang Kallab.
Man muss sich diese Gesetze in das Gedächtnis zurückrufen, um die Perspective der Maler des
XIV. Jahrhundert zu verstehen. Sie haben sie beobachtet aber bringen sie übertrieben zur Geltung.
Die meisten 1 wählen für Aussenansichten von Gebäuden den nahen Standpunkt mit den starken Ver-
kürzungen; nur werden sie der Verjüngung der verkürzten Strecken, die stets zu lang ausfällt, nicht
gerecht. An Innenräumen hätte sich dieser Fehler zu arg bemerkbar gemacht; daher sind sie meist
seicht und für eine weite Distanz gezeichnet, die auf die Bildebene senkrechten Geraden wenig geneigt.
Die Minderzahl der Maler2 hält an diesem Verfahren auch für die Aussenansichten fest.
Die schiefe Ansicht verschleiert die Mängel der
traditionellen Perspective. Die Fehler bei unrichtiger
Darstellung von Ecken u. dgl. vertheilen sich auf zwei
Winkel und stören somit nicht so arg wie bei der ge-
raden Ansicht. Die Abweichungen von der richtigen
Perspective sind in beiden Fällen gleich: die Verkür-
zung geschieht um einen zu kleinen Winkel; recht-
winklige Gebäude sehen meist wie spitzeckige, seltener
wie stumpfeckige aus. Giotto bevorzugt diese Ansicht
auf den Fresken in der Arena zu Padua: der Meister,
der die Geschichte Christi im rechten Querschiffe der
Unterkirche von San Francesco (Assisi) malte, bringt
sie zu reicher Entfaltung.
Trotz der Abweichungen von der regelrichtigen Per-
spective, trotz der vielen conventioneilen Darstellungs-
weisen wird der Betrachter oft von allen diesen Mängeln
nicht gestört und bemerkt sie erst dann, wenn er seine
Aufmerksamkeit auf sie lenkt. Die Maler wissen sie durch
geschickte Gruppirung, durch den Wechsel der gera-
den und schiefen Ansicht und durch die schematische aber
einheitliche Lichtführung zu verbergen. Durch solche
Mittel wird auch der Standpunkt des Beschauers, wenn
auch nur annähernd, bestimmt. Duccio beweist in dieser
Hinsicht feinen Tact. Er stellt häufig wenig tiefe Hallen,
welche die Hälfte des Bildes einnehmen, so dar, dass
sich die verkürzten Seiten nach der Bildmitte wenden.
Der Beschauer steht demnach seitwärts von diesen
Hallen und der Maler sorgt dafür, dass ihm nur perspectivisch neutrale Objecte gegenübertreten. 3
Wie ausgedehnte Prospecte sich ohne Kenntnis der Regeln der Linearperspective entwerfen lassen,
beweist die grosse Ansicht Sienas von Ambrogio Lorenzetti4 (Fig. 27). Die Mitte und die linke Seite
des Frescos füllen lauter Gebäude in schiefer Ansicht. Die einzigen Häuser in gerader Ansicht befinden
sich auf der rechten Hälfte des Bildes; ihre Fluchtlinien sind der Mitte zugewendet. Sehr geschickt
hat der Maler die Hebung des Bodens für die Zeichnung verwerthet, indem er durch sie über den für den
Vordergrund zu hoch angenommenen Horizont hinwegtäuschen konnte. Kein grober Verstoss gegen
die Perspective begegnet.
Die conventionelle Perspective, die im letzten Ende von der antiken Malerei ausgeht, hat im
XIV. Jahrhundert eine Wandlung erfahren, die fast einer Neuschöpfung gleichkommt. Das Problem,
Fig. 21. Taddeo Gaddi, Verkündigung an die Hirten,
Santa Croce zu Florenz.
1 Duccio, der Meister der Franciscuslegende zu San Francesco in Assisi, die Lorenzetti, Agnolo Gaddi in Santa
Croce, Spinello u. a.
2 Giotto, Giovanni da Milano, Agnolo Gaddi in Prato (Capella della Cintola).
3 Maestä, Museo del opera Siena: Judas' Verrath; Christus vor Pilatus.
4 Siena, Palazzo Pubblico, Sala della pace; siehe unten, S. 44.