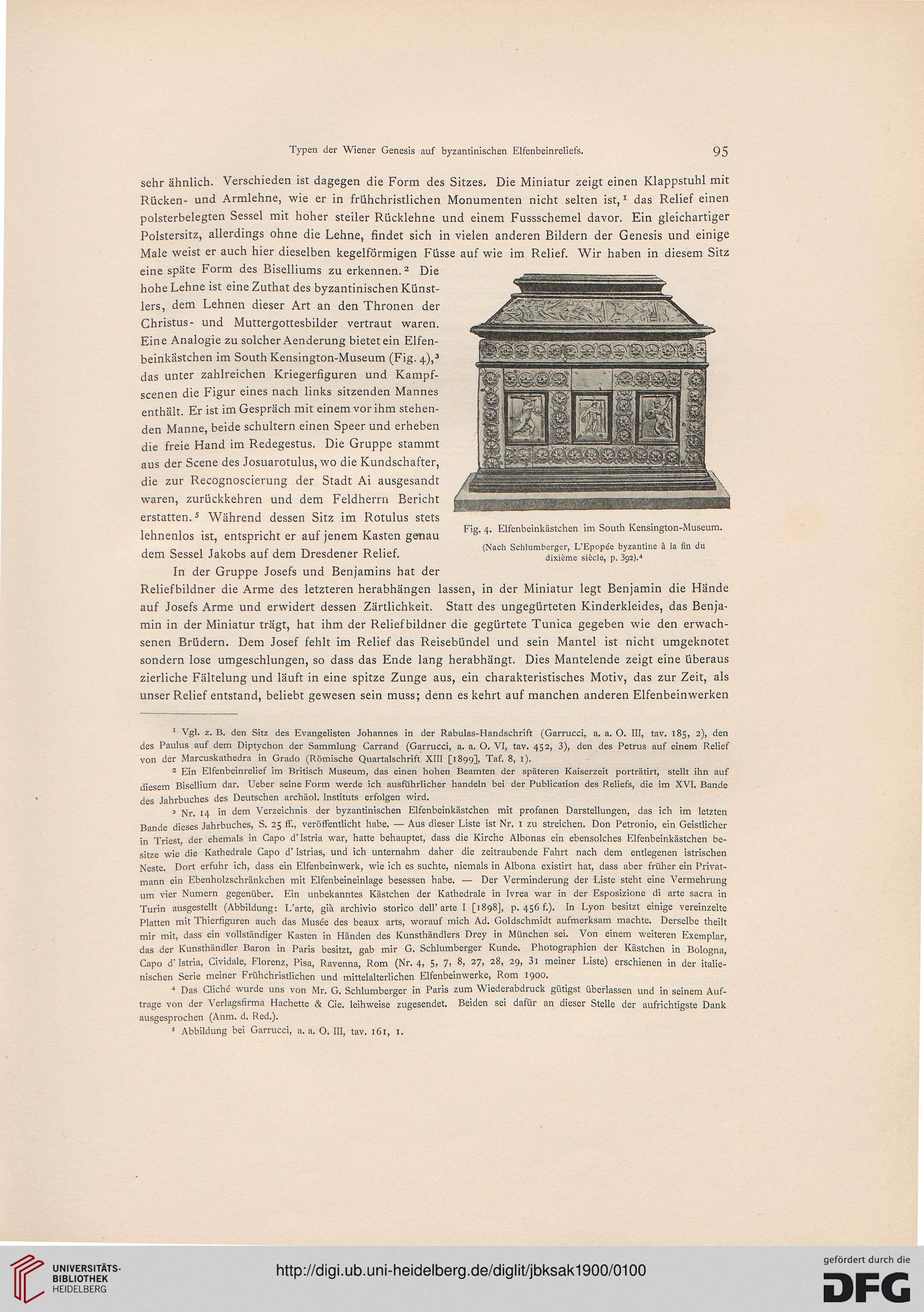Typen der Wiener Genesis auf byzantinischen Elfenbeinreliefs.
95
sehr ähnlich. Verschieden ist dagegen die Form des Sitzes. Die Miniatur zeigt einen Klappstuhl mit
Rücken- und Armlehne, wie er in frühchristlichen Monumenten nicht selten ist,1 das Relief einen
polsterbelegten Sessel mit hoher steiler Rücklehne und einem Fussschemel davor. Ein gleichartiger
Polstersitz, allerdings ohne die Lehne, findet sich in vielen anderen Bildern der Genesis und einige
Male weist er auch hier dieselben kegelförmigen Füsse auf wie im Relief. Wir haben in diesem Sitz
eine späte Form des Biselliums zuerkennen.2 Die
hohe Lehne ist eine Zuthat des byzantinischen Künst-
lers, dem Lehnen dieser Art an den Thronen der
Christus- und Muttergottesbilder vertraut waren.
Eine Analogie zu solcher Aenderung bietet ein Elfen-
beinkästchen im South Kensington-Museum (Fig. 4),3
das unter zahlreichen Kriegerfiguren und Kampf-
scenen die Figur eines nach links sitzenden Mannes
enthält. Er ist im Gespräch mit einem vor ihm stehen-
den Manne, beide schultern einen Speer und erheben
die freie Hand im Redegestus. Die Gruppe stammt
aus der Scene des Josuarotulus, wo die Kundschafter,
die zur Recognoscierung der Stadt Ai ausgesandt
waren, zurückkehren und dem Feldherrn Bericht
erstatten.5 Während dessen Sitz im Rotulus stets
lehnenlos ist, entspricht er auf jenem Kasten genau
dem Sessel Jakobs auf dem Dresdener Relief.
In der Gruppe Josefs und Benjamins hat der
Reliefbildner die Arme des letzteren herabhängen lassen, in der Miniatur legt Benjamin die Hände
auf Josefs Arme und erwidert dessen Zärtlichkeit. Statt des ungegürteten Kinderkleides, das Benja-
min in der Miniatur trägt, hat ihm der Relief bildner die gegürtete Tunica gegeben wie den erwach-
senen Brüdern. Dem Josef fehlt im Relief das Reisebündel und sein Mantel ist nicht umgeknotet
sondern lose umgeschlungen, so dass das Ende lang herabhängt. Dies Mantelende zeigt eine überaus
zierliche Fältelung und läuft in eine spitze Zunge aus, ein charakteristisches Motiv, das zur Zeit, als
unser Relief entstand, beliebt gewesen sein muss; denn es kehrt auf manchen anderen Elfenbeinwerken
1 Vgl. z. B. den Sitz des Evangelisten Johannes in der Rabulas-Handschrift (Garrucci, a. a. O. III, tav. 185, 2), den
des Paulus auf dem Diptychon der Sammlung Carrand (Garrucci, a. a. O. VI, tav. 452, 3), den des Petrus auf einem Relief
von der Marcuskafhedra in Grado (Römische Quartalschrift XIII [1899], Taf. 8, 1).
2 Ein Elfenbeinrelief im Britisch Museum, das einen hohen Beamten der späteren Kaiserzeit porträtirt, stellt ihn auf
diesem Bisellium dar. Ueber seine Form werde ich ausführlicher handeln bei der Publication des Reliefs, die im XVI. Bande
des Jahrbuches des Deutschen archäol. Instituts erfolgen wird.
3 Nr. 14 in dem Verzeichnis der byzantinischen Elfenbeinkästchen mit profanen Darstellungen, das ich im letzten
Bande dieses Jahrbuches, S. 25 ff., veröffentlicht habe. — Aus dieser Liste ist Nr. 1 zu streichen. Don Petronio, ein Geistlicher
in Triest, der ehemals in Capo d'Istria war, hatte behauptet, dass die Kirche Albonas ein ebensolches Elfenbeinkästchen be-
sitze wie die Kathedrale Capo d' Istrias, und ich unternahm daher die zeitraubende Fahrt nach dem entlegenen istrischen
Neste. Dort erfuhr ich, dass ein Elfenbeinwerk, wie ich es suchte, niemals in Albona existirt hat, dass aber früher ein Privat-
mann ein Ebenholzschränkchen mit Elfenbeineinlage besessen habe. — Der Verminderung der Liste steht eine Vermehrung
um vier Numern gegenüber. Ein unbekanntes Kästchen der Kathedrale in Ivrea war in der Esposizione di arte sacra in
Turin ausgestellt (Abbildung: L'arte, giä archivio storico dell' arte I [1898], p. 456 f.). In Lyon besitzt einige vereinzelte
Platten mit Thierfiguren auch das Musee des beaux arts, worauf mich Ad. Goldschmidt aufmerksam machte. Derselbe theilt
mir mit, dass ein vollständiger Kasten in Händen des Kunsthändlers Drey in München sei. Von einem weiteren Exemplar,
das der Kunsthändler Baron in Paris besitzt, gab mir G. Schlumberger Kunde. Photographien der Kästchen in Bologna,
Capo d' Istria, Cividale, Florenz, Pisa, Ravenna, Rom (Nr. 4, 5> 7. 8> 27, 2&> 29> 3l meiner Liste) erschienen in der italie-
nischen Serie meiner Frühchristlichen und mittelalterlichen Elfenbeinwerke, Rom 1900.
4 Das Clich-d wurde uns von Mr. G. Schlumberger in Paris zum Wiederabdruck gütigst überlassen und in seinem Auf-
trage von der Verlagsfirma Hachette & Cie. leihweise zugesendet. Beiden sei dafür an dieser Stelle der aufrichtigste Dank
ausgesprochen (Anm. d. Red.).
5 Abbildung bei Garrucci, a. a. O. III, tav. 161, I.
95
sehr ähnlich. Verschieden ist dagegen die Form des Sitzes. Die Miniatur zeigt einen Klappstuhl mit
Rücken- und Armlehne, wie er in frühchristlichen Monumenten nicht selten ist,1 das Relief einen
polsterbelegten Sessel mit hoher steiler Rücklehne und einem Fussschemel davor. Ein gleichartiger
Polstersitz, allerdings ohne die Lehne, findet sich in vielen anderen Bildern der Genesis und einige
Male weist er auch hier dieselben kegelförmigen Füsse auf wie im Relief. Wir haben in diesem Sitz
eine späte Form des Biselliums zuerkennen.2 Die
hohe Lehne ist eine Zuthat des byzantinischen Künst-
lers, dem Lehnen dieser Art an den Thronen der
Christus- und Muttergottesbilder vertraut waren.
Eine Analogie zu solcher Aenderung bietet ein Elfen-
beinkästchen im South Kensington-Museum (Fig. 4),3
das unter zahlreichen Kriegerfiguren und Kampf-
scenen die Figur eines nach links sitzenden Mannes
enthält. Er ist im Gespräch mit einem vor ihm stehen-
den Manne, beide schultern einen Speer und erheben
die freie Hand im Redegestus. Die Gruppe stammt
aus der Scene des Josuarotulus, wo die Kundschafter,
die zur Recognoscierung der Stadt Ai ausgesandt
waren, zurückkehren und dem Feldherrn Bericht
erstatten.5 Während dessen Sitz im Rotulus stets
lehnenlos ist, entspricht er auf jenem Kasten genau
dem Sessel Jakobs auf dem Dresdener Relief.
In der Gruppe Josefs und Benjamins hat der
Reliefbildner die Arme des letzteren herabhängen lassen, in der Miniatur legt Benjamin die Hände
auf Josefs Arme und erwidert dessen Zärtlichkeit. Statt des ungegürteten Kinderkleides, das Benja-
min in der Miniatur trägt, hat ihm der Relief bildner die gegürtete Tunica gegeben wie den erwach-
senen Brüdern. Dem Josef fehlt im Relief das Reisebündel und sein Mantel ist nicht umgeknotet
sondern lose umgeschlungen, so dass das Ende lang herabhängt. Dies Mantelende zeigt eine überaus
zierliche Fältelung und läuft in eine spitze Zunge aus, ein charakteristisches Motiv, das zur Zeit, als
unser Relief entstand, beliebt gewesen sein muss; denn es kehrt auf manchen anderen Elfenbeinwerken
1 Vgl. z. B. den Sitz des Evangelisten Johannes in der Rabulas-Handschrift (Garrucci, a. a. O. III, tav. 185, 2), den
des Paulus auf dem Diptychon der Sammlung Carrand (Garrucci, a. a. O. VI, tav. 452, 3), den des Petrus auf einem Relief
von der Marcuskafhedra in Grado (Römische Quartalschrift XIII [1899], Taf. 8, 1).
2 Ein Elfenbeinrelief im Britisch Museum, das einen hohen Beamten der späteren Kaiserzeit porträtirt, stellt ihn auf
diesem Bisellium dar. Ueber seine Form werde ich ausführlicher handeln bei der Publication des Reliefs, die im XVI. Bande
des Jahrbuches des Deutschen archäol. Instituts erfolgen wird.
3 Nr. 14 in dem Verzeichnis der byzantinischen Elfenbeinkästchen mit profanen Darstellungen, das ich im letzten
Bande dieses Jahrbuches, S. 25 ff., veröffentlicht habe. — Aus dieser Liste ist Nr. 1 zu streichen. Don Petronio, ein Geistlicher
in Triest, der ehemals in Capo d'Istria war, hatte behauptet, dass die Kirche Albonas ein ebensolches Elfenbeinkästchen be-
sitze wie die Kathedrale Capo d' Istrias, und ich unternahm daher die zeitraubende Fahrt nach dem entlegenen istrischen
Neste. Dort erfuhr ich, dass ein Elfenbeinwerk, wie ich es suchte, niemals in Albona existirt hat, dass aber früher ein Privat-
mann ein Ebenholzschränkchen mit Elfenbeineinlage besessen habe. — Der Verminderung der Liste steht eine Vermehrung
um vier Numern gegenüber. Ein unbekanntes Kästchen der Kathedrale in Ivrea war in der Esposizione di arte sacra in
Turin ausgestellt (Abbildung: L'arte, giä archivio storico dell' arte I [1898], p. 456 f.). In Lyon besitzt einige vereinzelte
Platten mit Thierfiguren auch das Musee des beaux arts, worauf mich Ad. Goldschmidt aufmerksam machte. Derselbe theilt
mir mit, dass ein vollständiger Kasten in Händen des Kunsthändlers Drey in München sei. Von einem weiteren Exemplar,
das der Kunsthändler Baron in Paris besitzt, gab mir G. Schlumberger Kunde. Photographien der Kästchen in Bologna,
Capo d' Istria, Cividale, Florenz, Pisa, Ravenna, Rom (Nr. 4, 5> 7. 8> 27, 2&> 29> 3l meiner Liste) erschienen in der italie-
nischen Serie meiner Frühchristlichen und mittelalterlichen Elfenbeinwerke, Rom 1900.
4 Das Clich-d wurde uns von Mr. G. Schlumberger in Paris zum Wiederabdruck gütigst überlassen und in seinem Auf-
trage von der Verlagsfirma Hachette & Cie. leihweise zugesendet. Beiden sei dafür an dieser Stelle der aufrichtigste Dank
ausgesprochen (Anm. d. Red.).
5 Abbildung bei Garrucci, a. a. O. III, tav. 161, I.