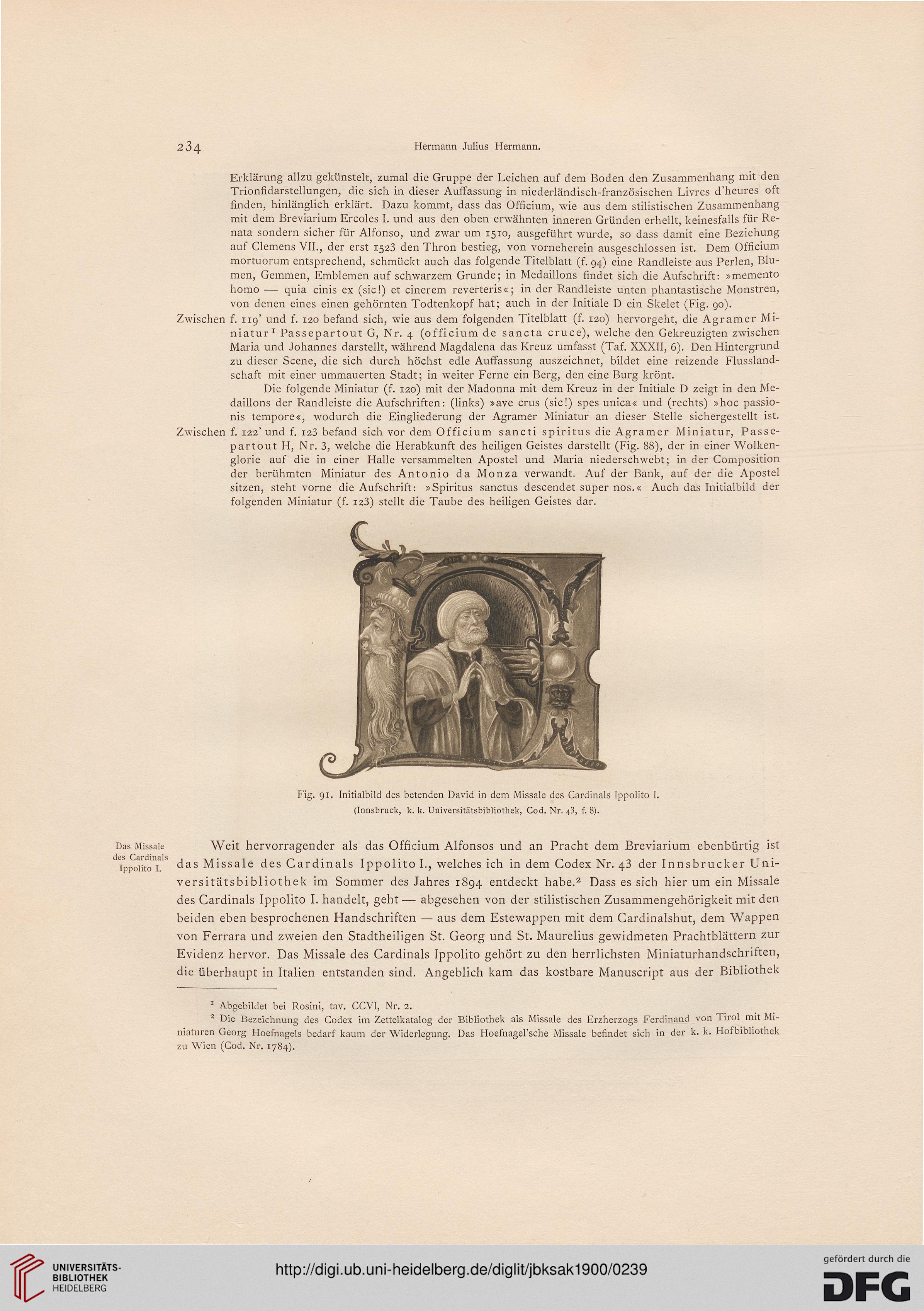234
Hermann Julius Hermann.
Erklärung allzu gekünstelt, zumal die Gruppe der Leichen auf dem Boden den Zusammenhang mit den
Trionfidarstellungen, die sich in dieser Auffassung in niederländisch-französischen Livres d'heures oft
finden, hinlänglich erklärt. Dazu kommt, dass das Officium, wie aus dem stilistischen Zusammenhang
mit dem Breviarium Ercoles I. und aus den oben erwähnten inneren Gründen erhellt, keinesfalls für Re-
nata sondern sicher für Alfonso, und zwar um 1510, ausgeführt wurde, so dass damit eine Beziehung
auf Clemens VII., der erst 1523 den Thron bestieg, von vorneherein ausgeschlossen ist. Dem Officium
mortuorum entsprechend, schmückt auch das folgende Titelblatt (f. 94) eine Randleiste aus Perlen, Blu-
men, Gemmen, Emblemen auf schwarzem Grunde; in Medaillons findet sich die Aufschrift: »memento
homo — quia cinis ex (sie!) et cinerem reverteris«; in der Randleiste unten phantastische Monstren,
von denen eines einen gehörnten Todtenkopf hat; auch in der Initiale D ein Skelet (Fig. 90).
Zwischen f. 119' und f. 120 befand sich, wie aus dem folgenden Titelblatt (f. 120) hervorgeht, die Agramer Mi-
niatur1 Passepartout G, Nr. 4 (officium de saneta cruce), welche den Gekreuzigten zwischen
Maria und Johannes darstellt, während Magdalena das Kreuz umfasst (Taf. XXXII, 6). Den Hintergrund
zu dieser Scene, die sich durch höchst edle Auffassung auszeichnet, bildet eine reizende Flussland-
schaft mit einer ummauerten Stadt; in weiter Ferne ein Berg, den eine Burg krönt.
Die folgende Miniatur (f. 120) mit der Madonna mit dem Kreuz in der Initiale D zeigt in den Me-
daillons der Randleiste die Aufschriften: (links) »ave crus (sie!) spes unica« und (rechts) »hoc passio-
nis tempore«, wodurch die Eingliederung der Agramer Miniatur an dieser Stelle sichergestellt ist.
Zwischen f. 122'und f. 123 befand sich vor dem Officium saneti spiritus die Agramer Miniatur, Passe-
partout H, Nr. 3, welche die Herabkunft des heiligen Geistes darstellt (Fig. 88), der in einer Wolken-
glorie auf die in einer Halle versammelten Apostel und Maria niederschwebt; in der Composition
der berühmten Miniatur des Antonio da Monza verwandt. Auf der Bank, auf der die Apostel
sitzen, steht vorne die Aufschrift: »Spiritus sanetus descendet super nos.« Auch das Initialbild der
folgenden Miniatur (f. 123) stellt die Taube des heiligen Geistes dar.
Fig. 91. Initialbild des betenden David in dem Missale des Cardinais Ippolito 1.
(Innsbruck, k. k. Universitätsbibliothek, Cod. Nr. 43, f. 8).
Das Missale Weit hervorragender als das Officium Alfonsos und an Pracht dem Breviarium ebenbürtig ist
ippoUtoT'8 das Missale des Cardinais Ippolito I., welches ich in dem Codex Nr. 43 der Innsbrucker Uni-
versitätsbibliothek im Sommer des Jahres 1894 entdeckt habe.2 Dass es sich hier um ein Missale
des Cardinais Ippolito I. handelt, geht — abgesehen von der stilistischen Zusammengehörigkeit mit den
beiden eben besprochenen Handschriften — aus dem Estewappen mit dem Cardinalshut, dem Wappen
von Ferrara und zweien den Stadtheiligen St. Georg und St. Maurelius gewidmeten Prachtblättern zur
Evidenz hervor. Das Missale des Cardinais Ippolito gehört zu den herrlichsten Miniaturhandschriften,
die überhaupt in Italien entstanden sind. Angeblich kam das kostbare Manuscript aus der Bibliothek
1 Abgebildet bei Rosini, tav. CCVI, Nr. 2.
2 Die Bezeichnung des Codex im Zettelkatalog der Bibliothek als Missale des Erzherzogs Ferdinand von Tirol mit Mi-
niaturen Georg Hoefnagels bedarf kaum der Widerlegung. Das Hoefnagel'sche Missale befindet sich in der k. k. Hof bibliothek
zu Wien (Cod. Nr. 1784).
Hermann Julius Hermann.
Erklärung allzu gekünstelt, zumal die Gruppe der Leichen auf dem Boden den Zusammenhang mit den
Trionfidarstellungen, die sich in dieser Auffassung in niederländisch-französischen Livres d'heures oft
finden, hinlänglich erklärt. Dazu kommt, dass das Officium, wie aus dem stilistischen Zusammenhang
mit dem Breviarium Ercoles I. und aus den oben erwähnten inneren Gründen erhellt, keinesfalls für Re-
nata sondern sicher für Alfonso, und zwar um 1510, ausgeführt wurde, so dass damit eine Beziehung
auf Clemens VII., der erst 1523 den Thron bestieg, von vorneherein ausgeschlossen ist. Dem Officium
mortuorum entsprechend, schmückt auch das folgende Titelblatt (f. 94) eine Randleiste aus Perlen, Blu-
men, Gemmen, Emblemen auf schwarzem Grunde; in Medaillons findet sich die Aufschrift: »memento
homo — quia cinis ex (sie!) et cinerem reverteris«; in der Randleiste unten phantastische Monstren,
von denen eines einen gehörnten Todtenkopf hat; auch in der Initiale D ein Skelet (Fig. 90).
Zwischen f. 119' und f. 120 befand sich, wie aus dem folgenden Titelblatt (f. 120) hervorgeht, die Agramer Mi-
niatur1 Passepartout G, Nr. 4 (officium de saneta cruce), welche den Gekreuzigten zwischen
Maria und Johannes darstellt, während Magdalena das Kreuz umfasst (Taf. XXXII, 6). Den Hintergrund
zu dieser Scene, die sich durch höchst edle Auffassung auszeichnet, bildet eine reizende Flussland-
schaft mit einer ummauerten Stadt; in weiter Ferne ein Berg, den eine Burg krönt.
Die folgende Miniatur (f. 120) mit der Madonna mit dem Kreuz in der Initiale D zeigt in den Me-
daillons der Randleiste die Aufschriften: (links) »ave crus (sie!) spes unica« und (rechts) »hoc passio-
nis tempore«, wodurch die Eingliederung der Agramer Miniatur an dieser Stelle sichergestellt ist.
Zwischen f. 122'und f. 123 befand sich vor dem Officium saneti spiritus die Agramer Miniatur, Passe-
partout H, Nr. 3, welche die Herabkunft des heiligen Geistes darstellt (Fig. 88), der in einer Wolken-
glorie auf die in einer Halle versammelten Apostel und Maria niederschwebt; in der Composition
der berühmten Miniatur des Antonio da Monza verwandt. Auf der Bank, auf der die Apostel
sitzen, steht vorne die Aufschrift: »Spiritus sanetus descendet super nos.« Auch das Initialbild der
folgenden Miniatur (f. 123) stellt die Taube des heiligen Geistes dar.
Fig. 91. Initialbild des betenden David in dem Missale des Cardinais Ippolito 1.
(Innsbruck, k. k. Universitätsbibliothek, Cod. Nr. 43, f. 8).
Das Missale Weit hervorragender als das Officium Alfonsos und an Pracht dem Breviarium ebenbürtig ist
ippoUtoT'8 das Missale des Cardinais Ippolito I., welches ich in dem Codex Nr. 43 der Innsbrucker Uni-
versitätsbibliothek im Sommer des Jahres 1894 entdeckt habe.2 Dass es sich hier um ein Missale
des Cardinais Ippolito I. handelt, geht — abgesehen von der stilistischen Zusammengehörigkeit mit den
beiden eben besprochenen Handschriften — aus dem Estewappen mit dem Cardinalshut, dem Wappen
von Ferrara und zweien den Stadtheiligen St. Georg und St. Maurelius gewidmeten Prachtblättern zur
Evidenz hervor. Das Missale des Cardinais Ippolito gehört zu den herrlichsten Miniaturhandschriften,
die überhaupt in Italien entstanden sind. Angeblich kam das kostbare Manuscript aus der Bibliothek
1 Abgebildet bei Rosini, tav. CCVI, Nr. 2.
2 Die Bezeichnung des Codex im Zettelkatalog der Bibliothek als Missale des Erzherzogs Ferdinand von Tirol mit Mi-
niaturen Georg Hoefnagels bedarf kaum der Widerlegung. Das Hoefnagel'sche Missale befindet sich in der k. k. Hof bibliothek
zu Wien (Cod. Nr. 1784).