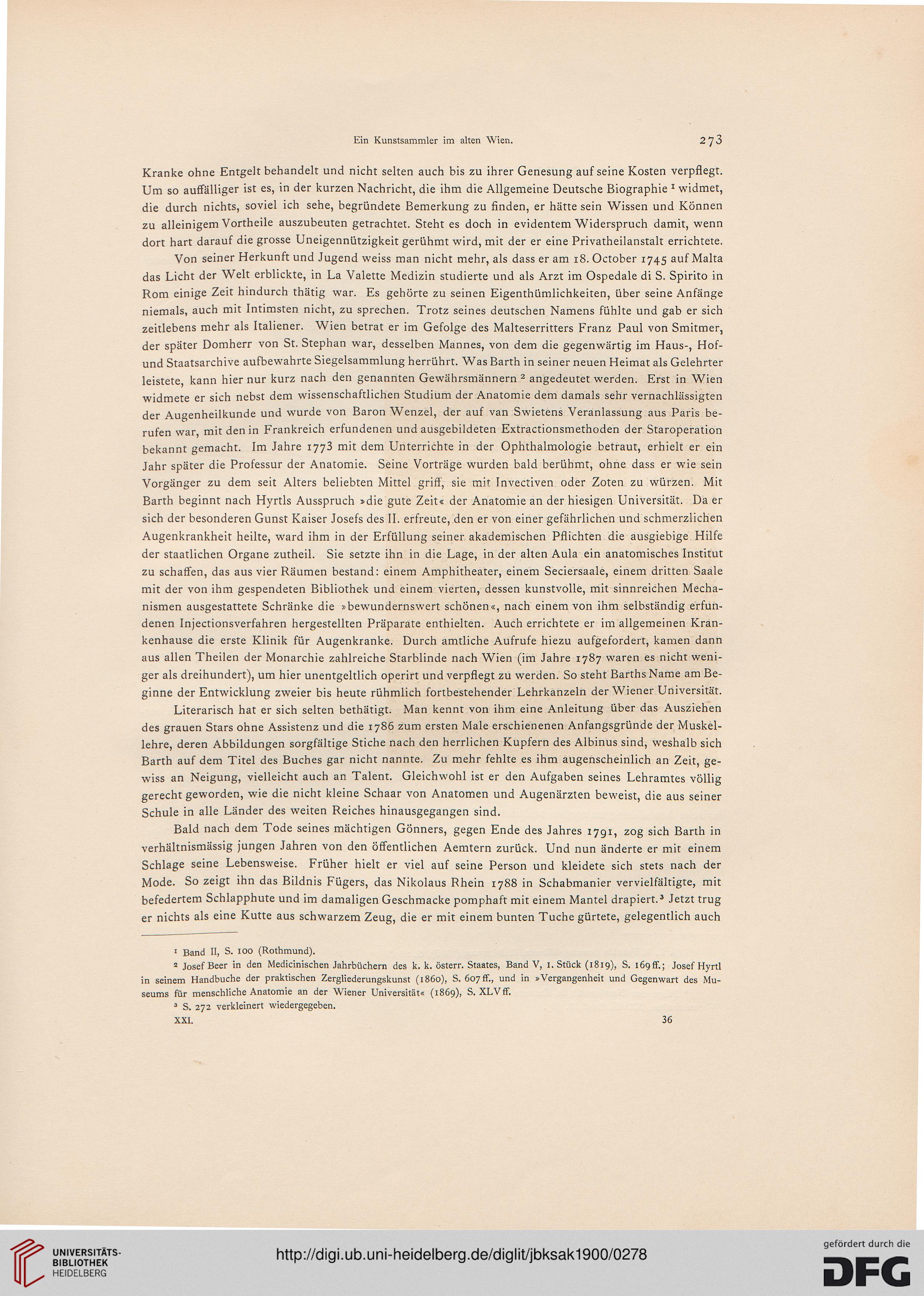Ein Kunstsammler im alten Wien.
273
Kranke ohne Entgelt behandelt und nicht selten auch bis zu ihrer Genesung auf seine Kosten verpflegt.
Um so auffälliger ist es, in der kurzen Nachricht, die ihm die Allgemeine Deutsche Biographie 1 widmet,
die durch nichts, soviel ich sehe, begründete Bemerkung zu finden, er hätte sein Wissen und Können
zu alleinigem Vortheile auszubeuten getrachtet. Steht es doch in evidentem Widerspruch damit, wenn
dort hart darauf die grosse Uneigennützigkeit gerühmt wird, mit der er eine Privatheilanstalt errichtete.
Von seiner Herkunft und Jugend weiss man nicht mehr, als dass er am 18. October 1745 auf Malta
das Licht der Welt erblickte, in La Valette Medizin studierte und als Arzt im Ospedale di S. Spirito in
Rom einige Zeit hindurch thätig war. Es gehörte zu seinen Eigenthümlichkeiten, über seine Anfänge
niemals, auch mit Intimsten nicht, zu sprechen. Trotz seines deutschen Namens fühlte und gab er sich
zeitlebens mehr als Italiener. Wien betrat er im Gefolge des Malteserritters Franz Paul von Smitmer,
der später Domherr von St. Stephan war, desselben Mannes, von dem die gegenwärtig im Haus-, Hof-
und Staatsarchive aufbewahrte Siegelsammlung herrührt. Was Barth in seiner neuen Heimat als Gelehrter
leistete, kann hier nur kurz nach den genannten Gewährsmännern 2 angedeutet werden. Erst in Wien
widmete er sich nebst dem wissenschaftlichen Studium der Anatomie dem damals sehr vernachlässigten
der Augenheilkunde und wurde von Baron Wenzel, der auf van Swietens Veranlassung aus Paris be-
rufen war, mit den in Frankreich erfundenen und ausgebildeten Extractionsmethoden der Staroperation
bekannt gemacht. Im Jahre 1773 mit dem Unterrichte in der Ophthalmologie betraut, erhielt er ein
Jahr später die Professur der Anatomie. Seine Vorträge wurden bald berühmt, ohne dass er wie sein
Vorgänger zu dem seit Alters beliebten Mittel griff, sie mit Invectiven oder Zoten zu würzen. Mit
Barth beginnt nach Hyrtls Ausspruch »die gute Zeit« der Anatomie an der hiesigen Universität. Da er
sich der besonderen Gunst Kaiser Josefs des II. erfreute, den er von einer gefährlichen und schmerzlichen
Augenkrankheit heilte, ward ihm in der Erfüllung seiner akademischen Pflichten die ausgiebige Hilfe
der staatlichen Organe zutheil. Sie setzte ihn in die Lage, in der alten Aula ein anatomisches Institut
zu schaffen, das aus vier Räumen bestand: einem Amphitheater, einem Seciersaale, einem dritten Saale
mit der von ihm gespendeten Bibliothek und einem vierten, dessen kunstvolle, mit sinnreichen Mecha-
nismen ausgestattete Schränke die »bewundernswert schönen«, nach einem von ihm selbständig erfun-
denen Injectionsverfahren hergestellten Präparate enthielten. Auch errichtete er im allgemeinen Kran-
kenhause die erste Klinik für Augenkranke. Durch amtliche Aufrufe hiezu aufgefordert, kamen dann
aus allen Theilen der Monarchie zahlreiche Starblinde nach Wien (im Jahre 1787 waren es nicht weni-
ger als dreihundert), um hier unentgeltlich operirt und verpflegt zu werden. So steht Barths Name am Be-
ginne der Entwicklung zweier bis heute rühmlich fortbestehender Lehrkanzeln der Wiener Universität.
Literarisch hat er sich selten bethätigt. Man kennt von ihm eine Anleitung über das Ausziehen
des grauen Stars ohne Assistenz und die 1786 zum ersten Male erschienenen Anfangsgründe der Muskel-
lehre, deren Abbildungen sorgfältige Stiche nach den herrlichen Kupfern des Albinus sind, weshalb sich
Barth auf dem Titel des Buches gar nicht nannte. Zu mehr fehlte es ihm augenscheinlich an Zeit, ge-
wiss an Neigung, vielleicht auch an Talent. Gleichwohl ist er den Aufgaben seines Lehramtes völlig
gerecht geworden, wie die nicht kleine Schaar von Anatomen und Augenärzten beweist, die aus seiner
Schule in alle Länder des weiten Reiches hinausgegangen sind.
Bald nach dem Tode seines mächtigen Gönners, gegen Ende des Jahres 1791, zog sich Barth in
verhältnismässig jungen Jahren von den Öffentlichen Aemtern zurück. Und nun änderte er mit einem
Schlage seine Lebensweise. Früher hielt er viel auf seine Person und kleidete sich stets nach der
Mode. So zeigt ihn das Bildnis Fügers, das Nikolaus Rhein 1788 in Schabmanier vervielfältigte, mit
befedertem Schlapphute und im damaligen Geschmacke pomphaft mit einem Mantel drapiert.3 Jetzt trug
er nichts als eine Kutte aus schwarzem Zeug, die er mit einem bunten Tuche gürtete, gelegentlich auch
1 Band II, S. 100 (Rothmund).
2 Josef Beer in den Medicinischen Jahrbüchern des k. k. österr. Staates, Band V, 1. Stück (1819), S. 169ff.; Josef Hyrtl
in seinem Handbuche der praktischen Zergliederungskunst (1860), S. 607 ff., und in »Vergangenheit und Gegenwart des Mu-
seums für menschliche Anatomie an der Wiener Universität« (1869), S. XLVff.
3 S. 272 verkleinert wiedergegeben.
XXI. 36
273
Kranke ohne Entgelt behandelt und nicht selten auch bis zu ihrer Genesung auf seine Kosten verpflegt.
Um so auffälliger ist es, in der kurzen Nachricht, die ihm die Allgemeine Deutsche Biographie 1 widmet,
die durch nichts, soviel ich sehe, begründete Bemerkung zu finden, er hätte sein Wissen und Können
zu alleinigem Vortheile auszubeuten getrachtet. Steht es doch in evidentem Widerspruch damit, wenn
dort hart darauf die grosse Uneigennützigkeit gerühmt wird, mit der er eine Privatheilanstalt errichtete.
Von seiner Herkunft und Jugend weiss man nicht mehr, als dass er am 18. October 1745 auf Malta
das Licht der Welt erblickte, in La Valette Medizin studierte und als Arzt im Ospedale di S. Spirito in
Rom einige Zeit hindurch thätig war. Es gehörte zu seinen Eigenthümlichkeiten, über seine Anfänge
niemals, auch mit Intimsten nicht, zu sprechen. Trotz seines deutschen Namens fühlte und gab er sich
zeitlebens mehr als Italiener. Wien betrat er im Gefolge des Malteserritters Franz Paul von Smitmer,
der später Domherr von St. Stephan war, desselben Mannes, von dem die gegenwärtig im Haus-, Hof-
und Staatsarchive aufbewahrte Siegelsammlung herrührt. Was Barth in seiner neuen Heimat als Gelehrter
leistete, kann hier nur kurz nach den genannten Gewährsmännern 2 angedeutet werden. Erst in Wien
widmete er sich nebst dem wissenschaftlichen Studium der Anatomie dem damals sehr vernachlässigten
der Augenheilkunde und wurde von Baron Wenzel, der auf van Swietens Veranlassung aus Paris be-
rufen war, mit den in Frankreich erfundenen und ausgebildeten Extractionsmethoden der Staroperation
bekannt gemacht. Im Jahre 1773 mit dem Unterrichte in der Ophthalmologie betraut, erhielt er ein
Jahr später die Professur der Anatomie. Seine Vorträge wurden bald berühmt, ohne dass er wie sein
Vorgänger zu dem seit Alters beliebten Mittel griff, sie mit Invectiven oder Zoten zu würzen. Mit
Barth beginnt nach Hyrtls Ausspruch »die gute Zeit« der Anatomie an der hiesigen Universität. Da er
sich der besonderen Gunst Kaiser Josefs des II. erfreute, den er von einer gefährlichen und schmerzlichen
Augenkrankheit heilte, ward ihm in der Erfüllung seiner akademischen Pflichten die ausgiebige Hilfe
der staatlichen Organe zutheil. Sie setzte ihn in die Lage, in der alten Aula ein anatomisches Institut
zu schaffen, das aus vier Räumen bestand: einem Amphitheater, einem Seciersaale, einem dritten Saale
mit der von ihm gespendeten Bibliothek und einem vierten, dessen kunstvolle, mit sinnreichen Mecha-
nismen ausgestattete Schränke die »bewundernswert schönen«, nach einem von ihm selbständig erfun-
denen Injectionsverfahren hergestellten Präparate enthielten. Auch errichtete er im allgemeinen Kran-
kenhause die erste Klinik für Augenkranke. Durch amtliche Aufrufe hiezu aufgefordert, kamen dann
aus allen Theilen der Monarchie zahlreiche Starblinde nach Wien (im Jahre 1787 waren es nicht weni-
ger als dreihundert), um hier unentgeltlich operirt und verpflegt zu werden. So steht Barths Name am Be-
ginne der Entwicklung zweier bis heute rühmlich fortbestehender Lehrkanzeln der Wiener Universität.
Literarisch hat er sich selten bethätigt. Man kennt von ihm eine Anleitung über das Ausziehen
des grauen Stars ohne Assistenz und die 1786 zum ersten Male erschienenen Anfangsgründe der Muskel-
lehre, deren Abbildungen sorgfältige Stiche nach den herrlichen Kupfern des Albinus sind, weshalb sich
Barth auf dem Titel des Buches gar nicht nannte. Zu mehr fehlte es ihm augenscheinlich an Zeit, ge-
wiss an Neigung, vielleicht auch an Talent. Gleichwohl ist er den Aufgaben seines Lehramtes völlig
gerecht geworden, wie die nicht kleine Schaar von Anatomen und Augenärzten beweist, die aus seiner
Schule in alle Länder des weiten Reiches hinausgegangen sind.
Bald nach dem Tode seines mächtigen Gönners, gegen Ende des Jahres 1791, zog sich Barth in
verhältnismässig jungen Jahren von den Öffentlichen Aemtern zurück. Und nun änderte er mit einem
Schlage seine Lebensweise. Früher hielt er viel auf seine Person und kleidete sich stets nach der
Mode. So zeigt ihn das Bildnis Fügers, das Nikolaus Rhein 1788 in Schabmanier vervielfältigte, mit
befedertem Schlapphute und im damaligen Geschmacke pomphaft mit einem Mantel drapiert.3 Jetzt trug
er nichts als eine Kutte aus schwarzem Zeug, die er mit einem bunten Tuche gürtete, gelegentlich auch
1 Band II, S. 100 (Rothmund).
2 Josef Beer in den Medicinischen Jahrbüchern des k. k. österr. Staates, Band V, 1. Stück (1819), S. 169ff.; Josef Hyrtl
in seinem Handbuche der praktischen Zergliederungskunst (1860), S. 607 ff., und in »Vergangenheit und Gegenwart des Mu-
seums für menschliche Anatomie an der Wiener Universität« (1869), S. XLVff.
3 S. 272 verkleinert wiedergegeben.
XXI. 36