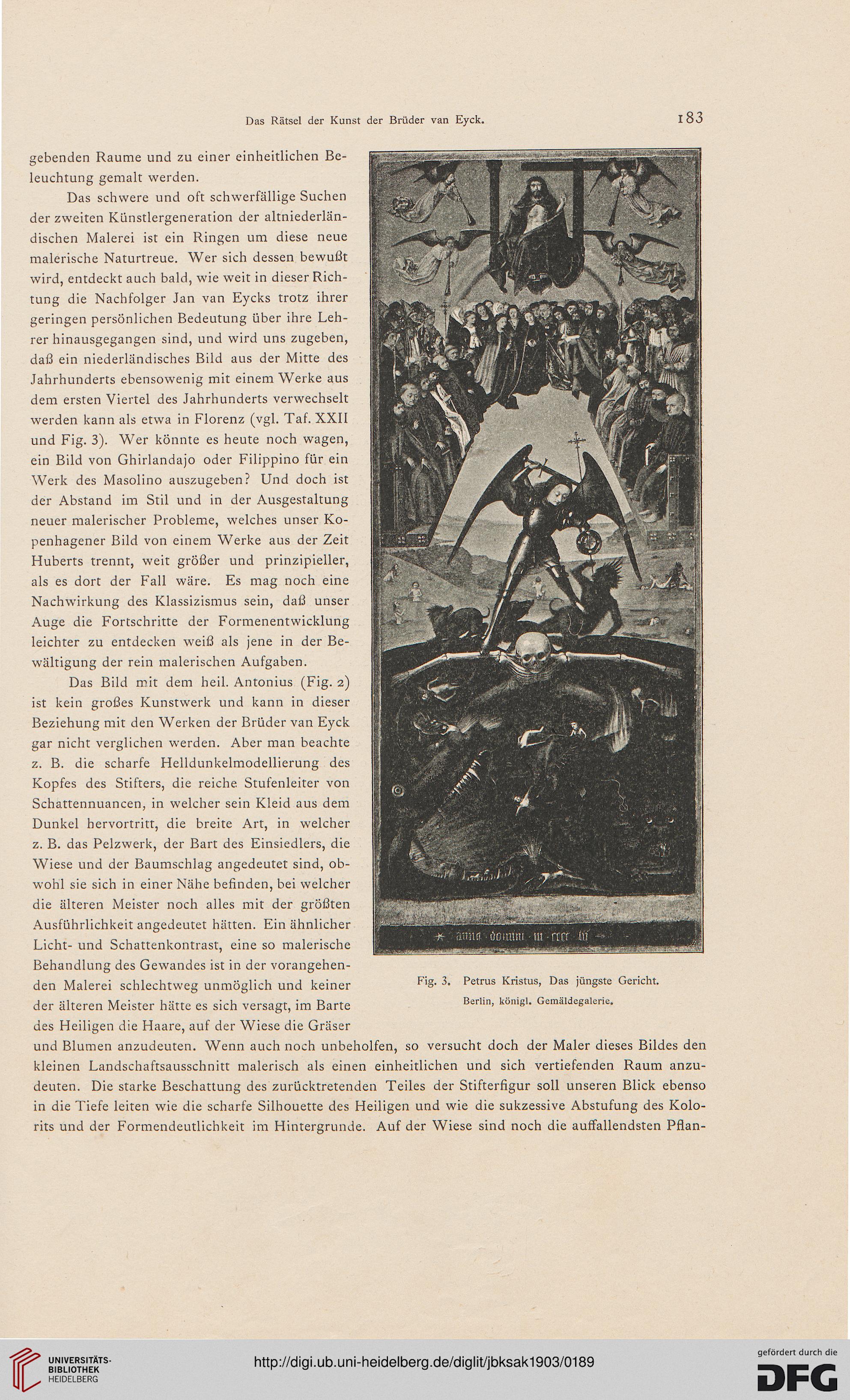Das Rätsel der Kunst der Brüder van Eyck.
i83
gebenden Räume und zu einer einheitlichen Be-
leuchtung gemalt werden.
Das schwere und oft schwerfällige Suchen
der zweiten Künstlergeneration der altniederlän-
dischen Malerei ist ein Ringen um diese neue
malerische Naturtreue. Wer sich dessen bewußt
wird, entdeckt auch bald, wie weit in dieser Rich-
tung die Nachfolger Jan van Eycks trotz ihrer
geringen persönlichen Bedeutung über ihre Leh-
rer hinausgegangen sind, und wird uns zugeben,
daß ein niederländisches Bild aus der Mitte des
Jahrhunderts ebensowenig mit einem Werke aus
dem ersten Viertel des Jahrhunderts verwechselt
werden kann als etwa in Florenz (vgl. Taf. XXII
und Fig. 3). Wer könnte es heute noch wagen,
ein Bild von Ghirlandajo oder Filippino für ein
Werk des Masolino auszugeben? Und doch ist
der Abstand im Stil und in der Ausgestaltung
neuer malerischer Probleme, welches unser Ko-
penhagener Bild von einem Werke aus der Zeit
Huberts trennt, weit größer und prinzipieller,
als es dort der Fall wäre. Es mag noch eine
Nachwirkung des Klassizismus sein, daß unser
Auge die Fortschritte der Formenentwicklung
leichter zu entdecken weiß als jene in der Be-
wältigung der rein malerischen Aufgaben.
Das Bild mit dem heil. Antonius (Fig. 2)
ist kein großes Kunstwerk und kann in dieser
Beziehung mit den Werken der Brüder van Eyck
gar nicht verglichen werden. Aber man beachte
z. B. die scharfe Helldunkelmodellierung des
Kopfes des Stifters, die reiche. Stufenleiter von
Schattennuancen, in welcher sein Kleid aus dem
Dunkel hervortritt, die breite Art, in welcher
z. B. das Pelzwerk, der Bart des Einsiedlers, die
Wiese und der Baumschlag angedeutet sind, ob-
wohl sie sich in einer Nähe befinden, bei welcher
die älteren Meister noch alles mit der größten
Ausführlichkeit angedeutet hätten. Ein ähnlicher
Licht- und Schattenkontrast, eine so malerische
Behandlung des Gewandes ist in der vorangehen-
den Malerei schlechtweg unmöglich und keiner
der älteren Meister hätte es sich versagt, im Barte
des Heiligen die Haare, auf der Wiese die Gräser
und Blumen anzudeuten. Wenn auch noch unbeholfen, so versucht doch der Maler dieses Bildes den
kleinen Landschaftsausschnitt malerisch als einen einheitlichen und sich vertiefenden Raum anzu-
deuten. Die starke Beschattung des zurücktretenden Teiles der Stifterfigur soll unseren Blick ebenso
in die Tiefe leiten wie die scharfe Silhouette des Heiligen und wie die sukzessive Abstufung des Kolo-
rits und der Formendeutlichkeit im Hintergrunde. Auf der Wiese sind noch die auffallendsten Pflan-
Fig. 3.
Petrus Kristus, Das jüngste Gericht.
Berlin, kÖnigl« Gemäldegalerie.
i83
gebenden Räume und zu einer einheitlichen Be-
leuchtung gemalt werden.
Das schwere und oft schwerfällige Suchen
der zweiten Künstlergeneration der altniederlän-
dischen Malerei ist ein Ringen um diese neue
malerische Naturtreue. Wer sich dessen bewußt
wird, entdeckt auch bald, wie weit in dieser Rich-
tung die Nachfolger Jan van Eycks trotz ihrer
geringen persönlichen Bedeutung über ihre Leh-
rer hinausgegangen sind, und wird uns zugeben,
daß ein niederländisches Bild aus der Mitte des
Jahrhunderts ebensowenig mit einem Werke aus
dem ersten Viertel des Jahrhunderts verwechselt
werden kann als etwa in Florenz (vgl. Taf. XXII
und Fig. 3). Wer könnte es heute noch wagen,
ein Bild von Ghirlandajo oder Filippino für ein
Werk des Masolino auszugeben? Und doch ist
der Abstand im Stil und in der Ausgestaltung
neuer malerischer Probleme, welches unser Ko-
penhagener Bild von einem Werke aus der Zeit
Huberts trennt, weit größer und prinzipieller,
als es dort der Fall wäre. Es mag noch eine
Nachwirkung des Klassizismus sein, daß unser
Auge die Fortschritte der Formenentwicklung
leichter zu entdecken weiß als jene in der Be-
wältigung der rein malerischen Aufgaben.
Das Bild mit dem heil. Antonius (Fig. 2)
ist kein großes Kunstwerk und kann in dieser
Beziehung mit den Werken der Brüder van Eyck
gar nicht verglichen werden. Aber man beachte
z. B. die scharfe Helldunkelmodellierung des
Kopfes des Stifters, die reiche. Stufenleiter von
Schattennuancen, in welcher sein Kleid aus dem
Dunkel hervortritt, die breite Art, in welcher
z. B. das Pelzwerk, der Bart des Einsiedlers, die
Wiese und der Baumschlag angedeutet sind, ob-
wohl sie sich in einer Nähe befinden, bei welcher
die älteren Meister noch alles mit der größten
Ausführlichkeit angedeutet hätten. Ein ähnlicher
Licht- und Schattenkontrast, eine so malerische
Behandlung des Gewandes ist in der vorangehen-
den Malerei schlechtweg unmöglich und keiner
der älteren Meister hätte es sich versagt, im Barte
des Heiligen die Haare, auf der Wiese die Gräser
und Blumen anzudeuten. Wenn auch noch unbeholfen, so versucht doch der Maler dieses Bildes den
kleinen Landschaftsausschnitt malerisch als einen einheitlichen und sich vertiefenden Raum anzu-
deuten. Die starke Beschattung des zurücktretenden Teiles der Stifterfigur soll unseren Blick ebenso
in die Tiefe leiten wie die scharfe Silhouette des Heiligen und wie die sukzessive Abstufung des Kolo-
rits und der Formendeutlichkeit im Hintergrunde. Auf der Wiese sind noch die auffallendsten Pflan-
Fig. 3.
Petrus Kristus, Das jüngste Gericht.
Berlin, kÖnigl« Gemäldegalerie.