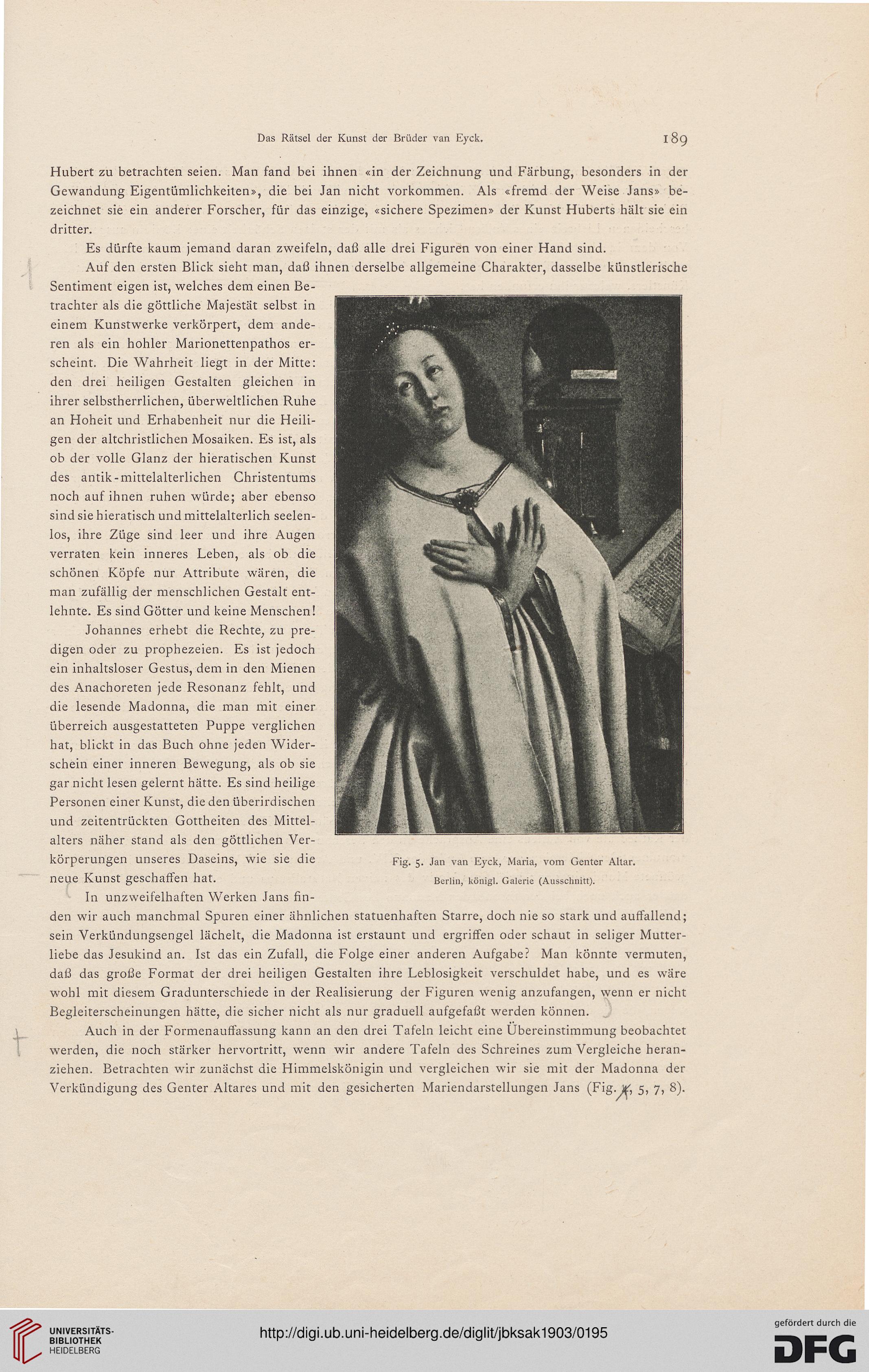Das Rätsel der Kunst der Brüder van Eyck.
189
Hubert zu betrachten seien. Man fand bei ihnen «in der Zeichnung und Färbung, besonders in der
Gewandung Eigentümlichkeiten», die bei Jan nicht vorkommen. Als «fremd der Weise Jans» be-
zeichnet sie ein anderer Forscher, für das einzige, «sichere Spezimen» der Kunst Huberts hält sie ein
dritter.
Es dürfte kaum jemand daran zweifeln, daß alle drei Figuren von einer Hand sind.
Auf den ersten Blick sieht man, daß ihnen derselbe allgemeine Charakter, dasselbe künstlerische
Sentiment eigen ist, welches dem einen Be-
trachter als die göttliche Majestät selbst in
einem Kunstwerke verkörpert, dem ande-
ren als ein hohler Marionettenpathos er-
scheint. Die Wahrheit liegt in der Mitte:
den drei heiligen Gestalten gleichen in
ihrer selbstherrlichen, überweltlichen Ruhe
an Hoheit und Erhabenheit nur die Heili-
gen der altchristlichen Mosaiken. Es ist, als
ob der volle Glanz der hieratischen Kunst
des antik-mittelalterlichen Christentums
noch auf ihnen ruhen würde; aber ebenso
sind sie hieratisch und mittelalterlich seelen-
los, ihre Züge sind leer und ihre Augen
verraten kein inneres Leben, als ob die
schönen Köpfe nur Attribute wären, die
man zufällig der menschlichen Gestalt ent-
lehnte. Es sind Götter und keine Menschen!
Johannes erhebt die Rechte; zu pre-
digen oder zu prophezeien. Es ist jedoch
ein inhaltsloser Gestus, dem in den Mienen
des Anachoreten jede Resonanz fehlt, und
die lesende Madonna, die man mit einer
überreich ausgestatteten Puppe verglichen
hat, blickt in das Buch ohne jeden Wider-
schein einer inneren Bewegung, als ob sie
gar nicht lesen gelernt hätte. Es sind heilige
Personen einer Kunst, die den überirdischen
und zeitentrückten Gottheiten des Mittel-
alters näher stand als den göttlichen Ver-
körperungen unseres Daseins, wie sie die
neue Kunst geschaffen hat.
In unzweifelhaften Werken Jans fin-
den wir auch manchmal Spuren einer ähnlichen statuenhaften Starre, doch nie so stark und auffallend;
sein Verkündungsengel lächelt, die Madonna ist erstaunt und ergriffen oder schaut in seliger Mutter-
liebe das Jesukind an. Ist das ein Zufall, die Folge einer anderen Aufgabe? Man könnte vermuten,
daß das große Format der drei heiligen Gestalten ihre Leblosigkeit verschuldet habe, und es wäre
wohl mit diesem Gradunterschiede in der Realisierung der Figuren wenig anzufangen, wenn er nicht
Begleiterscheinungen hätte, die sicher nicht als nur graduell aufgefaßt werden können.
Auch in der Formenauffassung kann an den drei Tafeln leicht eine Ubereinstimmung beobachtet
werden, die noch stärker hervortritt, wenn wir andere Tafeln des Schreines zum Vergleiche heran-
ziehen. Betrachten wir zunächst die Himmelskönigin und vergleichen wir sie mit der Madonna der
Verkündigung des Genter Altares und mit den gesicherten Mariendarstellungen Jans (Fig.^, 5, 7, 8).
Fig. 5. Jan van Eyck, Maria, vom Genter Altar.
Berlin, königl. Galerie (Ausschnitt).
189
Hubert zu betrachten seien. Man fand bei ihnen «in der Zeichnung und Färbung, besonders in der
Gewandung Eigentümlichkeiten», die bei Jan nicht vorkommen. Als «fremd der Weise Jans» be-
zeichnet sie ein anderer Forscher, für das einzige, «sichere Spezimen» der Kunst Huberts hält sie ein
dritter.
Es dürfte kaum jemand daran zweifeln, daß alle drei Figuren von einer Hand sind.
Auf den ersten Blick sieht man, daß ihnen derselbe allgemeine Charakter, dasselbe künstlerische
Sentiment eigen ist, welches dem einen Be-
trachter als die göttliche Majestät selbst in
einem Kunstwerke verkörpert, dem ande-
ren als ein hohler Marionettenpathos er-
scheint. Die Wahrheit liegt in der Mitte:
den drei heiligen Gestalten gleichen in
ihrer selbstherrlichen, überweltlichen Ruhe
an Hoheit und Erhabenheit nur die Heili-
gen der altchristlichen Mosaiken. Es ist, als
ob der volle Glanz der hieratischen Kunst
des antik-mittelalterlichen Christentums
noch auf ihnen ruhen würde; aber ebenso
sind sie hieratisch und mittelalterlich seelen-
los, ihre Züge sind leer und ihre Augen
verraten kein inneres Leben, als ob die
schönen Köpfe nur Attribute wären, die
man zufällig der menschlichen Gestalt ent-
lehnte. Es sind Götter und keine Menschen!
Johannes erhebt die Rechte; zu pre-
digen oder zu prophezeien. Es ist jedoch
ein inhaltsloser Gestus, dem in den Mienen
des Anachoreten jede Resonanz fehlt, und
die lesende Madonna, die man mit einer
überreich ausgestatteten Puppe verglichen
hat, blickt in das Buch ohne jeden Wider-
schein einer inneren Bewegung, als ob sie
gar nicht lesen gelernt hätte. Es sind heilige
Personen einer Kunst, die den überirdischen
und zeitentrückten Gottheiten des Mittel-
alters näher stand als den göttlichen Ver-
körperungen unseres Daseins, wie sie die
neue Kunst geschaffen hat.
In unzweifelhaften Werken Jans fin-
den wir auch manchmal Spuren einer ähnlichen statuenhaften Starre, doch nie so stark und auffallend;
sein Verkündungsengel lächelt, die Madonna ist erstaunt und ergriffen oder schaut in seliger Mutter-
liebe das Jesukind an. Ist das ein Zufall, die Folge einer anderen Aufgabe? Man könnte vermuten,
daß das große Format der drei heiligen Gestalten ihre Leblosigkeit verschuldet habe, und es wäre
wohl mit diesem Gradunterschiede in der Realisierung der Figuren wenig anzufangen, wenn er nicht
Begleiterscheinungen hätte, die sicher nicht als nur graduell aufgefaßt werden können.
Auch in der Formenauffassung kann an den drei Tafeln leicht eine Ubereinstimmung beobachtet
werden, die noch stärker hervortritt, wenn wir andere Tafeln des Schreines zum Vergleiche heran-
ziehen. Betrachten wir zunächst die Himmelskönigin und vergleichen wir sie mit der Madonna der
Verkündigung des Genter Altares und mit den gesicherten Mariendarstellungen Jans (Fig.^, 5, 7, 8).
Fig. 5. Jan van Eyck, Maria, vom Genter Altar.
Berlin, königl. Galerie (Ausschnitt).