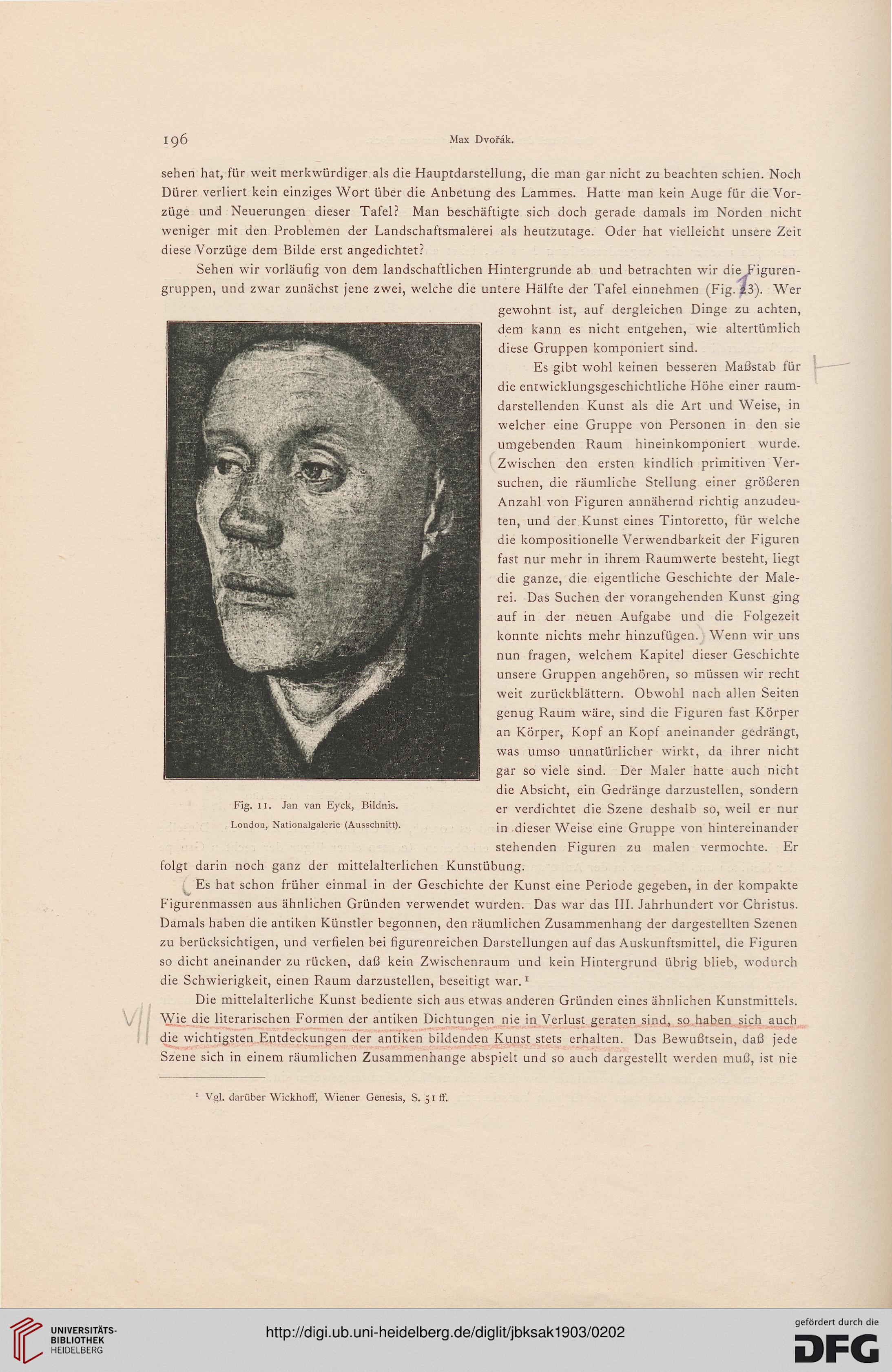I g6 Max Dvorak.
sehen hat, für weit merkwürdiger als die Hauptdarstellung, die man gar nicht zu beachten schien. Noch
Dürer verliert kein einziges Wort über die Anbetung des Lammes. Hatte man kein Auge für die Vor-
züge und Neuerungen dieser Tafel? Man beschäftigte sich doch gerade damals im Norden nicht
weniger mit den Problemen der Landschaftsmalerei als heutzutage. Oder hat vielleicht unsere Zeit
diese Vorzüge dem Bilde erst angedichtet?
Sehen wir vorläufig von dem landschaftlichen Hintergrunde ab und betrachten wir die Figuren-
gruppen, und zwar zunächst jene zwei, welche die untere Hälfte der Tafel einnehmen (Fig. 13). Wer
gewohnt ist, auf dergleichen Dinge zu achten,
dem kann es nicht entgehen, wie altertümlich
diese Gruppen komponiert sind.
Es gibt wohl keinen besseren Maßstab für
die entwicklungsgeschichtliche Höhe einer raum-
darstellenden Kunst als die Art und Weise, in
welcher eine Gruppe von Personen in den sie
umgebenden Raum hineinkomponiert wurde.
Zwischen den ersten kindlich primitiven Ver-
suchen, die räumliche Stellung einer größeren
Anzahl von Figuren annähernd richtig anzudeu-
ten, und der Kunst eines Tintoretto, für welche
die kompositioneile Verwendbarkeit der Figuren
fast nur mehr in ihrem Raumwerte besteht, liegt
die ganze, die eigentliche Geschichte der Male-
rei. Das Suchen der vorangehenden Kunst ging
auf in der neuen Aufgabe und die Folgezeit
konnte nichts mehr hinzufügen. Wenn wir uns
nun fragen, welchem Kapitel dieser Geschichte
unsere Gruppen angehören, so müssen wir recht
weit zurückblättern. Obwohl nach allen Seiten
genug Raum wäre, sind die Figuren fast Körper
an Körper, Kopf an Kopf aneinander gedrängt,
was umso unnatürlicher wirkt, da ihrer nicht
gar so viele sind. Der Maler hatte auch nicht
die Absicht, ein Gedränge darzustellen, sondern
Fig. i.i. Jan van Eyck, Bildnis. er verdichtet die Szene deshalb so, weil er nur
London, Nationalgalerie (Ausschnitt). jn dieser Weise eine Gruppe von hintereinander
stehenden Figuren zu malen vermochte. Er
folgt darin noch ganz der mittelalterlichen Kunstübung.
Es hat schon früher einmal in der Geschichte der Kunst eine Periode gegeben, in der kompakte
Figurenmassen aus ähnlichen Gründen verwendet wurden. Das war das III. Jahrhundert vor Christus.
Damals haben die antiken Künstler begonnen, den räumlichen Zusammenhang der dargestellten Szenen
zu berücksichtigen, und verfielen bei figurenreichen Darstellungen auf das Auskunftsmittel, die Figuren
so dicht aneinander zu rücken, daß kein Zwischenraum und kein Hintergrund übrig blieb, wodurch
die Schwierigkeit, einen Raum darzustellen, beseitigt war.1
Die mittelalterliche Kunst bediente sich aus etwas anderen Gründen eines ähnlichen Kunstmittels.
Wie die literarischen Formen der antiken Dichtungen nie in Verlust geraten sind, so haben sich auch
die wichtigsten Entdeckungen der antiken bildenden Kunst stets erhalten. Das Bewußtsein, daß jede
Szene sich in einem räumlichen Zusammenhange abspielt und so auch dargestellt werden muß, ist nie
1 Vgl. darüber Wickhoft', Wiener Genesis, S. 51 ft'.
sehen hat, für weit merkwürdiger als die Hauptdarstellung, die man gar nicht zu beachten schien. Noch
Dürer verliert kein einziges Wort über die Anbetung des Lammes. Hatte man kein Auge für die Vor-
züge und Neuerungen dieser Tafel? Man beschäftigte sich doch gerade damals im Norden nicht
weniger mit den Problemen der Landschaftsmalerei als heutzutage. Oder hat vielleicht unsere Zeit
diese Vorzüge dem Bilde erst angedichtet?
Sehen wir vorläufig von dem landschaftlichen Hintergrunde ab und betrachten wir die Figuren-
gruppen, und zwar zunächst jene zwei, welche die untere Hälfte der Tafel einnehmen (Fig. 13). Wer
gewohnt ist, auf dergleichen Dinge zu achten,
dem kann es nicht entgehen, wie altertümlich
diese Gruppen komponiert sind.
Es gibt wohl keinen besseren Maßstab für
die entwicklungsgeschichtliche Höhe einer raum-
darstellenden Kunst als die Art und Weise, in
welcher eine Gruppe von Personen in den sie
umgebenden Raum hineinkomponiert wurde.
Zwischen den ersten kindlich primitiven Ver-
suchen, die räumliche Stellung einer größeren
Anzahl von Figuren annähernd richtig anzudeu-
ten, und der Kunst eines Tintoretto, für welche
die kompositioneile Verwendbarkeit der Figuren
fast nur mehr in ihrem Raumwerte besteht, liegt
die ganze, die eigentliche Geschichte der Male-
rei. Das Suchen der vorangehenden Kunst ging
auf in der neuen Aufgabe und die Folgezeit
konnte nichts mehr hinzufügen. Wenn wir uns
nun fragen, welchem Kapitel dieser Geschichte
unsere Gruppen angehören, so müssen wir recht
weit zurückblättern. Obwohl nach allen Seiten
genug Raum wäre, sind die Figuren fast Körper
an Körper, Kopf an Kopf aneinander gedrängt,
was umso unnatürlicher wirkt, da ihrer nicht
gar so viele sind. Der Maler hatte auch nicht
die Absicht, ein Gedränge darzustellen, sondern
Fig. i.i. Jan van Eyck, Bildnis. er verdichtet die Szene deshalb so, weil er nur
London, Nationalgalerie (Ausschnitt). jn dieser Weise eine Gruppe von hintereinander
stehenden Figuren zu malen vermochte. Er
folgt darin noch ganz der mittelalterlichen Kunstübung.
Es hat schon früher einmal in der Geschichte der Kunst eine Periode gegeben, in der kompakte
Figurenmassen aus ähnlichen Gründen verwendet wurden. Das war das III. Jahrhundert vor Christus.
Damals haben die antiken Künstler begonnen, den räumlichen Zusammenhang der dargestellten Szenen
zu berücksichtigen, und verfielen bei figurenreichen Darstellungen auf das Auskunftsmittel, die Figuren
so dicht aneinander zu rücken, daß kein Zwischenraum und kein Hintergrund übrig blieb, wodurch
die Schwierigkeit, einen Raum darzustellen, beseitigt war.1
Die mittelalterliche Kunst bediente sich aus etwas anderen Gründen eines ähnlichen Kunstmittels.
Wie die literarischen Formen der antiken Dichtungen nie in Verlust geraten sind, so haben sich auch
die wichtigsten Entdeckungen der antiken bildenden Kunst stets erhalten. Das Bewußtsein, daß jede
Szene sich in einem räumlichen Zusammenhange abspielt und so auch dargestellt werden muß, ist nie
1 Vgl. darüber Wickhoft', Wiener Genesis, S. 51 ft'.