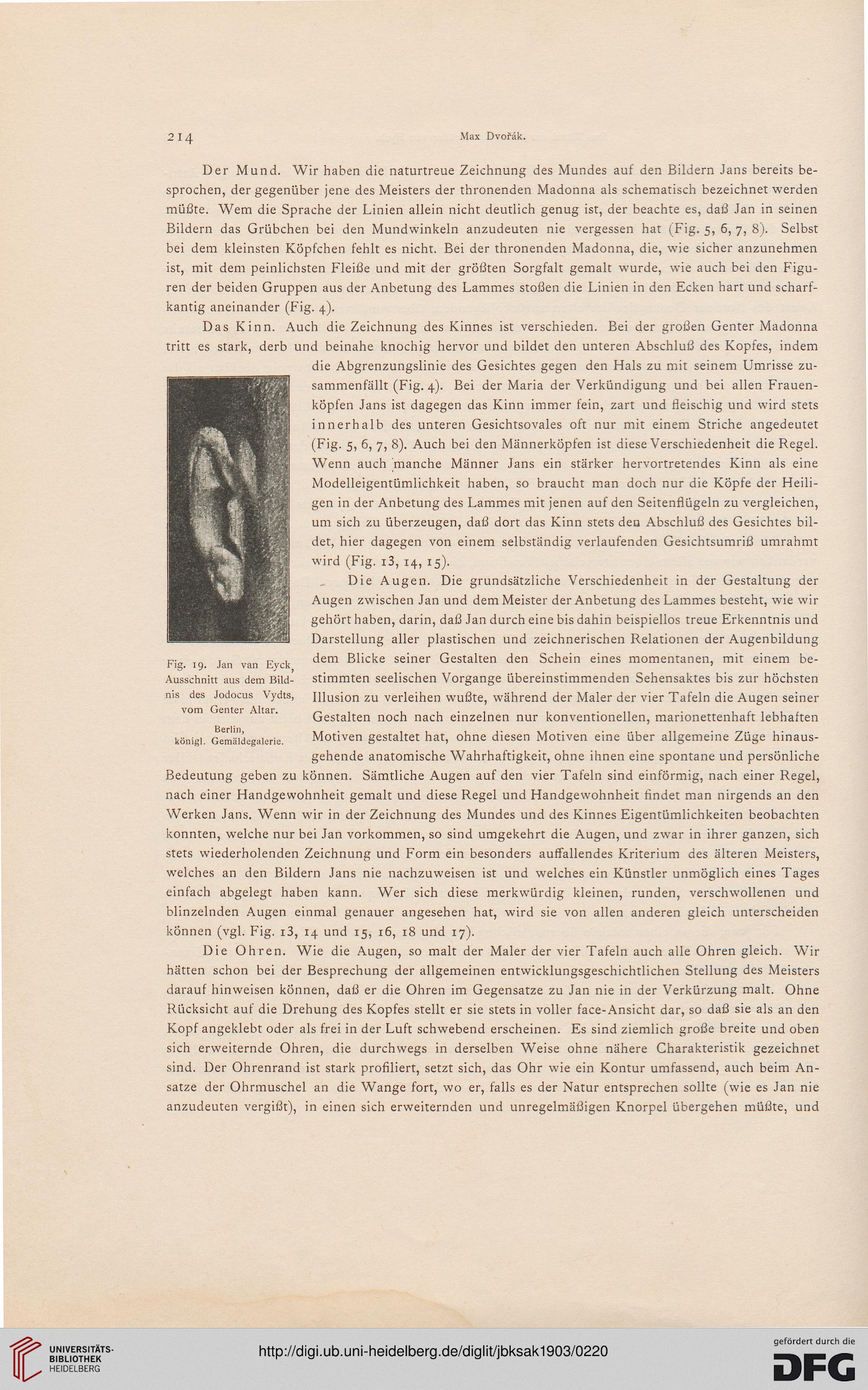2I4
Max Dvofak.
Der Mund. Wir haben die naturtreue Zeichnung des Mundes auf den Bildern Jans bereits be-
sprochen, der gegenüber jene des Meisters der thronenden Madonna als schematisch bezeichnet werden
müßte. Wem die Sprache der Linien allein nicht deutlich genug ist, der beachte es, daß Jan in seinen
Bildern das Grübchen bei den Mundwinkeln anzudeuten nie vergessen hat (Fig. 5, 6, 7, 8). Selbst
bei dem kleinsten Köpfchen fehlt es nicht. Bei der thronenden Madonna, die, wie sicher anzunehmen
ist, mit dem peinlichsten Fleiße und mit der größten Sorgfalt gemalt wurde, wie auch bei den Figu-
ren der beiden Gruppen aus der Anbetung des Lammes stoßen die Linien in den Ecken hart und scharf-
kantig aneinander (Fig. 4).
Das Kinn. Auch die Zeichnung des Kinnes ist verschieden. Bei der großen Genter Madonna
tritt es stark, derb und beinahe knochig hervor und bildet den unteren Abschluß des Kopfes, indem
die Abgrenzungslinie des Gesichtes gegen den Hals zu mit seinem Umrisse zu-
sammenfällt (Fig. 4). Bei der Maria der Verkündigung und bei allen Frauen-
köpfen Jans ist dagegen das Kinn immer fein, zart und fleischig und wird stets
innerhalb des unteren Gesichtsovales oft nur mit einem Striche angedeutet
(Fig. 5, 6, 7, 8). Auch bei den Männerköpfen ist diese Verschiedenheit die Regel.
Wenn auch manche Männer Jans ein stärker hervortretendes Kinn als eine
Modelleigentümlichkeit haben, so braucht man doch nur die Köpfe der Heili-
gen in der Anbetung des Lammes mit jenen auf den Seitenflügeln zu vergleichen,
um sich zu überzeugen, daß dort das Kinn stets den Abschluß des Gesichtes bil-
det, hier dagegen von einem selbständig verlaufenden Gesichtsumriß umrahmt
wird (Fig. i3, 14, 15).
Die Augen. Die grundsätzliche Verschiedenheit in der Gestaltung der
Augen zwischen Jan und dem Meister der Anbetung des Lammes besteht, wie wir
gehört haben, darin, daß Jan durch eine bis dahin beispiellos treue Erkenntnis und
Darstellung aller plastischen und zeichnerischen Relationen der Augenbildung
dem Blicke seiner Gestalten den Schein eines momentanen, mit einem be-
stimmten seelischen Vorgange übereinstimmenden Sehensaktes bis zur höchsten
Illusion zu verleihen wußte, während der Maler der vier Tafeln die Augen seiner
Gestalten noch nach einzelnen nur konventionellen, marionettenhaft lebhaften
Motiven gestaltet hat, ohne diesen Motiven eine über allgemeine Züge hinaus-
gehende anatomische Wahrhaftigkeit, ohne ihnen eine spontane und persönliche
Bedeutung geben zu können. Sämtliche Augen auf den vier Tafeln sind einförmig, nach einer Regel,
nach einer Handgewohnheit gemalt und diese Regel und Handgewohnheit findet man nirgends an den
Werken Jans. Wenn wir in der Zeichnung des Mundes und des Kinnes Eigentümlichkeiten beobachten
konnten, welche nur bei Jan vorkommen, so sind umgekehrt die Augen, und zwar in ihrer ganzen, sich
stets wiederholenden Zeichnung und Form ein besonders auffallendes Kriterium des älteren Meisters,
welches an den Bildern Jans nie nachzuweisen ist und welches ein Künstler unmöglich eines Tages
einfach abgelegt haben kann. Wer sich diese merkwürdig kleinen, runden, verschwollenen und
blinzelnden Augen einmal genauer angesehen hat, wird sie von allen anderen gleich unterscheiden
können (vgl. Fig. i3, 14 und 15, 16, 18 und 17).
Die Ohren. Wie die Augen, so malt der Maler der vier Tafeln auch alle Ohren gleich. Wir
hätten schon bei der Besprechung der allgemeinen entwicklungsgeschichtlichen Stellung des Meisters
darauf hinweisen können, daß er die Ohren im Gegensatze zu Jan nie in der Verkürzung malt. Ohne
Rücksicht auf die Drehung des Kopfes stellt er sie stets in voller face-Ansicht dar, so daß sie als an den
Kopf angeklebt oder als frei in der Luft schwebend erscheinen. Es sind ziemlich große breite und oben
sich erweiternde Ohren, die durchwegs in derselben Weise ohne nähere Charakteristik gezeichnet
sind. Der Ohrenrand ist stark profiliert, setzt sich, das Ohr wie ein Kontur umfassend, auch beim An-
sätze der Ohrmuschel an die Wange fort, wo er, falls es der Natur entsprechen sollte (wie es Jan nie
anzudeuten vergißt), in einen sich erweiternden und unregelmäßigen Knorpel übergehen müßte, und
Fig. 19. Jan van Eyck
Ausschnitt aus dem Bild-
nis des Jodocus Vydts,
vom Genter Altar.
Berlin,
königl. Gemäldegalerie.
Max Dvofak.
Der Mund. Wir haben die naturtreue Zeichnung des Mundes auf den Bildern Jans bereits be-
sprochen, der gegenüber jene des Meisters der thronenden Madonna als schematisch bezeichnet werden
müßte. Wem die Sprache der Linien allein nicht deutlich genug ist, der beachte es, daß Jan in seinen
Bildern das Grübchen bei den Mundwinkeln anzudeuten nie vergessen hat (Fig. 5, 6, 7, 8). Selbst
bei dem kleinsten Köpfchen fehlt es nicht. Bei der thronenden Madonna, die, wie sicher anzunehmen
ist, mit dem peinlichsten Fleiße und mit der größten Sorgfalt gemalt wurde, wie auch bei den Figu-
ren der beiden Gruppen aus der Anbetung des Lammes stoßen die Linien in den Ecken hart und scharf-
kantig aneinander (Fig. 4).
Das Kinn. Auch die Zeichnung des Kinnes ist verschieden. Bei der großen Genter Madonna
tritt es stark, derb und beinahe knochig hervor und bildet den unteren Abschluß des Kopfes, indem
die Abgrenzungslinie des Gesichtes gegen den Hals zu mit seinem Umrisse zu-
sammenfällt (Fig. 4). Bei der Maria der Verkündigung und bei allen Frauen-
köpfen Jans ist dagegen das Kinn immer fein, zart und fleischig und wird stets
innerhalb des unteren Gesichtsovales oft nur mit einem Striche angedeutet
(Fig. 5, 6, 7, 8). Auch bei den Männerköpfen ist diese Verschiedenheit die Regel.
Wenn auch manche Männer Jans ein stärker hervortretendes Kinn als eine
Modelleigentümlichkeit haben, so braucht man doch nur die Köpfe der Heili-
gen in der Anbetung des Lammes mit jenen auf den Seitenflügeln zu vergleichen,
um sich zu überzeugen, daß dort das Kinn stets den Abschluß des Gesichtes bil-
det, hier dagegen von einem selbständig verlaufenden Gesichtsumriß umrahmt
wird (Fig. i3, 14, 15).
Die Augen. Die grundsätzliche Verschiedenheit in der Gestaltung der
Augen zwischen Jan und dem Meister der Anbetung des Lammes besteht, wie wir
gehört haben, darin, daß Jan durch eine bis dahin beispiellos treue Erkenntnis und
Darstellung aller plastischen und zeichnerischen Relationen der Augenbildung
dem Blicke seiner Gestalten den Schein eines momentanen, mit einem be-
stimmten seelischen Vorgange übereinstimmenden Sehensaktes bis zur höchsten
Illusion zu verleihen wußte, während der Maler der vier Tafeln die Augen seiner
Gestalten noch nach einzelnen nur konventionellen, marionettenhaft lebhaften
Motiven gestaltet hat, ohne diesen Motiven eine über allgemeine Züge hinaus-
gehende anatomische Wahrhaftigkeit, ohne ihnen eine spontane und persönliche
Bedeutung geben zu können. Sämtliche Augen auf den vier Tafeln sind einförmig, nach einer Regel,
nach einer Handgewohnheit gemalt und diese Regel und Handgewohnheit findet man nirgends an den
Werken Jans. Wenn wir in der Zeichnung des Mundes und des Kinnes Eigentümlichkeiten beobachten
konnten, welche nur bei Jan vorkommen, so sind umgekehrt die Augen, und zwar in ihrer ganzen, sich
stets wiederholenden Zeichnung und Form ein besonders auffallendes Kriterium des älteren Meisters,
welches an den Bildern Jans nie nachzuweisen ist und welches ein Künstler unmöglich eines Tages
einfach abgelegt haben kann. Wer sich diese merkwürdig kleinen, runden, verschwollenen und
blinzelnden Augen einmal genauer angesehen hat, wird sie von allen anderen gleich unterscheiden
können (vgl. Fig. i3, 14 und 15, 16, 18 und 17).
Die Ohren. Wie die Augen, so malt der Maler der vier Tafeln auch alle Ohren gleich. Wir
hätten schon bei der Besprechung der allgemeinen entwicklungsgeschichtlichen Stellung des Meisters
darauf hinweisen können, daß er die Ohren im Gegensatze zu Jan nie in der Verkürzung malt. Ohne
Rücksicht auf die Drehung des Kopfes stellt er sie stets in voller face-Ansicht dar, so daß sie als an den
Kopf angeklebt oder als frei in der Luft schwebend erscheinen. Es sind ziemlich große breite und oben
sich erweiternde Ohren, die durchwegs in derselben Weise ohne nähere Charakteristik gezeichnet
sind. Der Ohrenrand ist stark profiliert, setzt sich, das Ohr wie ein Kontur umfassend, auch beim An-
sätze der Ohrmuschel an die Wange fort, wo er, falls es der Natur entsprechen sollte (wie es Jan nie
anzudeuten vergißt), in einen sich erweiternden und unregelmäßigen Knorpel übergehen müßte, und
Fig. 19. Jan van Eyck
Ausschnitt aus dem Bild-
nis des Jodocus Vydts,
vom Genter Altar.
Berlin,
königl. Gemäldegalerie.