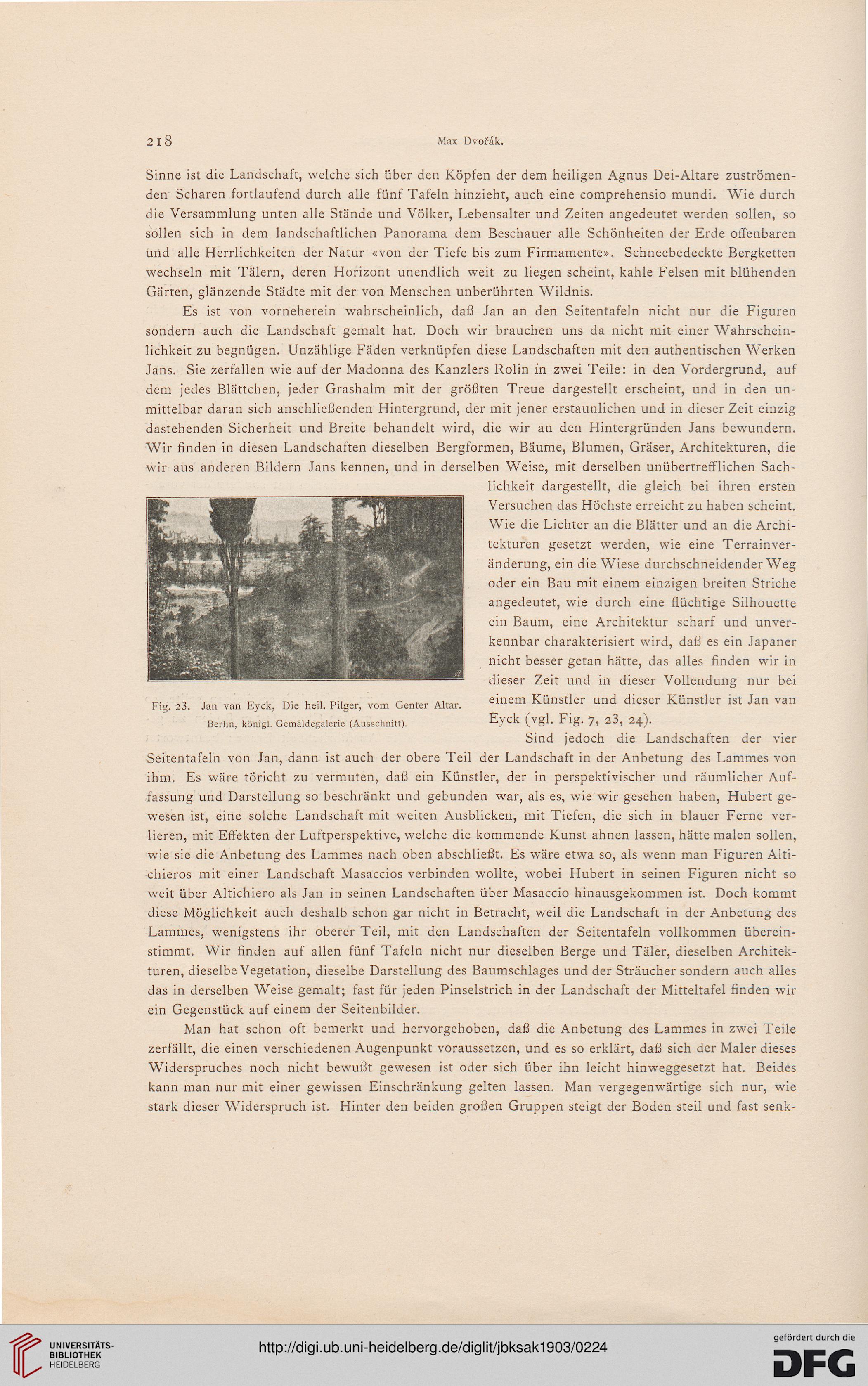218
Max Dvofäk.
Sinne ist die Landschaft, welche sich über den Köpfen der dem heiligen Agnus Dei-Altare zuströmen-
den Scharen fortlaufend durch alle fünf Tafeln hinzieht, auch eine comprehensio mundi. Wie durch
die Versammlung unten alle Stände und Völker, Lebensalter und Zeiten angedeutet werden sollen, so
sollen sich in dem landschaftlichen Panorama dem Beschauer alle Schönheiten der Erde offenbaren
und alle Herrlichkeiten der Natur «von der Tiefe bis zum Firmamente». Schneebedeckte Bergketten
wechseln mit Tälern, deren Horizont unendlich weit zu liegen scheint, kahle Felsen mit blühenden
Gärten, glänzende Städte mit der von Menschen unberührten Wildnis.
Es ist von vorneherein wahrscheinlich, daß Jan an den Seitentafeln nicht nur die Figuren
sondern auch die Landschaft gemalt hat. Doch wir brauchen uns da nicht mit einer Wahrschein-
lichkeit zu begnügen. Unzählige Fäden verknüpfen diese Landschaften mit den authentischen Werken
Jans. Sie zerfallen wie auf der Madonna des Kanzlers Rolin in zwei Teile: in den Vordergrund, auf
dem jedes Blättchen, jeder Grashalm mit der größten Treue dargestellt erscheint, und in den un-
mittelbar daran sich anschließenden Hintergrund, der mit jener erstaunlichen und in dieser Zeit einzig
dastehenden Sicherheit und Breite behandelt wird, die wir an den Hintergründen Jans bewundern.
Wir finden in diesen Landschaften dieselben Bergformen, Bäume, Blumen, Gräser, Architekturen, die
wir aus anderen Bildern Jans kennen, und in derselben Weise, mit derselben unübertrefflichen Sach-
lichkeit dargestellt, die gleich bei ihren ersten
Versuchen das Höchste erreicht zu haben scheint.
Wie die Lichter an die Blätter und an die Archi-
tekturen gesetzt werden, wie eine Terrainver-
änderung, ein die Wiese durchschneidender Weg
oder ein Bau mit einem einzigen breiten Striche
angedeutet, wie durch eine flüchtige Silhouette
ein Baum, eine Architektur scharf und unver-
kennbar charakterisiert wird, daß es ein Japaner
nicht besser getan hätte, das alles finden wir in
dieser Zeit und in dieser Vollendung nur bei
Fig. 23. Jan van Eyck, Die heil. Pilger, vom Genter Altar. einem Künstler und dieser Künstler ist Jan van
Berlin, königl. Gemäldegalerie (Ausschnitt). Eyck (vgl. Fig. 7, 23, 24).
Sind jedoch die Landschaften der vier
Seitentafeln von Jan, dann ist auch der obere Teil der Landschaft in der Anbetung des Lammes von
ihm. Es wäre töricht zu vermuten, daß ein Künstler, der in perspektivischer und räumlicher Auf-
fassung und Darstellung so beschränkt und gebunden war, als es, wie wir gesehen haben, Hubert ge-
wesen ist, eine solche Landschaft mit weiten Ausblicken, mit Tiefen, die sich in blauer Ferne ver-
lieren, mit Effekten der Luftperspektive, welche die kommende Kunst ahnen lassen, hätte malen sollen,
wie sie die Anbetung des Lammes nach oben abschließt. Es wäre etwa so, als wenn man Figuren Alti-
chieros mit einer Landschaft Masaccios verbinden wollte, wobei Hubert in seinen Figuren nicht so
weit über Altichiero als Jan in seinen Landschaften über Masaccio hinausgekommen ist. Doch kommt
diese Möglichkeit auch deshalb schon gar nicht in Betracht, weil die Landschaft in der Anbetung des
Lammes, wenigstens ihr oberer Teil, mit den Landschaften der Seitentafeln vollkommen überein-
stimmt. Wir finden auf allen fünf Tafeln nicht nur dieselben Berge und Täler, dieselben Architek-
turen, dieselbe Vegetation, dieselbe Darstellung des Baumschlages und der Sträucher sondern auch alles
das in derselben Weise gemalt; fast für jeden Pinselstrich in der Landschaft der Mitteltafel finden wir
ein Gegenstück auf einem der Seitenbilder.
Man hat schon oft bemerkt und hervorgehoben, daß die Anbetung des Lammes in zwei Teile
zerfällt, die einen verschiedenen Augenpunkt voraussetzen, und es so erklärt, daß sich der Maler dieses
Widerspruches noch nicht bewußt gewesen ist oder sich über ihn leicht hinweggesetzt hat. Beides
kann man nur mit einer gewissen Einschränkung gelten lassen. Man vergegenwärtige sich nur, wie
stark dieser Widerspruch ist. Hinter den beiden großen Gruppen steigt der Boden steil und fast senk-
Max Dvofäk.
Sinne ist die Landschaft, welche sich über den Köpfen der dem heiligen Agnus Dei-Altare zuströmen-
den Scharen fortlaufend durch alle fünf Tafeln hinzieht, auch eine comprehensio mundi. Wie durch
die Versammlung unten alle Stände und Völker, Lebensalter und Zeiten angedeutet werden sollen, so
sollen sich in dem landschaftlichen Panorama dem Beschauer alle Schönheiten der Erde offenbaren
und alle Herrlichkeiten der Natur «von der Tiefe bis zum Firmamente». Schneebedeckte Bergketten
wechseln mit Tälern, deren Horizont unendlich weit zu liegen scheint, kahle Felsen mit blühenden
Gärten, glänzende Städte mit der von Menschen unberührten Wildnis.
Es ist von vorneherein wahrscheinlich, daß Jan an den Seitentafeln nicht nur die Figuren
sondern auch die Landschaft gemalt hat. Doch wir brauchen uns da nicht mit einer Wahrschein-
lichkeit zu begnügen. Unzählige Fäden verknüpfen diese Landschaften mit den authentischen Werken
Jans. Sie zerfallen wie auf der Madonna des Kanzlers Rolin in zwei Teile: in den Vordergrund, auf
dem jedes Blättchen, jeder Grashalm mit der größten Treue dargestellt erscheint, und in den un-
mittelbar daran sich anschließenden Hintergrund, der mit jener erstaunlichen und in dieser Zeit einzig
dastehenden Sicherheit und Breite behandelt wird, die wir an den Hintergründen Jans bewundern.
Wir finden in diesen Landschaften dieselben Bergformen, Bäume, Blumen, Gräser, Architekturen, die
wir aus anderen Bildern Jans kennen, und in derselben Weise, mit derselben unübertrefflichen Sach-
lichkeit dargestellt, die gleich bei ihren ersten
Versuchen das Höchste erreicht zu haben scheint.
Wie die Lichter an die Blätter und an die Archi-
tekturen gesetzt werden, wie eine Terrainver-
änderung, ein die Wiese durchschneidender Weg
oder ein Bau mit einem einzigen breiten Striche
angedeutet, wie durch eine flüchtige Silhouette
ein Baum, eine Architektur scharf und unver-
kennbar charakterisiert wird, daß es ein Japaner
nicht besser getan hätte, das alles finden wir in
dieser Zeit und in dieser Vollendung nur bei
Fig. 23. Jan van Eyck, Die heil. Pilger, vom Genter Altar. einem Künstler und dieser Künstler ist Jan van
Berlin, königl. Gemäldegalerie (Ausschnitt). Eyck (vgl. Fig. 7, 23, 24).
Sind jedoch die Landschaften der vier
Seitentafeln von Jan, dann ist auch der obere Teil der Landschaft in der Anbetung des Lammes von
ihm. Es wäre töricht zu vermuten, daß ein Künstler, der in perspektivischer und räumlicher Auf-
fassung und Darstellung so beschränkt und gebunden war, als es, wie wir gesehen haben, Hubert ge-
wesen ist, eine solche Landschaft mit weiten Ausblicken, mit Tiefen, die sich in blauer Ferne ver-
lieren, mit Effekten der Luftperspektive, welche die kommende Kunst ahnen lassen, hätte malen sollen,
wie sie die Anbetung des Lammes nach oben abschließt. Es wäre etwa so, als wenn man Figuren Alti-
chieros mit einer Landschaft Masaccios verbinden wollte, wobei Hubert in seinen Figuren nicht so
weit über Altichiero als Jan in seinen Landschaften über Masaccio hinausgekommen ist. Doch kommt
diese Möglichkeit auch deshalb schon gar nicht in Betracht, weil die Landschaft in der Anbetung des
Lammes, wenigstens ihr oberer Teil, mit den Landschaften der Seitentafeln vollkommen überein-
stimmt. Wir finden auf allen fünf Tafeln nicht nur dieselben Berge und Täler, dieselben Architek-
turen, dieselbe Vegetation, dieselbe Darstellung des Baumschlages und der Sträucher sondern auch alles
das in derselben Weise gemalt; fast für jeden Pinselstrich in der Landschaft der Mitteltafel finden wir
ein Gegenstück auf einem der Seitenbilder.
Man hat schon oft bemerkt und hervorgehoben, daß die Anbetung des Lammes in zwei Teile
zerfällt, die einen verschiedenen Augenpunkt voraussetzen, und es so erklärt, daß sich der Maler dieses
Widerspruches noch nicht bewußt gewesen ist oder sich über ihn leicht hinweggesetzt hat. Beides
kann man nur mit einer gewissen Einschränkung gelten lassen. Man vergegenwärtige sich nur, wie
stark dieser Widerspruch ist. Hinter den beiden großen Gruppen steigt der Boden steil und fast senk-