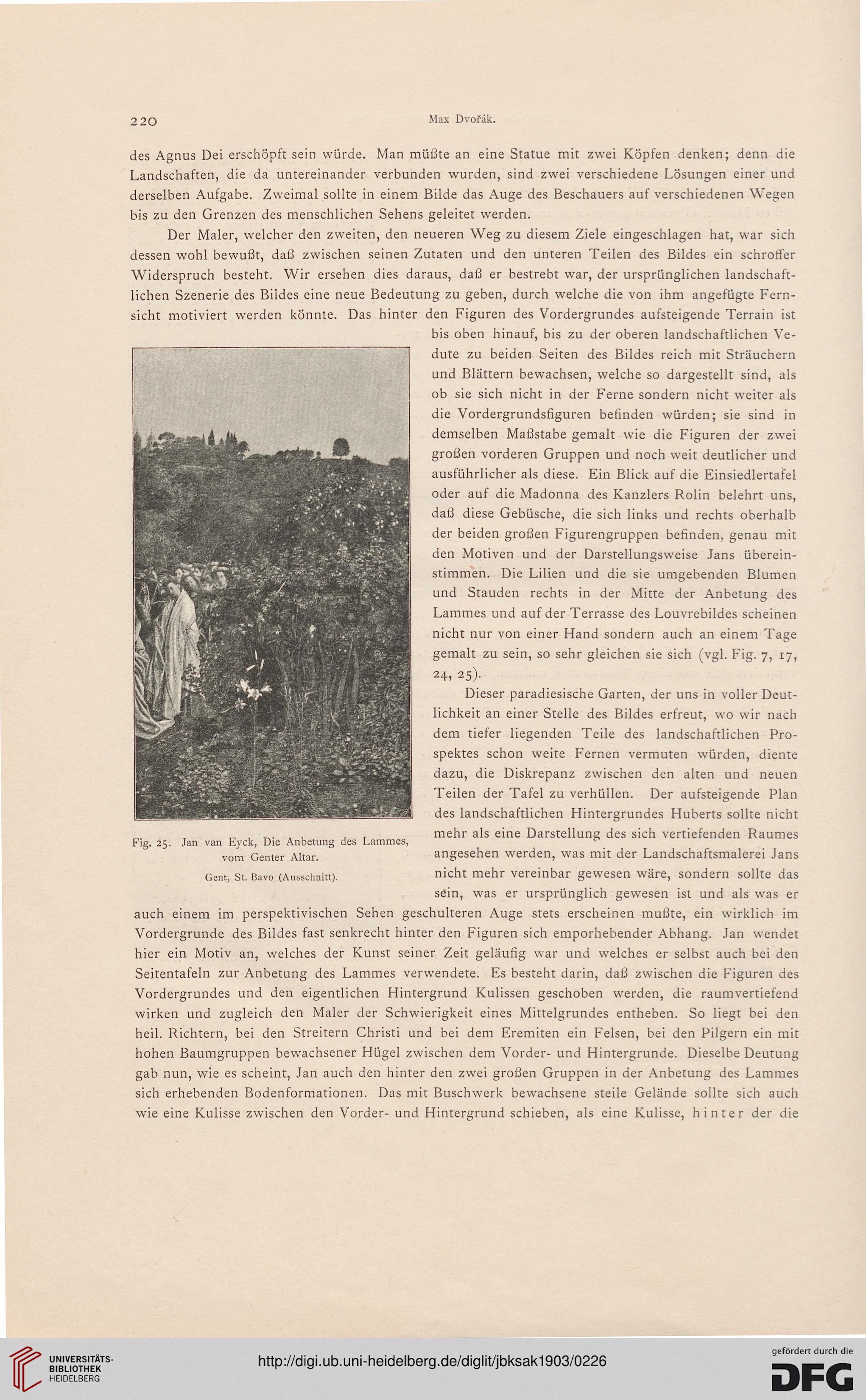220
Max Dvorak.
des Agnus Dei erschöpft sein würde. Man müßte an eine Statue mit zwei Köpfen denken; denn die
Landschaften, die da untereinander verbunden wurden, sind zwei verschiedene Lösungen einer und
derselben Aufgabe. Zweimal sollte in einem Bilde das Auge des Beschauers auf verschiedenen Wegen
bis zu den Grenzen des menschlichen Sehens geleitet werden.
Der Maler, welcher den zweiten, den neueren Weg zu diesem Ziele eingeschlagen hat, war sich
dessen wohl bewußt, daß zwischen seinen Zutaten und den unteren Teilen des Bildes ein schroffer
Widerspruch besteht. Wir ersehen dies daraus, daß er bestrebt war, der ursprünglichen landschaft-
lichen Szenerie des Bildes eine neue Bedeutung zu geben, durch welche die von ihm angefügte Fern-
sicht motiviert werden könnte. Das hinter den Figuren des Vordergrundes aufsteigende Terrain ist
bis oben hinauf, bis zu der oberen landschaftlichen Ve-
dute zu beiden Seiten des Bildes reich mit Sträuchern
und Blättern bewachsen, welche so dargestellt sind, als
ob sie sich nicht in der Ferne sondern nicht weiter als
die Vordergrundsfiguren befinden würden; sie sind in
demselben Maßstabe gemalt wie die Figuren der zwei
großen vorderen Gruppen und noch weit deutlicher und
ausführlicher als diese. Ein Blick auf die Einsiedlertafel
oder auf die Madonna des Kanzlers Rolin belehrt uns,
daß diese Gebüsche, die sich links und rechts oberhalb
der beiden großen Figurengruppen befinden, genau mit
den Motiven und der Darstellungsweise Jans überein-
stimmen. Die Lilien und die sie umgebenden Blumen
und Stauden rechts in der Mitte der Anbetung des
Lammes und auf der Terrasse des Louvrebildes scheinen
nicht nur von einer Hand sondern auch an einem Tage
gemalt zu sein, so sehr gleichen sie sich (vgl. Fig. 7, 17,
24, 25).
Dieser paradiesische Garten, der uns in voller Deut-
lichkeit an einer Stelle des Bildes erfreut, wo wir nach
dem tiefer liegenden Teile des landschaftlichen Pro-
spektes schon weite Fernen vermuten würden, diente
dazu, die Diskrepanz zwischen den alten und neuen
Teilen der Tafel zu verhüllen. Der aufsteigende Plan
des landschaftlichen Hintergrundes Huberts sollte nicht
mehr als eine Darstellung des sich vertiefenden Raumes
angesehen werden, was mit der Landschaftsmalerei Jans
nicht mehr vereinbar gewesen wäre, sondern sollte das
sein, was er ursprünglich gewesen ist und als was er
auch einem im perspektivischen Sehen geschulteren Auge stets erscheinen mußte, ein wirklich im
Vordergrunde des Bildes fast senkrecht hinter den Figuren sich emporhebender Abhang. Jan wendet
hier ein Motiv an, welches der Kunst seiner Zeit geläufig war und welches er selbst auch bei den
Seitentafeln zur Anbetung des Lammes verwendete. Es besteht darin, daß zwischen die Figuren des
Vordergrundes und den eigentlichen Hintergrund Kulissen geschoben werden, die raumvertiefend
wirken und zugleich den Maler der Schwierigkeit eines Mittelgrundes entheben. So liegt bei den
heil. Richtern, bei den Streitern Christi und bei dem Eremiten ein Felsen, bei den Pilgern ein mit
hohen Baumgruppen bewachsener Hügel zwischen dem Vorder- und Hintergrunde. Dieselbe Deutung
gab nun, wie es scheint, Jan auch den hinter den zwei großen Gruppen in der Anbetung des Lammes
sich erhebenden Bodenformationen. Das mit Buschwerk bewachsene steile Gelände sollte sich auch
wie eine Kulisse zwischen den Vorder- und Hintergrund schieben, als eine Kulisse, hinter der die
fig. 25.
Jan van Eyck, Die Anbetung des Lammes,
vom Genter Altar.
Gent, St. Bavo (Ausschnitt).
Max Dvorak.
des Agnus Dei erschöpft sein würde. Man müßte an eine Statue mit zwei Köpfen denken; denn die
Landschaften, die da untereinander verbunden wurden, sind zwei verschiedene Lösungen einer und
derselben Aufgabe. Zweimal sollte in einem Bilde das Auge des Beschauers auf verschiedenen Wegen
bis zu den Grenzen des menschlichen Sehens geleitet werden.
Der Maler, welcher den zweiten, den neueren Weg zu diesem Ziele eingeschlagen hat, war sich
dessen wohl bewußt, daß zwischen seinen Zutaten und den unteren Teilen des Bildes ein schroffer
Widerspruch besteht. Wir ersehen dies daraus, daß er bestrebt war, der ursprünglichen landschaft-
lichen Szenerie des Bildes eine neue Bedeutung zu geben, durch welche die von ihm angefügte Fern-
sicht motiviert werden könnte. Das hinter den Figuren des Vordergrundes aufsteigende Terrain ist
bis oben hinauf, bis zu der oberen landschaftlichen Ve-
dute zu beiden Seiten des Bildes reich mit Sträuchern
und Blättern bewachsen, welche so dargestellt sind, als
ob sie sich nicht in der Ferne sondern nicht weiter als
die Vordergrundsfiguren befinden würden; sie sind in
demselben Maßstabe gemalt wie die Figuren der zwei
großen vorderen Gruppen und noch weit deutlicher und
ausführlicher als diese. Ein Blick auf die Einsiedlertafel
oder auf die Madonna des Kanzlers Rolin belehrt uns,
daß diese Gebüsche, die sich links und rechts oberhalb
der beiden großen Figurengruppen befinden, genau mit
den Motiven und der Darstellungsweise Jans überein-
stimmen. Die Lilien und die sie umgebenden Blumen
und Stauden rechts in der Mitte der Anbetung des
Lammes und auf der Terrasse des Louvrebildes scheinen
nicht nur von einer Hand sondern auch an einem Tage
gemalt zu sein, so sehr gleichen sie sich (vgl. Fig. 7, 17,
24, 25).
Dieser paradiesische Garten, der uns in voller Deut-
lichkeit an einer Stelle des Bildes erfreut, wo wir nach
dem tiefer liegenden Teile des landschaftlichen Pro-
spektes schon weite Fernen vermuten würden, diente
dazu, die Diskrepanz zwischen den alten und neuen
Teilen der Tafel zu verhüllen. Der aufsteigende Plan
des landschaftlichen Hintergrundes Huberts sollte nicht
mehr als eine Darstellung des sich vertiefenden Raumes
angesehen werden, was mit der Landschaftsmalerei Jans
nicht mehr vereinbar gewesen wäre, sondern sollte das
sein, was er ursprünglich gewesen ist und als was er
auch einem im perspektivischen Sehen geschulteren Auge stets erscheinen mußte, ein wirklich im
Vordergrunde des Bildes fast senkrecht hinter den Figuren sich emporhebender Abhang. Jan wendet
hier ein Motiv an, welches der Kunst seiner Zeit geläufig war und welches er selbst auch bei den
Seitentafeln zur Anbetung des Lammes verwendete. Es besteht darin, daß zwischen die Figuren des
Vordergrundes und den eigentlichen Hintergrund Kulissen geschoben werden, die raumvertiefend
wirken und zugleich den Maler der Schwierigkeit eines Mittelgrundes entheben. So liegt bei den
heil. Richtern, bei den Streitern Christi und bei dem Eremiten ein Felsen, bei den Pilgern ein mit
hohen Baumgruppen bewachsener Hügel zwischen dem Vorder- und Hintergrunde. Dieselbe Deutung
gab nun, wie es scheint, Jan auch den hinter den zwei großen Gruppen in der Anbetung des Lammes
sich erhebenden Bodenformationen. Das mit Buschwerk bewachsene steile Gelände sollte sich auch
wie eine Kulisse zwischen den Vorder- und Hintergrund schieben, als eine Kulisse, hinter der die
fig. 25.
Jan van Eyck, Die Anbetung des Lammes,
vom Genter Altar.
Gent, St. Bavo (Ausschnitt).