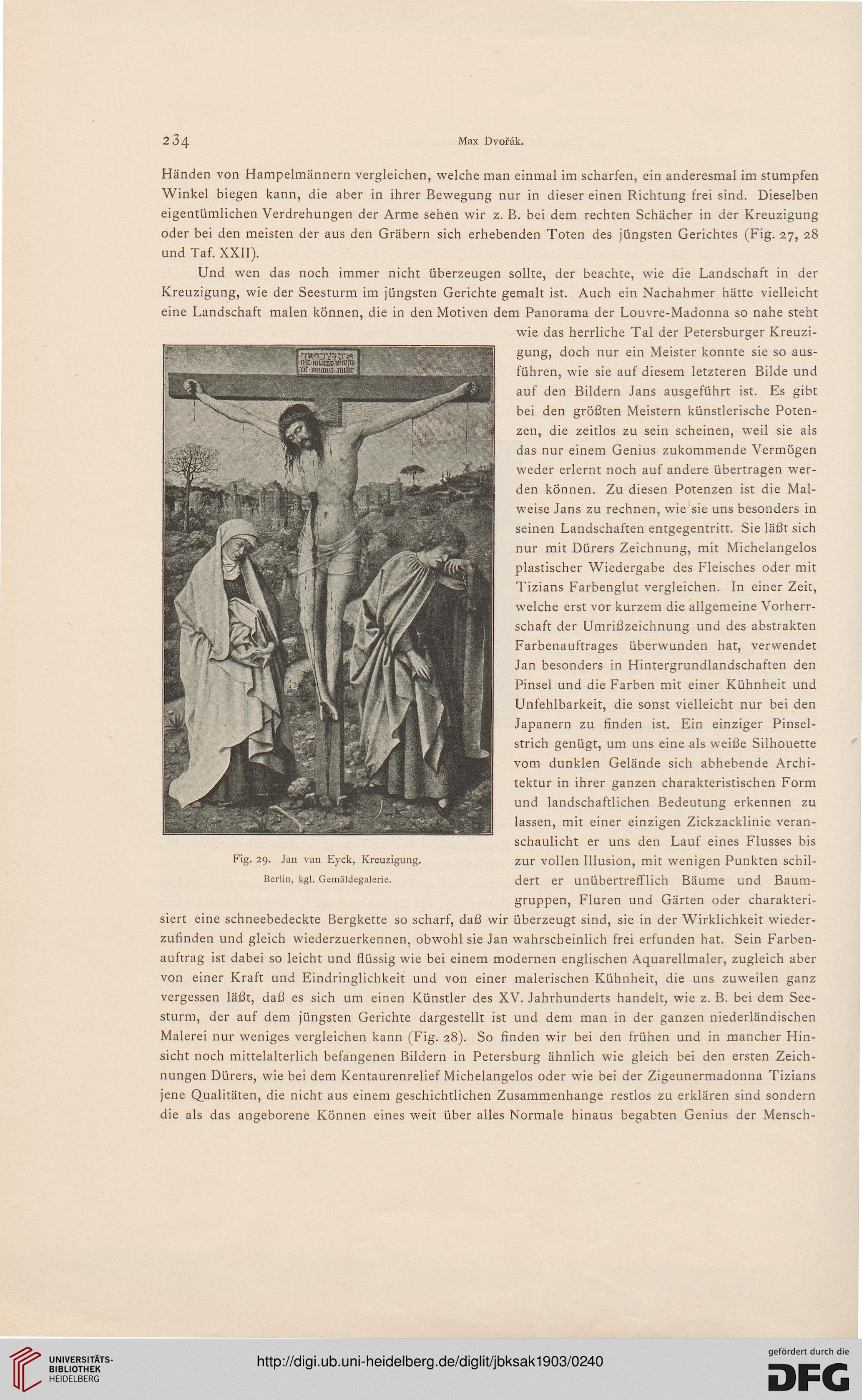234
Max Dvofäk.
Händen von Hampelmännern vergleichen, welche man einmal im scharfen, ein anderesmal im stumpfen
Winkel biegen kann, die aber in ihrer Bewegung nur in dieser einen Richtung frei sind. Dieselben
eigentümlichen Verdrehungen der Arme sehen wir z. B. bei dem rechten Schacher in der Kreuzigung
oder bei den meisten der aus den Gräbern sich erhebenden Toten des jüngsten Gerichtes (Fig. 27, 28
und Taf. XXII).
Und wen das noch immer nicht überzeugen sollte, der beachte, wie die Landschaft in der
Kreuzigung, wie der Seesturm im jüngsten Gerichte gemalt ist. Auch ein Nachahmer hätte vielleicht
eine Landschaft malen können, die in den Motiven dem Panorama der Louvre-Madonna so nahe steht
wie das herrliche Tal der Petersburger Kreuzi-
gung, doch nur ein Meister konnte sie so aus-
führen, wie sie auf diesem letzteren Bilde und
auf den Bildern Jans ausgeführt ist. Es gibt
bei den größten Meistern künstlerische Poten-
zen, die zeitlos zu sein scheinen, weil sie als
das nur einem Genius zukommende Vermögen
weder erlernt noch auf andere übertragen wer-
den können. Zu diesen Potenzen ist die Mal-
weise Jans zu rechnen, wie sie uns besonders in
seinen Landschaften entgegentritt. Sie läßt sich
nur mit Dürers Zeichnung, mit Michelangelos
plastischer Wiedergabe des Fleisches oder mit
Tizians Farbenglut vergleichen. In einer Zeit,
welche erst vor kurzem die allgemeine Vorherr-
schaft der Umrißzeichnung und des abstrakten
Farbenauftrages überwunden hat, verwendet
Jan besonders in Hintergrundlandschaften den
Pinsel und die Farben mit einer Kühnheit und
Unfehlbarkeit, die sonst vielleicht nur bei den
Japanern zu finden ist. Ein einziger Pinsel-
strich genügt, um uns eine als weiße Silhouette
vom dunklen Gelände sich abhebende Archi-
tektur in ihrer ganzen charakteristischen Form
und landschaftlichen Bedeutung erkennen zu
lassen, mit einer einzigen Zickzacklinie veran-
schaulicht er uns den Lauf eines Flusses bis
Fig. 29. Jan van Eyck, Kreuzigung. zur vollen Illusion, mit wenigen Punkten schil-
Beriin, kgi. Gemäldegalerie. dert er unübertrefflich Bäume und Baum-
gruppen, Fluren und Gärten oder charakteri-
siert eine schneebedeckte Bergkette so scharf, daß wir überzeugt sind, sie in der Wirklichkeit wieder-
zufinden und gleich wiederzuerkennen, obwohl sie Jan wahrscheinlich frei erfunden hat. Sein Farben-
auftrag ist dabei so leicht und flüssig wie bei einem modernen englischen Aquarellmaler, zugleich aber
von einer Kraft und Eindringlichkeit und von einer malerischen Kühnheit, die uns zuweilen ganz
vergessen läßt, daß es sich um einen Künstler des XV. Jahrhunderts handelt, wie z. B. bei dem See-
sturm, der auf dem jüngsten Gerichte dargestellt ist und dem man in der ganzen niederländischen
Malerei nur weniges vergleichen kann (Fig. 28). So finden wir bei den frühen und in mancher Hin-
sicht noch mittelalterlich befangenen Bildern in Petersburg ähnlich wie gleich bei den ersten Zeich-
nungen Dürers, wie bei dem Kentaurenrelief Michelangelos oder wie bei der Zigeunermadonna Tizians
jene Qualitäten, die nicht aus einem geschichtlichen Zusammenhange restlos zu erklären sind sondern
die als das angeborene Können eines weit über alles Normale hinaus begabten Genius der Mensch-
Max Dvofäk.
Händen von Hampelmännern vergleichen, welche man einmal im scharfen, ein anderesmal im stumpfen
Winkel biegen kann, die aber in ihrer Bewegung nur in dieser einen Richtung frei sind. Dieselben
eigentümlichen Verdrehungen der Arme sehen wir z. B. bei dem rechten Schacher in der Kreuzigung
oder bei den meisten der aus den Gräbern sich erhebenden Toten des jüngsten Gerichtes (Fig. 27, 28
und Taf. XXII).
Und wen das noch immer nicht überzeugen sollte, der beachte, wie die Landschaft in der
Kreuzigung, wie der Seesturm im jüngsten Gerichte gemalt ist. Auch ein Nachahmer hätte vielleicht
eine Landschaft malen können, die in den Motiven dem Panorama der Louvre-Madonna so nahe steht
wie das herrliche Tal der Petersburger Kreuzi-
gung, doch nur ein Meister konnte sie so aus-
führen, wie sie auf diesem letzteren Bilde und
auf den Bildern Jans ausgeführt ist. Es gibt
bei den größten Meistern künstlerische Poten-
zen, die zeitlos zu sein scheinen, weil sie als
das nur einem Genius zukommende Vermögen
weder erlernt noch auf andere übertragen wer-
den können. Zu diesen Potenzen ist die Mal-
weise Jans zu rechnen, wie sie uns besonders in
seinen Landschaften entgegentritt. Sie läßt sich
nur mit Dürers Zeichnung, mit Michelangelos
plastischer Wiedergabe des Fleisches oder mit
Tizians Farbenglut vergleichen. In einer Zeit,
welche erst vor kurzem die allgemeine Vorherr-
schaft der Umrißzeichnung und des abstrakten
Farbenauftrages überwunden hat, verwendet
Jan besonders in Hintergrundlandschaften den
Pinsel und die Farben mit einer Kühnheit und
Unfehlbarkeit, die sonst vielleicht nur bei den
Japanern zu finden ist. Ein einziger Pinsel-
strich genügt, um uns eine als weiße Silhouette
vom dunklen Gelände sich abhebende Archi-
tektur in ihrer ganzen charakteristischen Form
und landschaftlichen Bedeutung erkennen zu
lassen, mit einer einzigen Zickzacklinie veran-
schaulicht er uns den Lauf eines Flusses bis
Fig. 29. Jan van Eyck, Kreuzigung. zur vollen Illusion, mit wenigen Punkten schil-
Beriin, kgi. Gemäldegalerie. dert er unübertrefflich Bäume und Baum-
gruppen, Fluren und Gärten oder charakteri-
siert eine schneebedeckte Bergkette so scharf, daß wir überzeugt sind, sie in der Wirklichkeit wieder-
zufinden und gleich wiederzuerkennen, obwohl sie Jan wahrscheinlich frei erfunden hat. Sein Farben-
auftrag ist dabei so leicht und flüssig wie bei einem modernen englischen Aquarellmaler, zugleich aber
von einer Kraft und Eindringlichkeit und von einer malerischen Kühnheit, die uns zuweilen ganz
vergessen läßt, daß es sich um einen Künstler des XV. Jahrhunderts handelt, wie z. B. bei dem See-
sturm, der auf dem jüngsten Gerichte dargestellt ist und dem man in der ganzen niederländischen
Malerei nur weniges vergleichen kann (Fig. 28). So finden wir bei den frühen und in mancher Hin-
sicht noch mittelalterlich befangenen Bildern in Petersburg ähnlich wie gleich bei den ersten Zeich-
nungen Dürers, wie bei dem Kentaurenrelief Michelangelos oder wie bei der Zigeunermadonna Tizians
jene Qualitäten, die nicht aus einem geschichtlichen Zusammenhange restlos zu erklären sind sondern
die als das angeborene Können eines weit über alles Normale hinaus begabten Genius der Mensch-