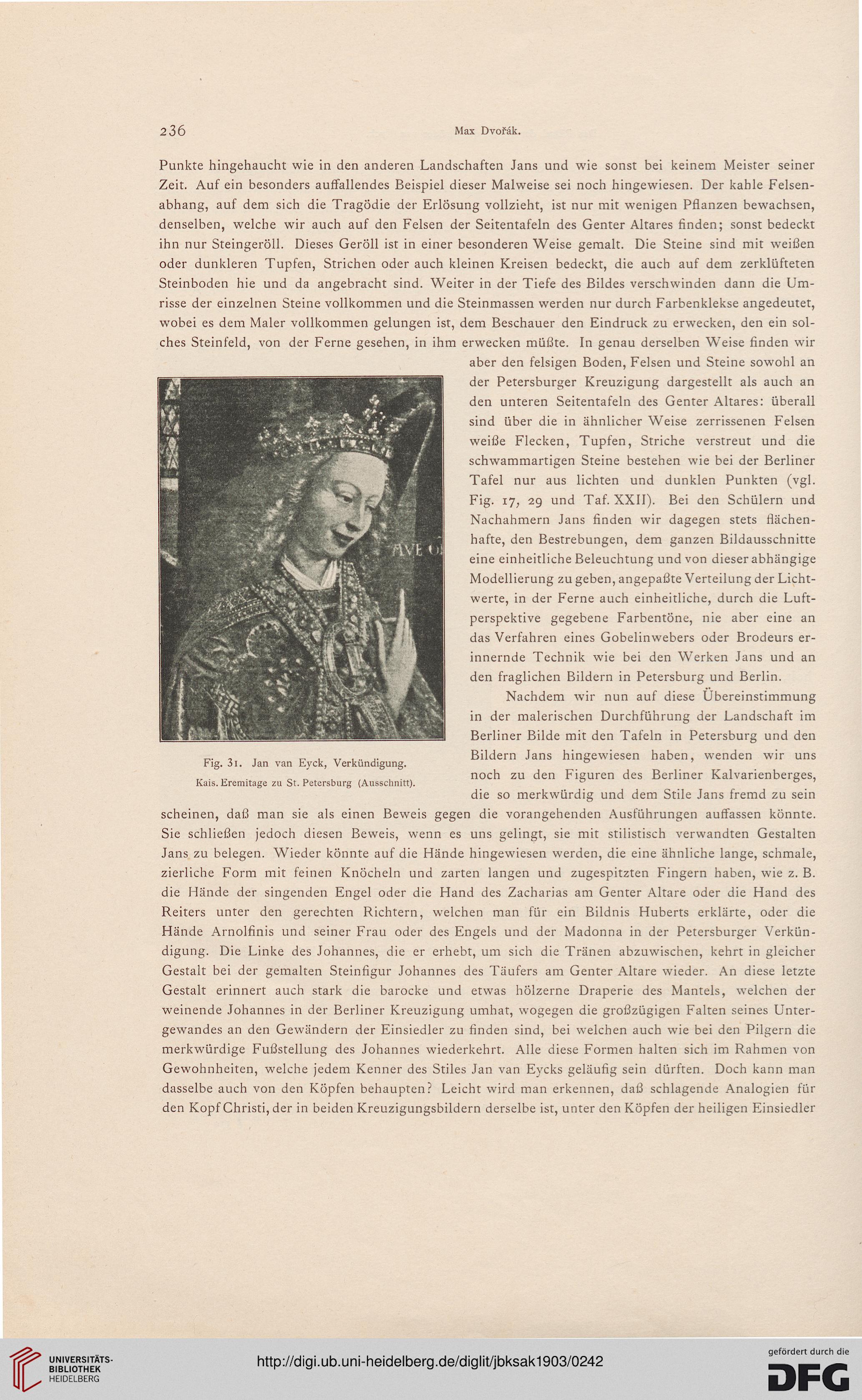236
Max Dvofäk.
Punkte hingehaucht wie in den anderen Landschaften Jans und wie sonst bei keinem Meister seiner
Zeit. Auf ein besonders auffallendes Beispiel dieser Malweise sei noch hingewiesen. Der kahle Felsen-
abhang, auf dem sich die Tragödie der Erlösung vollzieht, ist nur mit wenigen Pflanzen bewachsen,
denselben, welche wir auch auf den Felsen der Seitentafeln des Genter Altares finden; sonst bedeckt
ihn nur Steingeröll. Dieses Geröll ist in einer besonderen Weise gemalt. Die Steine sind mit weii3en
oder dunkleren Tupfen, Strichen oder auch kleinen Kreisen bedeckt, die auch auf dem zerklüfteten
Steinboden hie und da angebracht sind. Weiter in der Tiefe des Bildes verschwinden dann die Um-
risse der einzelnen Steine vollkommen und die Steinmassen werden nur durch Farbenklekse angedeutet,
wobei es dem Maler vollkommen gelungen ist, dem Beschauer den Eindruck zu erwecken, den ein sol-
ches Steinfeld, von der Ferne gesehen, in ihm erwecken müßte. In genau derselben Weise finden wir
aber den felsigen Boden, Felsen und Steine sowohl an
der Petersburger Kreuzigung dargestellt als auch an
den unteren Seitentafeln des Genter Altares: überall
sind über die in ähnlicher Weise zerrissenen Felsen
weiße Flecken, Tupfen, Striche verstreut und die
schwammartigen Steine bestehen wie bei der Berliner
Tafel nur aus lichten und dunklen Punkten (vgl.
Fig. 17, 29 und Taf. XXII). Bei den Schülern und
Nachahmern Jans finden wir dagegen stets flächen-
hafte, den Bestrebungen, dem ganzen Bildausschnitte
eine einheitliche Beleuchtung und von dieser abhängige
Modellierung zu geben, angepaßte Verteilung der Licht-
werte, in der Ferne auch einheitliche, durch die Luft-
perspektive gegebene Farbentöne, nie aber eine an
das Verfahren eines Gobelinwebers oder Brodeurs er-
innernde Technik wie bei den Werken Jans und an
den fraglichen Bildern in Petersburg und Berlin.
Nachdem wir nun auf diese Ubereinstimmung
in der malerischen Durchführung der Landschaft im
Berliner Bilde mit den Tafeln in Petersburg und den
Bildern Jans hingewiesen haben, wenden wir uns
noch zu den Figuren des Berliner Kalvarienberges,
die so merkwürdig und dem Stile Jans fremd zu sein
scheinen, daß man sie als einen Beweis gegen die vorangehenden Ausführungen auffassen könnte.
Sie schließen jedoch diesen Beweis, wenn es uns gelingt, sie mit stilistisch verwandten Gestalten
Jans zu belegen. Wieder könnte auf die Hände hingewiesen werden, die eine ähnliche lange, schmale,
zierliche Form mit feinen Knöcheln und zarten langen und zugespitzten Fingern haben, wie z. B.
die Hände der singenden Engel oder die Hand des Zacharias am Genter Altare oder die Hand des
Reiters unter den gerechten Richtern, welchen man für ein Bildnis Huberts erklärte, oder die
Hände Arnolfinis und seiner Frau oder des Engels und der Madonna in der Petersburger Verkün-
digung. Die Linke des Johannes, die er erhebt, um sich die Tränen abzuwischen, kehrt in gleicher
Gestalt bei der gemalten Steinfigur Johannes des Täufers am Genter Altare wieder. An diese letzte
Gestalt erinnert auch stark die barocke und etwas hölzerne Draperie des Mantels, welchen der
weinende Johannes in der Berliner Kreuzigung umhat, wogegen die großzügigen Falten seines Unter-
gewandes an den Gewändern der Einsiedler zu finden sind, bei welchen auch wie bei den Pilgern die
merkwürdige Fußstellung des Johannes wiederkehrt. Alle diese Formen halten sich im Rahmen von
Gewohnheiten, welche jedem Kenner des Stiles Jan van Eycks geläufig sein dürften. Doch kann man
dasselbe auch von den Köpfen behaupten? Leicht wird man erkennen, daß schlagende Analogien für
den Kopf Christi, der in beiden Kreuzigungsbildern derselbe ist, unter den Köpfen der heiligen Einsiedler
Fig. 3i. Jan van Eyck, Verkündigung.
Kais. Eremitage zu St. Petersburg (Ausschnitt).
Max Dvofäk.
Punkte hingehaucht wie in den anderen Landschaften Jans und wie sonst bei keinem Meister seiner
Zeit. Auf ein besonders auffallendes Beispiel dieser Malweise sei noch hingewiesen. Der kahle Felsen-
abhang, auf dem sich die Tragödie der Erlösung vollzieht, ist nur mit wenigen Pflanzen bewachsen,
denselben, welche wir auch auf den Felsen der Seitentafeln des Genter Altares finden; sonst bedeckt
ihn nur Steingeröll. Dieses Geröll ist in einer besonderen Weise gemalt. Die Steine sind mit weii3en
oder dunkleren Tupfen, Strichen oder auch kleinen Kreisen bedeckt, die auch auf dem zerklüfteten
Steinboden hie und da angebracht sind. Weiter in der Tiefe des Bildes verschwinden dann die Um-
risse der einzelnen Steine vollkommen und die Steinmassen werden nur durch Farbenklekse angedeutet,
wobei es dem Maler vollkommen gelungen ist, dem Beschauer den Eindruck zu erwecken, den ein sol-
ches Steinfeld, von der Ferne gesehen, in ihm erwecken müßte. In genau derselben Weise finden wir
aber den felsigen Boden, Felsen und Steine sowohl an
der Petersburger Kreuzigung dargestellt als auch an
den unteren Seitentafeln des Genter Altares: überall
sind über die in ähnlicher Weise zerrissenen Felsen
weiße Flecken, Tupfen, Striche verstreut und die
schwammartigen Steine bestehen wie bei der Berliner
Tafel nur aus lichten und dunklen Punkten (vgl.
Fig. 17, 29 und Taf. XXII). Bei den Schülern und
Nachahmern Jans finden wir dagegen stets flächen-
hafte, den Bestrebungen, dem ganzen Bildausschnitte
eine einheitliche Beleuchtung und von dieser abhängige
Modellierung zu geben, angepaßte Verteilung der Licht-
werte, in der Ferne auch einheitliche, durch die Luft-
perspektive gegebene Farbentöne, nie aber eine an
das Verfahren eines Gobelinwebers oder Brodeurs er-
innernde Technik wie bei den Werken Jans und an
den fraglichen Bildern in Petersburg und Berlin.
Nachdem wir nun auf diese Ubereinstimmung
in der malerischen Durchführung der Landschaft im
Berliner Bilde mit den Tafeln in Petersburg und den
Bildern Jans hingewiesen haben, wenden wir uns
noch zu den Figuren des Berliner Kalvarienberges,
die so merkwürdig und dem Stile Jans fremd zu sein
scheinen, daß man sie als einen Beweis gegen die vorangehenden Ausführungen auffassen könnte.
Sie schließen jedoch diesen Beweis, wenn es uns gelingt, sie mit stilistisch verwandten Gestalten
Jans zu belegen. Wieder könnte auf die Hände hingewiesen werden, die eine ähnliche lange, schmale,
zierliche Form mit feinen Knöcheln und zarten langen und zugespitzten Fingern haben, wie z. B.
die Hände der singenden Engel oder die Hand des Zacharias am Genter Altare oder die Hand des
Reiters unter den gerechten Richtern, welchen man für ein Bildnis Huberts erklärte, oder die
Hände Arnolfinis und seiner Frau oder des Engels und der Madonna in der Petersburger Verkün-
digung. Die Linke des Johannes, die er erhebt, um sich die Tränen abzuwischen, kehrt in gleicher
Gestalt bei der gemalten Steinfigur Johannes des Täufers am Genter Altare wieder. An diese letzte
Gestalt erinnert auch stark die barocke und etwas hölzerne Draperie des Mantels, welchen der
weinende Johannes in der Berliner Kreuzigung umhat, wogegen die großzügigen Falten seines Unter-
gewandes an den Gewändern der Einsiedler zu finden sind, bei welchen auch wie bei den Pilgern die
merkwürdige Fußstellung des Johannes wiederkehrt. Alle diese Formen halten sich im Rahmen von
Gewohnheiten, welche jedem Kenner des Stiles Jan van Eycks geläufig sein dürften. Doch kann man
dasselbe auch von den Köpfen behaupten? Leicht wird man erkennen, daß schlagende Analogien für
den Kopf Christi, der in beiden Kreuzigungsbildern derselbe ist, unter den Köpfen der heiligen Einsiedler
Fig. 3i. Jan van Eyck, Verkündigung.
Kais. Eremitage zu St. Petersburg (Ausschnitt).