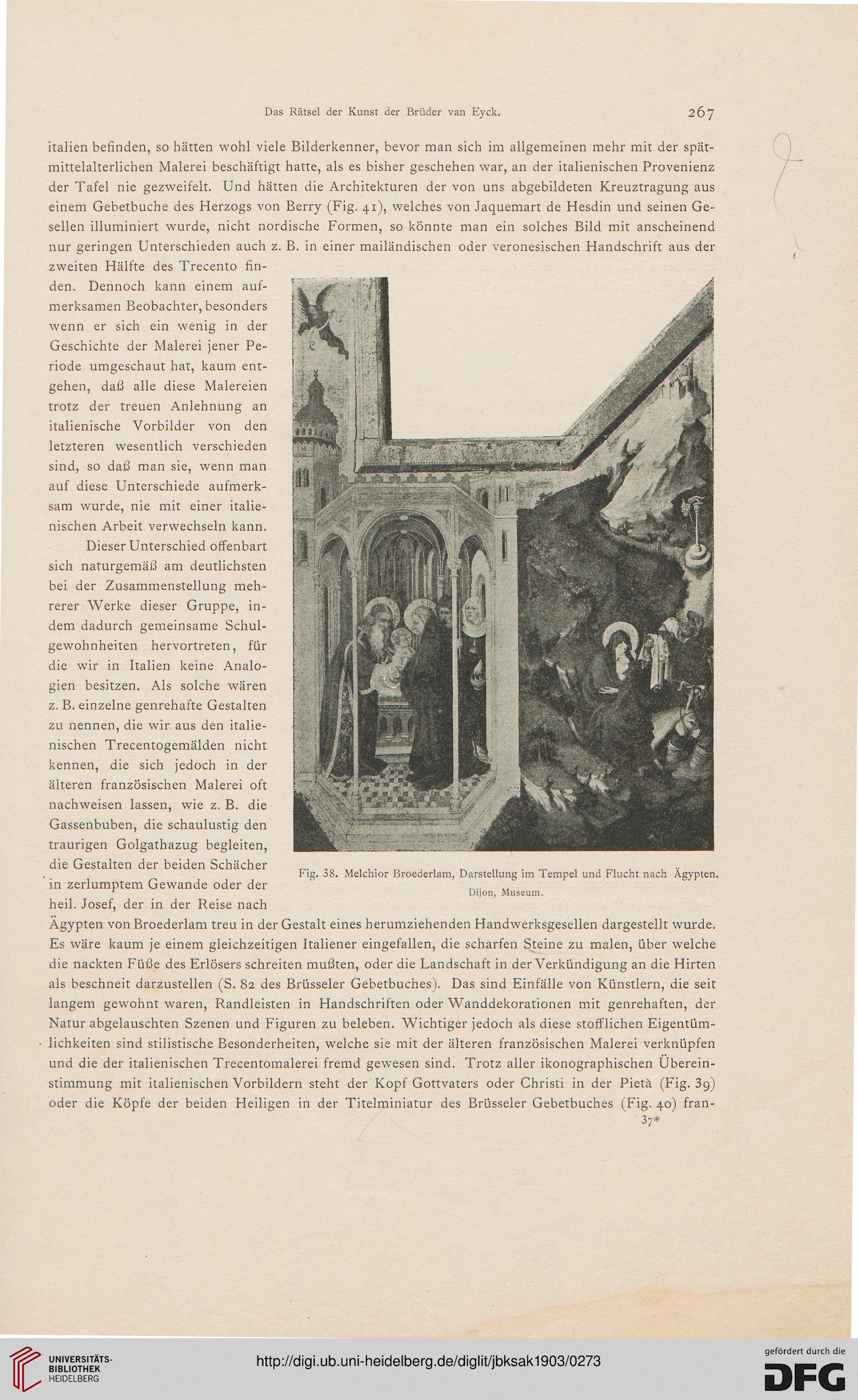Das Rätsel der Kunst der Brüder van Eyck.
267
italien befinden, so hätten wohl viele Bilderkenner, bevor man sich im allgemeinen mehr mit der spät-
mittelalterlichen Malerei beschäftigt hatte, als es bisher geschehen war, an der italienischen Provenienz
der Tafel nie gezweifelt. Und hätten die Architekturen der von uns abgebildeten Kreuztragung aus
einem Gebetbuche des Herzogs von Berry (Fig. 41), welches von Jaquemart de Hesdin und seinen Ge-
sellen illuminiert wurde, nicht nordische Formen, so könnte man ein solches Bild mit anscheinend
nur geringen Unterschieden auch z. B. in einer mailändischen oder veronesischen Handschrift aus der
zweiten Hälfte des Trecento fin-
den. Dennoch kann einem auf-
merksamen Beobachter, besonders
wenn er sich ein wenig in der
Geschichte der Malerei jener Pe-
riode umgeschaut hat, kaum ent-
gehen, daß alle diese Malereien
trotz der treuen Anlehnung an
italienische Vorbilder von den
letzteren wesentlich verschieden
sind, so daß man sie, wenn man
auf diese Unterschiede aufmerk-
sam wurde, nie mit einer italie-
nischen Arbeit verwechseln kann.
Dieser Unterschied offenbart
sich naturgemäß am deutlichsten
bei der Zusammenstellung meh-
rerer Werke dieser Gruppe, in-
dem dadurch gemeinsame Schul-
gewohnheiten hervortreten, für
die wir in Italien keine Analo-
gien besitzen. Als solche wären
z. B. einzelne genrehafte Gestalten
zu nennen, die wir aus den italie-
nischen Trecentogemälden nicht
kennen, die sich jedoch in der
älteren französischen Malerei oft
nachweisen lassen, wie z. B. die
Gassenbuben, die schaulustig den
traurigen Golgathazug begleiten,
die Gestalten der beiden Schacher
in zerlumptem Gewände oder der
heil. Josef, der in der Reise nach
Ägypten von Broederlam treu in der Gestalt eines herumziehenden Handwerksgesellen dargestellt wurde.
Es wäre kaum je einem gleichzeitigen Italiener eingefallen, die scharfen Steine zu malen, über welche
die nackten Füße des Erlösers schreiten mußten, oder die Landschaft in der Verkündigung an die Hirten
als beschneit darzustellen (S. 82 des Brüsseler Gebetbuches). Das sind Einfälle von Künstlern, die seit
langem gewohnt waren, Randleisten in Handschriften oder Wanddekorationen mit genrehaften, der
Natur abgelauschten Szenen und Figuren zu beleben. Wichtiger jedoch als diese stofflichen Eigentüm-
lichkeiten sind stilistische Besonderheiten, welche sie mit der älteren französischen Malerei verknüpfen
und die der italienischen Trecentomalerei fremd gewesen sind. Trotz aller ikonographischen Überein-
stimmung mit italienischen Vorbildern steht der Kopf Gottvaters oder Christi in der Pietä (Fig. 39)
oder die Köpfe der beiden Heiligen in der Titelminiatur des Brüsseler Gebetbuches (Fig. 40) fran-
37*
F"i£. 38. Melchior Broederlam, Darstellung im Tempel und Flucht nach Ägypten.
Djjon, Museum.
267
italien befinden, so hätten wohl viele Bilderkenner, bevor man sich im allgemeinen mehr mit der spät-
mittelalterlichen Malerei beschäftigt hatte, als es bisher geschehen war, an der italienischen Provenienz
der Tafel nie gezweifelt. Und hätten die Architekturen der von uns abgebildeten Kreuztragung aus
einem Gebetbuche des Herzogs von Berry (Fig. 41), welches von Jaquemart de Hesdin und seinen Ge-
sellen illuminiert wurde, nicht nordische Formen, so könnte man ein solches Bild mit anscheinend
nur geringen Unterschieden auch z. B. in einer mailändischen oder veronesischen Handschrift aus der
zweiten Hälfte des Trecento fin-
den. Dennoch kann einem auf-
merksamen Beobachter, besonders
wenn er sich ein wenig in der
Geschichte der Malerei jener Pe-
riode umgeschaut hat, kaum ent-
gehen, daß alle diese Malereien
trotz der treuen Anlehnung an
italienische Vorbilder von den
letzteren wesentlich verschieden
sind, so daß man sie, wenn man
auf diese Unterschiede aufmerk-
sam wurde, nie mit einer italie-
nischen Arbeit verwechseln kann.
Dieser Unterschied offenbart
sich naturgemäß am deutlichsten
bei der Zusammenstellung meh-
rerer Werke dieser Gruppe, in-
dem dadurch gemeinsame Schul-
gewohnheiten hervortreten, für
die wir in Italien keine Analo-
gien besitzen. Als solche wären
z. B. einzelne genrehafte Gestalten
zu nennen, die wir aus den italie-
nischen Trecentogemälden nicht
kennen, die sich jedoch in der
älteren französischen Malerei oft
nachweisen lassen, wie z. B. die
Gassenbuben, die schaulustig den
traurigen Golgathazug begleiten,
die Gestalten der beiden Schacher
in zerlumptem Gewände oder der
heil. Josef, der in der Reise nach
Ägypten von Broederlam treu in der Gestalt eines herumziehenden Handwerksgesellen dargestellt wurde.
Es wäre kaum je einem gleichzeitigen Italiener eingefallen, die scharfen Steine zu malen, über welche
die nackten Füße des Erlösers schreiten mußten, oder die Landschaft in der Verkündigung an die Hirten
als beschneit darzustellen (S. 82 des Brüsseler Gebetbuches). Das sind Einfälle von Künstlern, die seit
langem gewohnt waren, Randleisten in Handschriften oder Wanddekorationen mit genrehaften, der
Natur abgelauschten Szenen und Figuren zu beleben. Wichtiger jedoch als diese stofflichen Eigentüm-
lichkeiten sind stilistische Besonderheiten, welche sie mit der älteren französischen Malerei verknüpfen
und die der italienischen Trecentomalerei fremd gewesen sind. Trotz aller ikonographischen Überein-
stimmung mit italienischen Vorbildern steht der Kopf Gottvaters oder Christi in der Pietä (Fig. 39)
oder die Köpfe der beiden Heiligen in der Titelminiatur des Brüsseler Gebetbuches (Fig. 40) fran-
37*
F"i£. 38. Melchior Broederlam, Darstellung im Tempel und Flucht nach Ägypten.
Djjon, Museum.