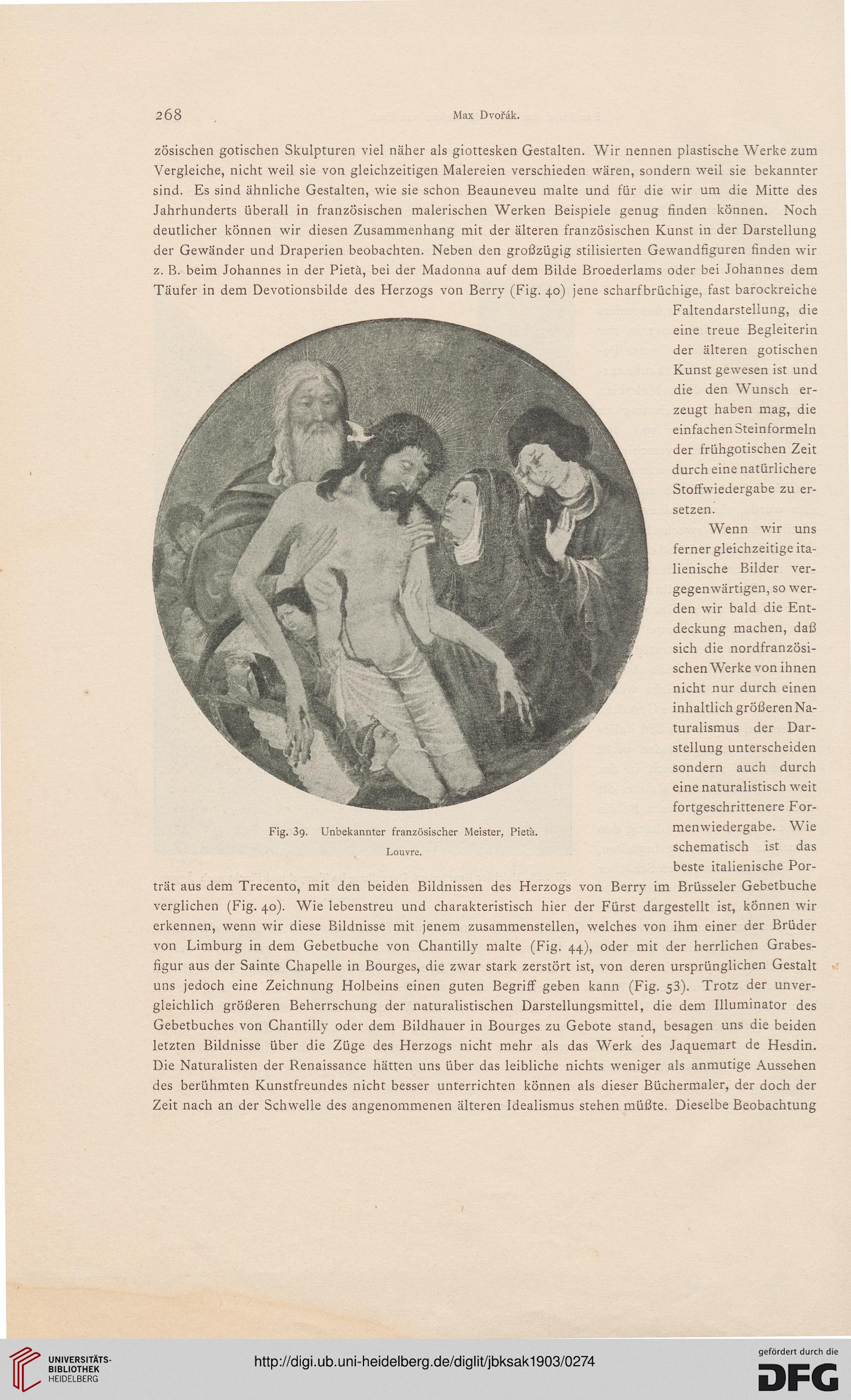268
Max Dvofäk.
zösischen gotischen Skulpturen viel näher als giottesken Gestalten. Wir nennen plastische Werke zum
Vergleiche, nicht weil sie von gleichzeitigen Malereien verschieden wären, sondern weil sie bekannter
sind. Es sind ähnliche Gestalten, wie sie schon Beauneveu malte und für die wir um die Mitte des
Jahrhunderts überall in französischen malerischen Werken Beispiele genug finden können. Noch
deutlicher können wir diesen Zusammenhang mit der älteren französischen Kunst in der Darstellung
der Gewänder und Draperien beobachten. Neben den großzügig stilisierten Gewandfiguren finden wir
z. B. beim Johannes in der Pietä, bei der Madonna auf dem Bilde Broederlams oder bei Johannes dem
Täufer in dem Devotionsbilde des Herzogs von Berry (Fig. 40) jene scharf brüchige, fast barockreiche
Faltendarstellung, die
eine treue Begleiterin
der älteren gotischen
Kunst gewesen ist und
die den Wunsch er-
zeugt haben mag, die
einfachen Steinformeln
der frühgotischen Zeit
durch eine natürlichere
Stoffwiedergabe zu er-
setzen.
Wenn wir uns
ferner gleichzeitige ita-
lienische Bilder ver-
gegenwärtigen, so wer-
den wir bald die Ent-
deckung machen, daß
sich die nordfranzösi-
schen Werke von ihnen
nicht nur durch einen
inhaltlich größeren Na-
turalismus der Dar-
stellung unterscheiden
sondern auch durch
eine naturalistisch weit
fortgeschrittenere For-
menwiedergabe. Wie
schematisch ist das
beste italienische Por-
trät aus dem Trecento, mit den beiden Bildnissen des Herzogs von Berry im Brüsseler Gebetbuche
verglichen (Fig. 40). Wie lebenstreu und charakteristisch hier der Fürst dargestellt ist, können wir
erkennen, wenn wir diese Bildnisse mit jenem zusammenstellen, welches von ihm einer der Brüder
von Limburg in dem Gebetbuche von Chantilly malte (Fig. 44), oder mit der herrlichen Grabes-
figur aus der Sainte Chapelle in Bourges, die zwar stark zerstört ist, von deren ursprünglichen Gestalt
uns jedoch eine Zeichnung Holbeins einen guten Begriff geben kann (Fig. 53). Trotz der unver-
gleichlich größeren Beherrschung der naturalistischen Darstellungsmittel, die dem Illuminator des
Gebetbuches von Chantilly oder dem Bildhauer in Bourges zu Gebote stand, besagen uns die beiden
letzten Bildnisse über die Züge des Herzogs nicht mehr als das Werk des Jaquemart de Hesdin.
Die Naturalisten der Renaissance hätten uns über das leibliche nichts weniger als anmutige Aussehen
des berühmten Kunstfreundes nicht besser unterrichten können als dieser Büchermaler, der doch der
Zeit nach an der Schwelle des angenommenen älteren Idealismus stehen müßte. Dieselbe Beobachtung
Fig. 39. Unbekannter französischer Meister, Pieta.
Louvre.
Max Dvofäk.
zösischen gotischen Skulpturen viel näher als giottesken Gestalten. Wir nennen plastische Werke zum
Vergleiche, nicht weil sie von gleichzeitigen Malereien verschieden wären, sondern weil sie bekannter
sind. Es sind ähnliche Gestalten, wie sie schon Beauneveu malte und für die wir um die Mitte des
Jahrhunderts überall in französischen malerischen Werken Beispiele genug finden können. Noch
deutlicher können wir diesen Zusammenhang mit der älteren französischen Kunst in der Darstellung
der Gewänder und Draperien beobachten. Neben den großzügig stilisierten Gewandfiguren finden wir
z. B. beim Johannes in der Pietä, bei der Madonna auf dem Bilde Broederlams oder bei Johannes dem
Täufer in dem Devotionsbilde des Herzogs von Berry (Fig. 40) jene scharf brüchige, fast barockreiche
Faltendarstellung, die
eine treue Begleiterin
der älteren gotischen
Kunst gewesen ist und
die den Wunsch er-
zeugt haben mag, die
einfachen Steinformeln
der frühgotischen Zeit
durch eine natürlichere
Stoffwiedergabe zu er-
setzen.
Wenn wir uns
ferner gleichzeitige ita-
lienische Bilder ver-
gegenwärtigen, so wer-
den wir bald die Ent-
deckung machen, daß
sich die nordfranzösi-
schen Werke von ihnen
nicht nur durch einen
inhaltlich größeren Na-
turalismus der Dar-
stellung unterscheiden
sondern auch durch
eine naturalistisch weit
fortgeschrittenere For-
menwiedergabe. Wie
schematisch ist das
beste italienische Por-
trät aus dem Trecento, mit den beiden Bildnissen des Herzogs von Berry im Brüsseler Gebetbuche
verglichen (Fig. 40). Wie lebenstreu und charakteristisch hier der Fürst dargestellt ist, können wir
erkennen, wenn wir diese Bildnisse mit jenem zusammenstellen, welches von ihm einer der Brüder
von Limburg in dem Gebetbuche von Chantilly malte (Fig. 44), oder mit der herrlichen Grabes-
figur aus der Sainte Chapelle in Bourges, die zwar stark zerstört ist, von deren ursprünglichen Gestalt
uns jedoch eine Zeichnung Holbeins einen guten Begriff geben kann (Fig. 53). Trotz der unver-
gleichlich größeren Beherrschung der naturalistischen Darstellungsmittel, die dem Illuminator des
Gebetbuches von Chantilly oder dem Bildhauer in Bourges zu Gebote stand, besagen uns die beiden
letzten Bildnisse über die Züge des Herzogs nicht mehr als das Werk des Jaquemart de Hesdin.
Die Naturalisten der Renaissance hätten uns über das leibliche nichts weniger als anmutige Aussehen
des berühmten Kunstfreundes nicht besser unterrichten können als dieser Büchermaler, der doch der
Zeit nach an der Schwelle des angenommenen älteren Idealismus stehen müßte. Dieselbe Beobachtung
Fig. 39. Unbekannter französischer Meister, Pieta.
Louvre.