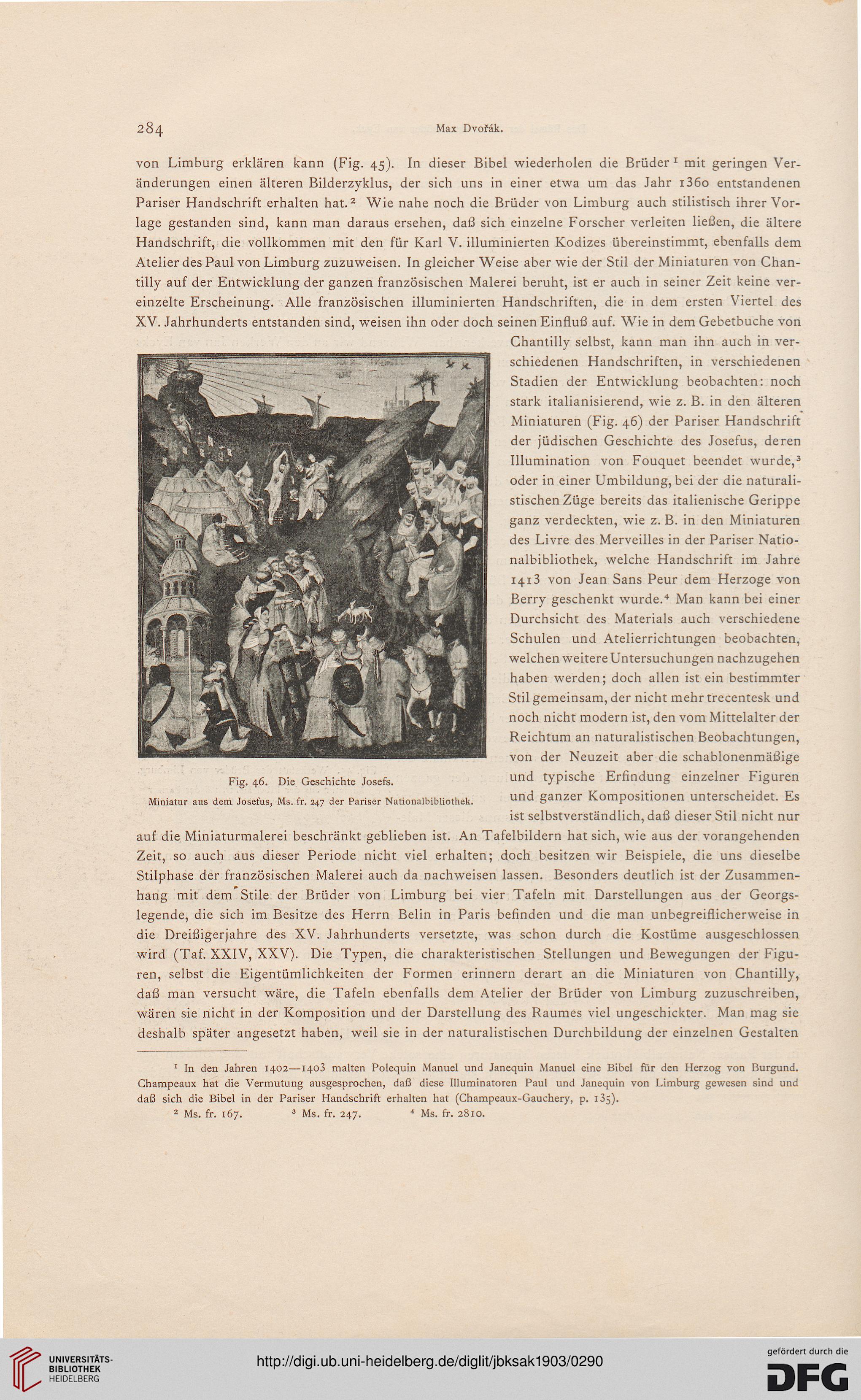284
Max Dvofäk.
von Limburg erklären kann (Fig. 45). In dieser Bibel wiederholen die Brüder 1 mit geringen Ver-
änderungen einen älteren Bilderzyklus, der sich uns in einer etwa um das Jahr i36o entstandenen
Pariser Handschrift erhalten hat.2 Wie nahe noch die Brüder von Limburg auch stilistisch ihrer Vor-
lage gestanden sind, kann man daraus ersehen, daß sich einzelne Forscher verleiten ließen, die ältere
Handschrift, die vollkommen mit den für Karl V. illuminierten Kodizes übereinstimmt, ebenfalls dem
Atelier des Paul von Limburg zuzuweisen. In gleicher Weise aber wie der Stil der Miniaturen von Chan-
tilly auf der Entwicklung der ganzen französischen Malerei beruht, ist er auch in seiner Zeit keine ver-
einzelte Erscheinung. Alle französischen illuminierten Handschriften, die in dem ersten Viertel des
XV. Jahrhunderts entstanden sind, weisen ihn oder doch seinen Einfluß auf. Wie in dem Gebetbuche von
Chantilly selbst, kann man ihn auch in ver-
schiedenen Handschriften, in verschiedenen
Stadien der Entwicklung beobachten: noch
stark italianisierend, wie z. B. in den älteren
Miniaturen (Fig. 46) der Pariser Handschrift
der jüdischen Geschichte des Josefus, deren
Illumination von Fouquet beendet wurde,3
oder in einer Umbildung, bei der die naturali-
stischen Züge bereits das italienische Gerippe
ganz verdeckten, wie z. B. in den Miniaturen
des Livre des Merveilles in der Pariser Natio-
nalbibliothek, welche Handschrift im Jahre
1413 von Jean Sans Peur dem Herzoge von
Berry geschenkt wurde.4 Man kann bei einer
Durchsicht des Materials auch verschiedene
Schulen und Atelierrichtungen beobachten,
welchen weitere Untersuchungen nachzugehen
haben werden; doch allen ist ein bestimmter
Stil gemeinsam, der nicht mehr trecentesk und
noch nicht modern ist, den vom Mittelalter der
Reichtum an naturalistischen Beobachtungen,
von der Neuzeit aber die schablonenmäßige
und typische Erfindung einzelner Figuren
und ganzer Kompositionen unterscheidet. Es
ist selbstverständlich, daß dieser Stil nicht nur
auf die Miniaturmalerei beschränkt geblieben ist. An Tafelbildern hat sich, wie aus der vorangehenden
Zeit, so auch aus dieser Periode nicht viel erhalten; doch besitzen wir Beispiele, die uns dieselbe
Stilphase der französischen Malerei auch da nachweisen lassen. Besonders deutlich ist der Zusammen-
hang mit dem Stile der Brüder von Limburg bei vier Tafeln mit Darstellungen aus der Georgs-
legende, die sich im Besitze des Herrn Belin in Paris befinden und die man unbegreiflicherweise in
die Dreißigerjahre des XV. Jahrhunderts versetzte, was schon durch die Kostüme ausgeschlossen
wird (Taf. XXIV, XXV). Die Typen, die charakteristischen Stellungen und Bewegungen der Figu-
ren, selbst die Eigentümlichkeiten der Formen erinnern derart an die Miniaturen von Chantilly,
daß man versucht wäre, die Tafeln ebenfalls dem Atelier der Brüder von Limburg zuzuschreiben,
wären sie nicht in der Komposition und der Darstellung des Raumes viel ungeschickter. Man mag sie
deshalb später angesetzt haben, weil sie in der naturalistischen Durchbildung der einzelnen Gestalten
Fig. 46. Die Geschichte Josefs.
Miniatur aus dem Josefus, Ms. fr. 247 der Pariser Nationalbibliothek.
1 In den Jahren 1402—1403 malten Polequin Manuel und Janequin Manuel eine Bibel für den Herzog von Burgund.
Champeaux hat die Vermutung ausgesprochen, daß diese Illuminatoren Paul und Janequin von Limburg gewesen sind und
daß sich die Bibel in der Pariser Handschrift erhalten hat (Champeaux-Gauchery, p. 135).
2 Ms. fr. 167. 3 Ms. fr. 247. 4 Ms. fr. 2810.
Max Dvofäk.
von Limburg erklären kann (Fig. 45). In dieser Bibel wiederholen die Brüder 1 mit geringen Ver-
änderungen einen älteren Bilderzyklus, der sich uns in einer etwa um das Jahr i36o entstandenen
Pariser Handschrift erhalten hat.2 Wie nahe noch die Brüder von Limburg auch stilistisch ihrer Vor-
lage gestanden sind, kann man daraus ersehen, daß sich einzelne Forscher verleiten ließen, die ältere
Handschrift, die vollkommen mit den für Karl V. illuminierten Kodizes übereinstimmt, ebenfalls dem
Atelier des Paul von Limburg zuzuweisen. In gleicher Weise aber wie der Stil der Miniaturen von Chan-
tilly auf der Entwicklung der ganzen französischen Malerei beruht, ist er auch in seiner Zeit keine ver-
einzelte Erscheinung. Alle französischen illuminierten Handschriften, die in dem ersten Viertel des
XV. Jahrhunderts entstanden sind, weisen ihn oder doch seinen Einfluß auf. Wie in dem Gebetbuche von
Chantilly selbst, kann man ihn auch in ver-
schiedenen Handschriften, in verschiedenen
Stadien der Entwicklung beobachten: noch
stark italianisierend, wie z. B. in den älteren
Miniaturen (Fig. 46) der Pariser Handschrift
der jüdischen Geschichte des Josefus, deren
Illumination von Fouquet beendet wurde,3
oder in einer Umbildung, bei der die naturali-
stischen Züge bereits das italienische Gerippe
ganz verdeckten, wie z. B. in den Miniaturen
des Livre des Merveilles in der Pariser Natio-
nalbibliothek, welche Handschrift im Jahre
1413 von Jean Sans Peur dem Herzoge von
Berry geschenkt wurde.4 Man kann bei einer
Durchsicht des Materials auch verschiedene
Schulen und Atelierrichtungen beobachten,
welchen weitere Untersuchungen nachzugehen
haben werden; doch allen ist ein bestimmter
Stil gemeinsam, der nicht mehr trecentesk und
noch nicht modern ist, den vom Mittelalter der
Reichtum an naturalistischen Beobachtungen,
von der Neuzeit aber die schablonenmäßige
und typische Erfindung einzelner Figuren
und ganzer Kompositionen unterscheidet. Es
ist selbstverständlich, daß dieser Stil nicht nur
auf die Miniaturmalerei beschränkt geblieben ist. An Tafelbildern hat sich, wie aus der vorangehenden
Zeit, so auch aus dieser Periode nicht viel erhalten; doch besitzen wir Beispiele, die uns dieselbe
Stilphase der französischen Malerei auch da nachweisen lassen. Besonders deutlich ist der Zusammen-
hang mit dem Stile der Brüder von Limburg bei vier Tafeln mit Darstellungen aus der Georgs-
legende, die sich im Besitze des Herrn Belin in Paris befinden und die man unbegreiflicherweise in
die Dreißigerjahre des XV. Jahrhunderts versetzte, was schon durch die Kostüme ausgeschlossen
wird (Taf. XXIV, XXV). Die Typen, die charakteristischen Stellungen und Bewegungen der Figu-
ren, selbst die Eigentümlichkeiten der Formen erinnern derart an die Miniaturen von Chantilly,
daß man versucht wäre, die Tafeln ebenfalls dem Atelier der Brüder von Limburg zuzuschreiben,
wären sie nicht in der Komposition und der Darstellung des Raumes viel ungeschickter. Man mag sie
deshalb später angesetzt haben, weil sie in der naturalistischen Durchbildung der einzelnen Gestalten
Fig. 46. Die Geschichte Josefs.
Miniatur aus dem Josefus, Ms. fr. 247 der Pariser Nationalbibliothek.
1 In den Jahren 1402—1403 malten Polequin Manuel und Janequin Manuel eine Bibel für den Herzog von Burgund.
Champeaux hat die Vermutung ausgesprochen, daß diese Illuminatoren Paul und Janequin von Limburg gewesen sind und
daß sich die Bibel in der Pariser Handschrift erhalten hat (Champeaux-Gauchery, p. 135).
2 Ms. fr. 167. 3 Ms. fr. 247. 4 Ms. fr. 2810.