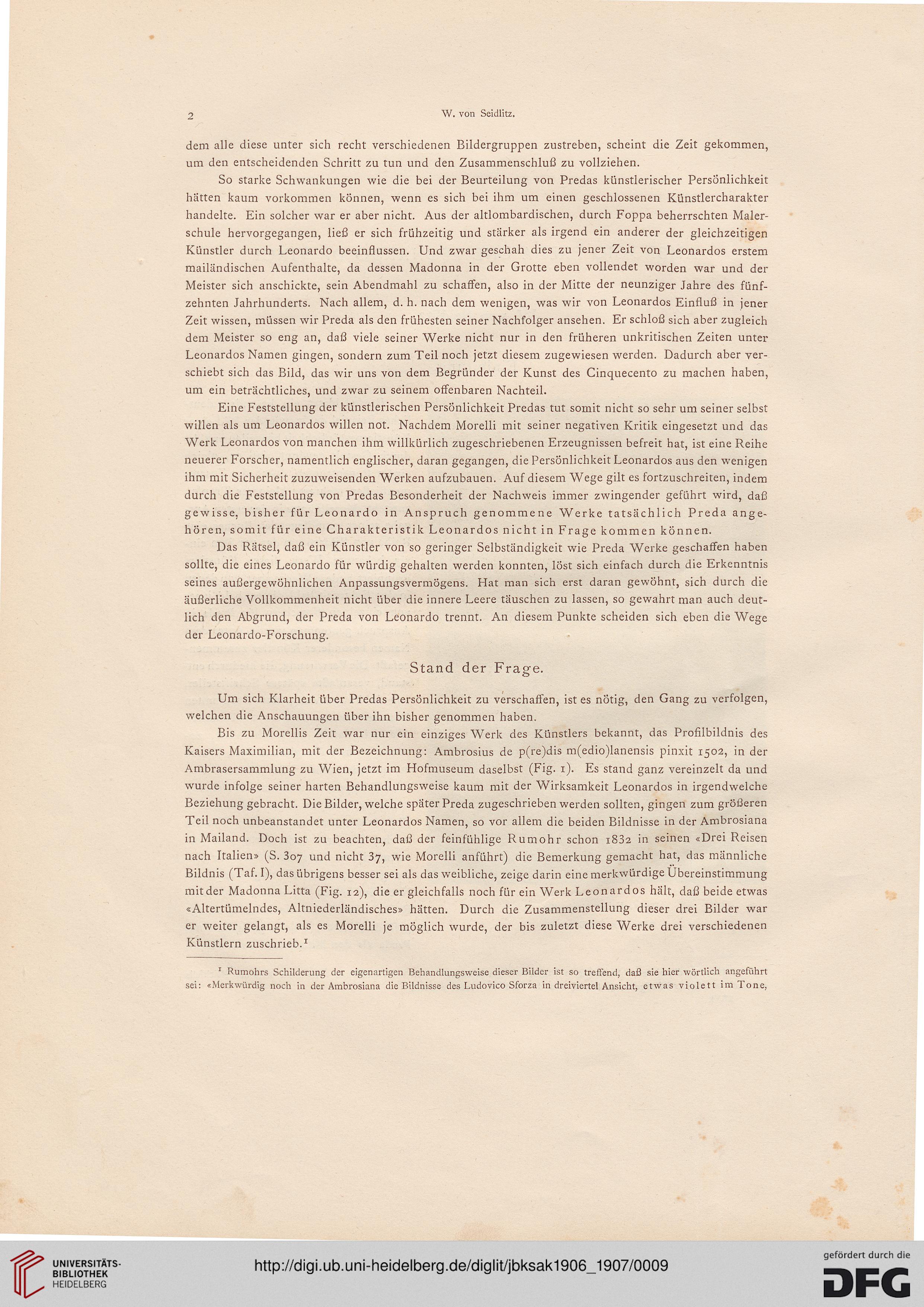2
W. von Seidlitz.
dem alle diese unter sich recht verschiedenen Bildergruppen zustreben, scheint die Zeit gekommen,
um den entscheidenden Schritt zu tun und den Zusammenschluß zu vollziehen.
So starke Schwankungen wie die bei der Beurteilung von Predas künstlerischer Persönlichkeit
hätten kaum vorkommen können, wenn es sich bei ihm um einen geschlossenen Künstlercharakter
handelte. Ein solcher war er aber nicht. Aus der altlombardischen, durch Foppa beherrschten Maler-
schule hervorgegangen, ließ er sich frühzeitig und stärker als irgend ein anderer der gleichzeitigen
Künstler durch Leonardo beeinflussen. Und zwar geschah dies zu jener Zeit von Leonardos erstem
mailändischen Aufenthalte, da dessen Madonna in der Grotte eben vollendet worden war und der
Meister sich anschickte, sein Abendmahl zu schaffen, also in der Mitte der neunziger Jahre des fünf-
zehnten Jahrhunderts. Nach allem, d. h. nach dem wenigen, was wir von Leonardos Einfluß in jener
Zeit wissen, müssen wir Preda als den frühesten seiner Nachfolger ansehen. Er schloß sich aber zugleich
dem Meister so eng an, daß viele seiner Werke nicht nur in den früheren unkritischen Zeiten unter
Leonardos Namen gingen, sondern zum Teil noch jetzt diesem zugewiesen werden. Dadurch aber ver-
schiebt sich das Bild, das wir uns von dem Begründer der Kunst des Cinquecento zu machen haben,
um ein beträchtliches, und zwar zu seinem offenbaren Nachteil.
Eine Feststellung der künstlerischen Persönlichkeit Predas tut somit nicht so sehr um seiner selbst
willen als um Leonardos willen not. Nachdem Morelli mit seiner negativen Kritik eingesetzt und das
Werk Leonardos von manchen ihm willkürlich zugeschriebenen Erzeugnissen befreit hat, ist eine Reihe
neuerer Forscher, namentlich englischer, daran gegangen, die Persönlichkeit Leonardos aus den wenigen
ihm mit Sicherheit zuzuweisenden Werken aufzubauen. Auf diesem Wege gilt es fortzuschreiten, indem
durch die Feststellung von Predas Besonderheit der Nachweis immer zwingender geführt wird, daß
gewisse, bisher für Leonardo in Anspruch genommene Werke tatsächlich Preda ange-
hören, somit für eine Charakteristik Leonardos nicht in Frage kommen können.
Das Rätsel, daß ein Künstler von so geringer Selbständigkeit wie Preda Werke geschaffen haben
sollte, die eines Leonardo für würdig gehalten werden konnten, löst sich einfach durch die Erkenntnis
seines außergewöhnlichen Anpassungsvermögens. Hat man sich erst daran gewöhnt, sich durch die
äußerliche Vollkommenheit nicht über die innere Leere täuschen zu lassen, so gewahrt man auch deut-
lich den Abgrund, der Preda von Leonardo trennt. An diesem Punkte scheiden sich eben die Wege
der Leonardo-Forschung.
Stand der Frage.
Um sich Klarheit über Predas Persönlichkeit zu verschaffen, ist es nötig, den Gang zu verfolgen,
welchen die Anschauungen über ihn bisher genommen haben.
Bis zu Morellis Zeit war nur ein einziges Werk des Künstlers bekannt, das Profilbildnis des
Kaisers Maximilian, mit der Bezeichnung: Ambrosius de p(re)dis m(edio)lanensis pinxit 1502, in der
Ambrasersammlung zu Wien, jetzt im Hofmuseum daselbst (Fig. 1). Es stand ganz vereinzelt da und
wurde infolge seiner harten Behandlungsweise kaum mit der Wirksamkeit Leonardos in irgendwelche
Beziehung gebracht. Die Bilder, welche später Preda zugeschrieben werden sollten, gingen zum größeren
Teil noch unbeanstandet unter Leonardos Namen, so vor allem die beiden Bildnisse in der Ambrosiana
in Mailand. Doch ist zu beachten, daß der feinfühlige Rumohr schon i832 in seinen «Drei Reisen
nach Italien» (S. 307 und nicht 37, wie Morelli anführt) die Bemerkung gemacht hat, das männliche
Bildnis (Taf. I), das übrigens besser sei als das weibliche, zeige darin eine merkwürdige Übereinstimmung
mitder Madonna Litta (Fig. 12), die er gleichfalls noch für ein Werk Leonardos hält, daß beide etwas
«Altertümelndes, Altniederländisches» hätten. Durch die Zusammenstellung dieser drei Bilder war
er weiter gelangt, als es Morelli je möglich wurde, der bis zuletzt diese Werke drei verschiedenen
Künstlern zuschrieb.1
1 Rumohrs Schilderung der eigenartigen Behandlungsweise dieser Bilder ist so treffend, daß sie hier wörtlich angeführt
sei: «Merkwürdig noch in der Ambrosiana die Bildnisse des Ludovico Sforza in dreiviertel Ansicht, etwas violett im Tone,
W. von Seidlitz.
dem alle diese unter sich recht verschiedenen Bildergruppen zustreben, scheint die Zeit gekommen,
um den entscheidenden Schritt zu tun und den Zusammenschluß zu vollziehen.
So starke Schwankungen wie die bei der Beurteilung von Predas künstlerischer Persönlichkeit
hätten kaum vorkommen können, wenn es sich bei ihm um einen geschlossenen Künstlercharakter
handelte. Ein solcher war er aber nicht. Aus der altlombardischen, durch Foppa beherrschten Maler-
schule hervorgegangen, ließ er sich frühzeitig und stärker als irgend ein anderer der gleichzeitigen
Künstler durch Leonardo beeinflussen. Und zwar geschah dies zu jener Zeit von Leonardos erstem
mailändischen Aufenthalte, da dessen Madonna in der Grotte eben vollendet worden war und der
Meister sich anschickte, sein Abendmahl zu schaffen, also in der Mitte der neunziger Jahre des fünf-
zehnten Jahrhunderts. Nach allem, d. h. nach dem wenigen, was wir von Leonardos Einfluß in jener
Zeit wissen, müssen wir Preda als den frühesten seiner Nachfolger ansehen. Er schloß sich aber zugleich
dem Meister so eng an, daß viele seiner Werke nicht nur in den früheren unkritischen Zeiten unter
Leonardos Namen gingen, sondern zum Teil noch jetzt diesem zugewiesen werden. Dadurch aber ver-
schiebt sich das Bild, das wir uns von dem Begründer der Kunst des Cinquecento zu machen haben,
um ein beträchtliches, und zwar zu seinem offenbaren Nachteil.
Eine Feststellung der künstlerischen Persönlichkeit Predas tut somit nicht so sehr um seiner selbst
willen als um Leonardos willen not. Nachdem Morelli mit seiner negativen Kritik eingesetzt und das
Werk Leonardos von manchen ihm willkürlich zugeschriebenen Erzeugnissen befreit hat, ist eine Reihe
neuerer Forscher, namentlich englischer, daran gegangen, die Persönlichkeit Leonardos aus den wenigen
ihm mit Sicherheit zuzuweisenden Werken aufzubauen. Auf diesem Wege gilt es fortzuschreiten, indem
durch die Feststellung von Predas Besonderheit der Nachweis immer zwingender geführt wird, daß
gewisse, bisher für Leonardo in Anspruch genommene Werke tatsächlich Preda ange-
hören, somit für eine Charakteristik Leonardos nicht in Frage kommen können.
Das Rätsel, daß ein Künstler von so geringer Selbständigkeit wie Preda Werke geschaffen haben
sollte, die eines Leonardo für würdig gehalten werden konnten, löst sich einfach durch die Erkenntnis
seines außergewöhnlichen Anpassungsvermögens. Hat man sich erst daran gewöhnt, sich durch die
äußerliche Vollkommenheit nicht über die innere Leere täuschen zu lassen, so gewahrt man auch deut-
lich den Abgrund, der Preda von Leonardo trennt. An diesem Punkte scheiden sich eben die Wege
der Leonardo-Forschung.
Stand der Frage.
Um sich Klarheit über Predas Persönlichkeit zu verschaffen, ist es nötig, den Gang zu verfolgen,
welchen die Anschauungen über ihn bisher genommen haben.
Bis zu Morellis Zeit war nur ein einziges Werk des Künstlers bekannt, das Profilbildnis des
Kaisers Maximilian, mit der Bezeichnung: Ambrosius de p(re)dis m(edio)lanensis pinxit 1502, in der
Ambrasersammlung zu Wien, jetzt im Hofmuseum daselbst (Fig. 1). Es stand ganz vereinzelt da und
wurde infolge seiner harten Behandlungsweise kaum mit der Wirksamkeit Leonardos in irgendwelche
Beziehung gebracht. Die Bilder, welche später Preda zugeschrieben werden sollten, gingen zum größeren
Teil noch unbeanstandet unter Leonardos Namen, so vor allem die beiden Bildnisse in der Ambrosiana
in Mailand. Doch ist zu beachten, daß der feinfühlige Rumohr schon i832 in seinen «Drei Reisen
nach Italien» (S. 307 und nicht 37, wie Morelli anführt) die Bemerkung gemacht hat, das männliche
Bildnis (Taf. I), das übrigens besser sei als das weibliche, zeige darin eine merkwürdige Übereinstimmung
mitder Madonna Litta (Fig. 12), die er gleichfalls noch für ein Werk Leonardos hält, daß beide etwas
«Altertümelndes, Altniederländisches» hätten. Durch die Zusammenstellung dieser drei Bilder war
er weiter gelangt, als es Morelli je möglich wurde, der bis zuletzt diese Werke drei verschiedenen
Künstlern zuschrieb.1
1 Rumohrs Schilderung der eigenartigen Behandlungsweise dieser Bilder ist so treffend, daß sie hier wörtlich angeführt
sei: «Merkwürdig noch in der Ambrosiana die Bildnisse des Ludovico Sforza in dreiviertel Ansicht, etwas violett im Tone,