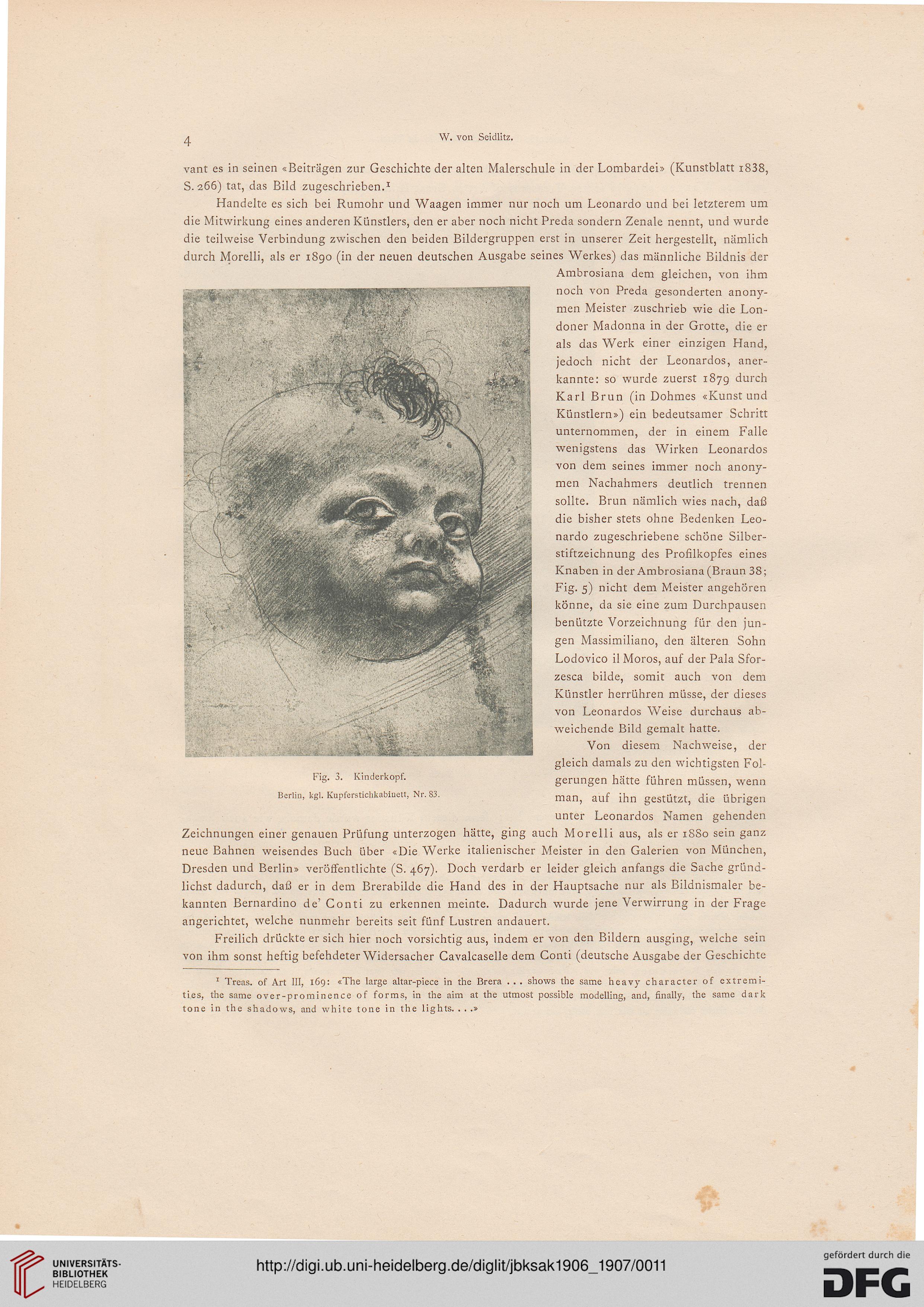4
\V. von Seidlitz.
vant es in seinen «Beitragen zur Geschichte der alten Malerschule in der Lombardei» (Kunstblatt i838,
S. 266) tat, das Bild zugeschrieben.1
Handelte es sich bei Rumohr und Waagen immer nur noch um Leonardo und bei letzterem um
die Mitwirkung eines anderen Künstlers, den er aber noch nicht Preda sondern Zenale nennt, und wurde
die teilweise Verbindung zwischen den beiden Bildergruppen erst in unserer Zeit hergestellt, nämlich
durch Morelli, als er 1890 (in der neuen deutschen Ausgabe seines Werkes) das männliche Bildnis der
Ambrosiana dem gleichen, von ihm
noch von Preda gesonderten anony-
men Meister zuschrieb wie die Lon-
doner Madonna in der Grotte, die er
als das Werk einer einzigen Hand,
jedoch nicht der Leonardos, aner-
kannte: so wurde zuerst 187g durch
Karl Brun (in Dohmes «Kunst und
Künstlern») ein bedeutsamer Schritt
unternommen, der in einem Falle
wenigstens das Wirken Leonardos
von dem seines immer noch anony-
men Nachahmers deutlich trennen
sollte. Brun nämlich wies nach, daß
die bisher stets ohne Bedenken Leo-
nardo zugeschriebene schöne Silber-
stiftzeichnung des Profilkopfes eines
Knaben in der Ambrosiana (Braun 38;
Fig. 5) nicht dem Meister angehören
könne, da sie eine zum Durchpausen
benützte Vorzeichnung für den jun-
gen Massimiliano, den älteren Sohn
Lodovico il Moros, auf der Pala Sfor-
zesca bilde, somit auch von dem
Künstler herrühren müsse, der dieses
von Leonardos Weise durchaus ab-
weichende Bild gemalt hatte.
Von diesem Nachweise, der
gleich damals zu den wichtigsten Fol-
gerungen hatte führen müssen, wenn
man, auf ihn gestützt, die übrigen
unter Leonardos Namen gehenden
Zeichnungen einer genauen Prüfung unterzogen hätte, ging auch Morelli aus, als er 1880 sein ganz
neue Bahnen weisendes Buch über «Die Werke italienischer Meister in den Galerien von München,
Dresden und Berlin» veröffentlichte (S. 467). Doch verdarb er leider gleich anfangs die Sache gründ-
lichst dadurch, daß er in dem Brerabilde die Hand des in der Hauptsache nur als Bildnismaler be-
kannten Bernardino de' Conti zu erkennen meinte. Dadurch wurde jene Verwirrung in der Frage
angerichtet, welche nunmehr bereits seit fünf Lustren andauert.
Freilich drückte ersieh hier noch vorsichtig aus, indem er von den Bildern ausging, welche sein
von ihm sonst heftig befehdeter Widersacher Cavalcaselle dem Conti (deutsche Ausgabe der Geschichte
1 Treas. of Art III, 169: «The large altar-piece in the Brera . . . shows the same heavy character of extremi-
ties, the same over-prominence of forms, in the aim at the utmost possible modelling, and, finally, the same dark
tone in the shadows, and white tone in the lights. . . .»
Fig. 3. Kinderkopf.
Berlin, kgl. Kupferstichkabiuett, Nr. 83.
\V. von Seidlitz.
vant es in seinen «Beitragen zur Geschichte der alten Malerschule in der Lombardei» (Kunstblatt i838,
S. 266) tat, das Bild zugeschrieben.1
Handelte es sich bei Rumohr und Waagen immer nur noch um Leonardo und bei letzterem um
die Mitwirkung eines anderen Künstlers, den er aber noch nicht Preda sondern Zenale nennt, und wurde
die teilweise Verbindung zwischen den beiden Bildergruppen erst in unserer Zeit hergestellt, nämlich
durch Morelli, als er 1890 (in der neuen deutschen Ausgabe seines Werkes) das männliche Bildnis der
Ambrosiana dem gleichen, von ihm
noch von Preda gesonderten anony-
men Meister zuschrieb wie die Lon-
doner Madonna in der Grotte, die er
als das Werk einer einzigen Hand,
jedoch nicht der Leonardos, aner-
kannte: so wurde zuerst 187g durch
Karl Brun (in Dohmes «Kunst und
Künstlern») ein bedeutsamer Schritt
unternommen, der in einem Falle
wenigstens das Wirken Leonardos
von dem seines immer noch anony-
men Nachahmers deutlich trennen
sollte. Brun nämlich wies nach, daß
die bisher stets ohne Bedenken Leo-
nardo zugeschriebene schöne Silber-
stiftzeichnung des Profilkopfes eines
Knaben in der Ambrosiana (Braun 38;
Fig. 5) nicht dem Meister angehören
könne, da sie eine zum Durchpausen
benützte Vorzeichnung für den jun-
gen Massimiliano, den älteren Sohn
Lodovico il Moros, auf der Pala Sfor-
zesca bilde, somit auch von dem
Künstler herrühren müsse, der dieses
von Leonardos Weise durchaus ab-
weichende Bild gemalt hatte.
Von diesem Nachweise, der
gleich damals zu den wichtigsten Fol-
gerungen hatte führen müssen, wenn
man, auf ihn gestützt, die übrigen
unter Leonardos Namen gehenden
Zeichnungen einer genauen Prüfung unterzogen hätte, ging auch Morelli aus, als er 1880 sein ganz
neue Bahnen weisendes Buch über «Die Werke italienischer Meister in den Galerien von München,
Dresden und Berlin» veröffentlichte (S. 467). Doch verdarb er leider gleich anfangs die Sache gründ-
lichst dadurch, daß er in dem Brerabilde die Hand des in der Hauptsache nur als Bildnismaler be-
kannten Bernardino de' Conti zu erkennen meinte. Dadurch wurde jene Verwirrung in der Frage
angerichtet, welche nunmehr bereits seit fünf Lustren andauert.
Freilich drückte ersieh hier noch vorsichtig aus, indem er von den Bildern ausging, welche sein
von ihm sonst heftig befehdeter Widersacher Cavalcaselle dem Conti (deutsche Ausgabe der Geschichte
1 Treas. of Art III, 169: «The large altar-piece in the Brera . . . shows the same heavy character of extremi-
ties, the same over-prominence of forms, in the aim at the utmost possible modelling, and, finally, the same dark
tone in the shadows, and white tone in the lights. . . .»
Fig. 3. Kinderkopf.
Berlin, kgl. Kupferstichkabiuett, Nr. 83.