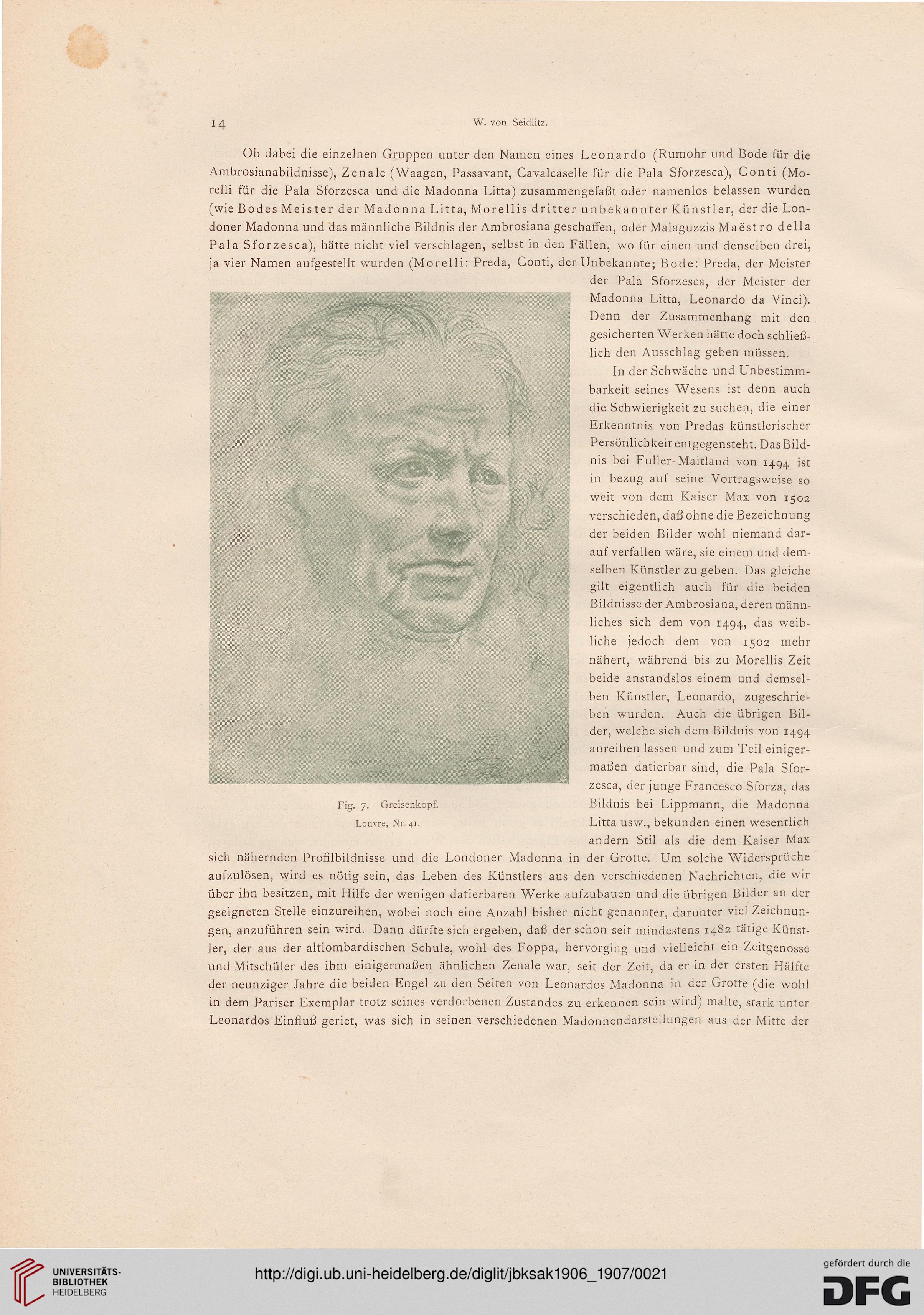14
W. von Seidlitz.
Ob dabei die einzelnen Gruppen unter den Namen eines Leonardo (Rumohr und Bode für die
Ambrosianabildnisse), Zenale (Waagen, Passavant, Cavalcaselle für die Pala Sforzesca), Conti (Mo-
relli für die Pala Sforzesca und die Madonna Litta) zusammengefaßt oder namenlos belassen wurden
(wie Bodes Meister der Madonna Litta, Morellis dritter unbekannter Künstler, der die Lon-
doner Madonna und das männliche Bildnis der Ambrosiana geschaffen, oder Malaguzzis Maestro della
Pala Sforzesca), hätte nicht viel verschlagen, selbst in den Fällen, wo für einen und denselben drei,
ja vier Namen aufgestellt wurden (Morelli: Preda, Conti, der Unbekannte; Bode: Preda, der Meister
der Pala Sforzesca, der Meister der
Madonna Litta, Leonardo da Vinci).
Denn der Zusammenhang mit den
gesicherten Werken hätte doch schließ-
lich den Ausschlag geben müssen.
In der Schwäche und Unbestimm-
barkeit seines Wesens ist denn auch
die Schwierigkeit zu suchen, die einer
Erkenntnis von Predas künstlerischer
Persönlichkeit entgegensteht. Das Bild-
nis bei Füller-Maitland von 1494 ist
in bezug auf seine Vortragsweise so
weit von dem Kaiser Max von 1502
verschieden, daß ohne die Bezeichnung
der beiden Bilder wohl niemand dar-
auf verfallen wäre, sie einem und dem-
selben Künstler zu geben. Das gleiche
gilt eigentlich auch für die beiden
Bildnisse der Ambrosiana, deren männ-
liches sich dem von 1494, das weib-
liche jedoch dem von 1502 mehr
nähert, während bis zu Morellis Zeit
beide anstandslos einem und demsel-
ben Künstler, Leonardo, zugeschrie-
ben wurden. Auch die übrigen Bil-
der, welche sich dem Bildnis von 1494
anreihen lassen und zum Teil einiger-
maßen datierbar sind, die Pala Sfor-
zesca, der junge Francesco Sforza, das
Bildnis bei Lippmann, die Madonna
Litta usw., bekunden einen wesentlich
andern Stil als die dem Kaiser Max
sich nähernden Profilbildnisse und die Londoner Madonna in der Grotte. Um solche Widersprüche
aufzulösen, wird es nötig sein, das Leben des Künstlers aus den verschiedenen Nachrichten, die wir
über ihn besitzen, mit Hilfe der wenigen datierbaren Werke aufzubauen und die übrigen Bilder an der
geeigneten Stelle einzureihen, wobei noch eine Anzahl bisher nicht genannter, darunter viel Zeichnun-
gen, anzuführen sein wird. Dann dürfte sich ergeben, daß der schon seit mindestens 1482 tätige Künst-
ler, der aus der altlombardischen Schule, wohl des Foppa, hervorging und vielleicht ein Zeitgenosse
und Mitschüler des ihm einigermaßen ähnlichen Zenale war, seit der Zeit, da er in der ersten Hälfte
der neunziger Jahre die beiden Engel zu den Seiten von Leonardos Madonna in der Grotte (die wohl
in dem Pariser Exemplar trotz seines verdorbenen Zustandes zu erkennen sein wird) malte, stark unter
Leonardos Einfluß geriet, was sich in seinen verschiedenen Madonnendarstellungen aus der Mitte der
■■■■■
mmSmä
Fig. 7. Greisenkopf.
Louvre, Nr. 41.
W. von Seidlitz.
Ob dabei die einzelnen Gruppen unter den Namen eines Leonardo (Rumohr und Bode für die
Ambrosianabildnisse), Zenale (Waagen, Passavant, Cavalcaselle für die Pala Sforzesca), Conti (Mo-
relli für die Pala Sforzesca und die Madonna Litta) zusammengefaßt oder namenlos belassen wurden
(wie Bodes Meister der Madonna Litta, Morellis dritter unbekannter Künstler, der die Lon-
doner Madonna und das männliche Bildnis der Ambrosiana geschaffen, oder Malaguzzis Maestro della
Pala Sforzesca), hätte nicht viel verschlagen, selbst in den Fällen, wo für einen und denselben drei,
ja vier Namen aufgestellt wurden (Morelli: Preda, Conti, der Unbekannte; Bode: Preda, der Meister
der Pala Sforzesca, der Meister der
Madonna Litta, Leonardo da Vinci).
Denn der Zusammenhang mit den
gesicherten Werken hätte doch schließ-
lich den Ausschlag geben müssen.
In der Schwäche und Unbestimm-
barkeit seines Wesens ist denn auch
die Schwierigkeit zu suchen, die einer
Erkenntnis von Predas künstlerischer
Persönlichkeit entgegensteht. Das Bild-
nis bei Füller-Maitland von 1494 ist
in bezug auf seine Vortragsweise so
weit von dem Kaiser Max von 1502
verschieden, daß ohne die Bezeichnung
der beiden Bilder wohl niemand dar-
auf verfallen wäre, sie einem und dem-
selben Künstler zu geben. Das gleiche
gilt eigentlich auch für die beiden
Bildnisse der Ambrosiana, deren männ-
liches sich dem von 1494, das weib-
liche jedoch dem von 1502 mehr
nähert, während bis zu Morellis Zeit
beide anstandslos einem und demsel-
ben Künstler, Leonardo, zugeschrie-
ben wurden. Auch die übrigen Bil-
der, welche sich dem Bildnis von 1494
anreihen lassen und zum Teil einiger-
maßen datierbar sind, die Pala Sfor-
zesca, der junge Francesco Sforza, das
Bildnis bei Lippmann, die Madonna
Litta usw., bekunden einen wesentlich
andern Stil als die dem Kaiser Max
sich nähernden Profilbildnisse und die Londoner Madonna in der Grotte. Um solche Widersprüche
aufzulösen, wird es nötig sein, das Leben des Künstlers aus den verschiedenen Nachrichten, die wir
über ihn besitzen, mit Hilfe der wenigen datierbaren Werke aufzubauen und die übrigen Bilder an der
geeigneten Stelle einzureihen, wobei noch eine Anzahl bisher nicht genannter, darunter viel Zeichnun-
gen, anzuführen sein wird. Dann dürfte sich ergeben, daß der schon seit mindestens 1482 tätige Künst-
ler, der aus der altlombardischen Schule, wohl des Foppa, hervorging und vielleicht ein Zeitgenosse
und Mitschüler des ihm einigermaßen ähnlichen Zenale war, seit der Zeit, da er in der ersten Hälfte
der neunziger Jahre die beiden Engel zu den Seiten von Leonardos Madonna in der Grotte (die wohl
in dem Pariser Exemplar trotz seines verdorbenen Zustandes zu erkennen sein wird) malte, stark unter
Leonardos Einfluß geriet, was sich in seinen verschiedenen Madonnendarstellungen aus der Mitte der
■■■■■
mmSmä
Fig. 7. Greisenkopf.
Louvre, Nr. 41.