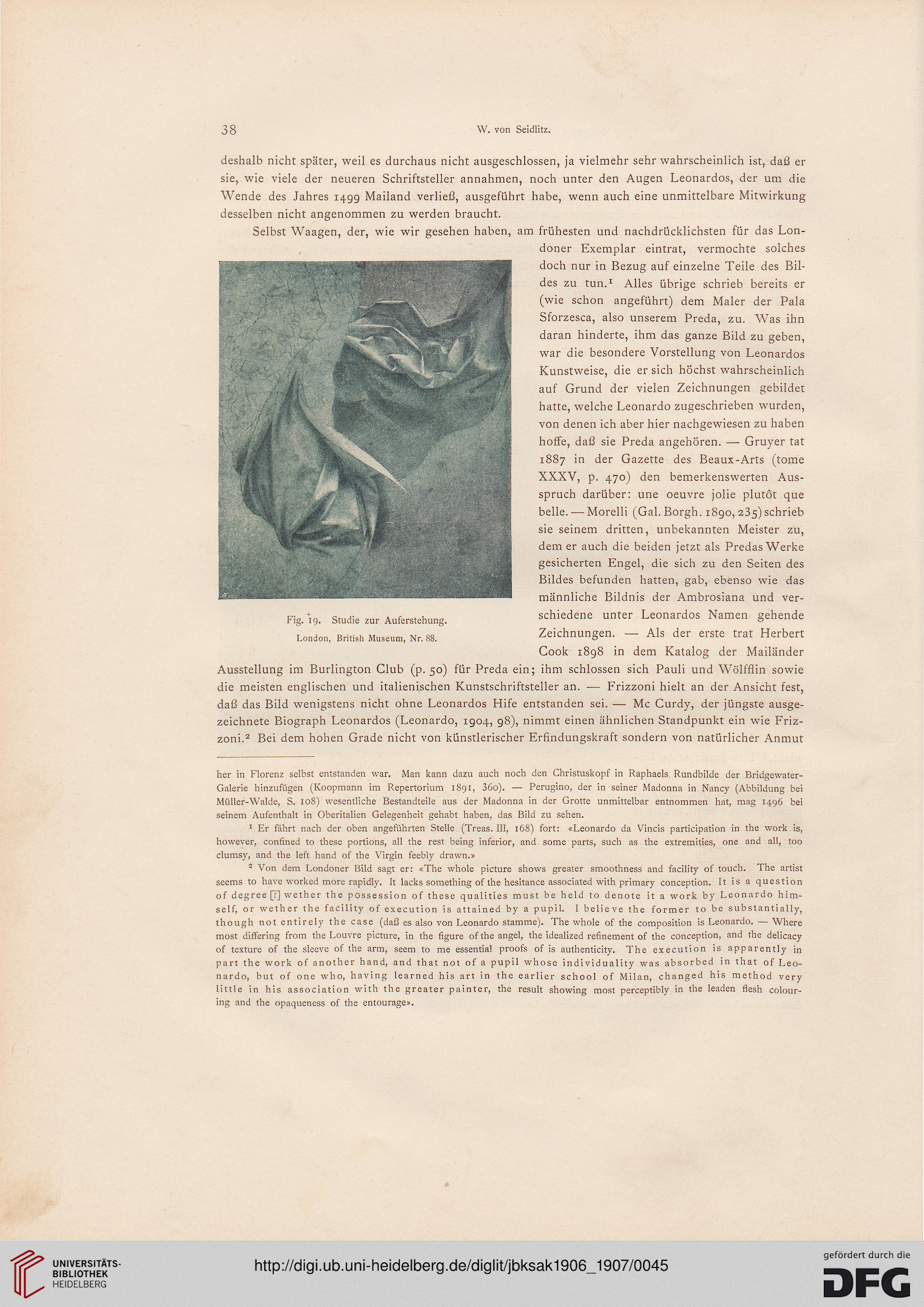38
\V. von Seidlitz.
deshalb nicht später, weil es durchaus nicht ausgeschlossen, ja vielmehr sehr wahrscheinlich ist, daß er
sie, wie viele der neueren Schriftsteller annahmen, noch unter den Augen Leonardos, der um die
Wende des Jahres 1499 Mailand verließ, ausgeführt habe, wenn auch eine unmittelbare Mitwirkung
desselben nicht angenommen zu werden braucht.
Selbst Waagen, der, wie wir gesehen haben, am frühesten und nachdrücklichsten für das Lon-
doner Exemplar eintrat, vermochte solches
doch nur in Bezug auf einzelne Teile des Bil-
des zu tun.1 Alles übrige schrieb bereits er
(wie schon angeführt) dem Maler der Pala
Sforzesca, also unserem Preda, zu. Was ihn
daran hinderte, ihm das ganze Bild zu geben,
war die besondere Vorstellung von Leonardos
Kunstweise, die er sich höchst wahrscheinlich
auf Grund der vielen Zeichnungen gebildet
hatte, welche Leonardo zugeschrieben wurden,
von denen ich aber hier nachgewiesen zu haben
hoffe, daß sie Preda angehören. — Gruyer tat
1887 in der Gazette des Beaux-Arts (tome
XXXV, p. 470) den bemerkenswerten Aus-
spruch darüber: une oeuvre jolie plutot que
belle. — Morelli (Gal. Borgh. 1890, 235) schrieb
sie seinem dritten, unbekannten Meister zu,
dem er auch die beiden jetzt als Predas Werke
gesicherten Engel, die sich zu den Seiten des
Bildes befunden hatten, gab, ebenso wie das
männliche Bildnis der Ambrosiana und ver-
Fig. 19. Studie zur Auferstehung. schiedene unter Leonardos Namen gehende
London, British Museum, Nr. 88. Zeichnungen. — Als der erste trat Herbert
Cook 1898 in dem Katalog der Mailänder
Ausstellung im Burlington Club (p. 50) für Preda ein; ihm schlössen sich Pauli und Wölffiin sowie
die meisten englischen und italienischen Kunstschriftsteller an. — Frizzoni hielt an der Ansicht fest,
daß das Bild wenigstens nicht ohne Leonardos Hife entstanden sei. — Mc Curdy, der jüngste ausge-
zeichnete Biograph Leonardos (Leonardo, 1904, 98), nimmt einen ähnlichen Standpunkt ein wie Friz-
zoni.2 Bei dem hohen Grade nicht von künstlerischer Erfindungskraft sondern von natürlicher Anmut
her in Florenz selbst entstanden war. Man kann dazu auch noch den Christuskopf in Raphaels Rundbilde der Bridgewater-
Galerie hinzufügen (Koopmann im Repertorium 1891, 36o). — Perugino, der in seiner Madonna in Nancy (Abbildung bei
Müller-Walde, S. 108) wesentliche Bestandteile aus der Madonna in der Grotte unmittelbar entnommen hat, mag 1496 bei
seinem Aufenthalt in Oberitalien Gelegenheit gehabt haben, das Bild zu sehen.
1 Er fährt nach der oben angeführten Stelle (Treas. III, 168) fort: «Leonardo da Vincis participation in the work is,
however, confined to these portions, all the rest being inferior, and some parts, such as the extremities, one and all, too
clumsy, and the left hand of the Virgin feebly drawn.»
2 Von dem Londoner Bild sagt er: «The whole picture shows greater smoothness and facility of touch. The artist
seems to have worked more rapidly. It lacks something of the hesitance associated with primary conception. It is a question
of degree [?] wether the possession of these qualities must be held to denote it a work by Leonardo him-
self, or wether the facility of execution is attained by a pupil. I believe the former to be substantially,
though notentirely the case (daß es also von Leonardo stamme). The whole of the composition is Leonardo. — Where
most differing from the Louvre picture, in the figure of the angel, the idealized refinement of the conception, and the delicacy
of texture of the sleeve of the arm, seem to me essential. proofs of is authenticity. The execution is apparently in
part the work of another hand, and that not of a pupil whose individuality was absorbed in that of Leo-
nardo, but of one who, having learned his art in the earlier school of Milan, changed his method very
little in his association with the greater painter, the result showing most perceptibly in the leaden flesh colour-
ing and the opaqueness of the entourage».
*
\V. von Seidlitz.
deshalb nicht später, weil es durchaus nicht ausgeschlossen, ja vielmehr sehr wahrscheinlich ist, daß er
sie, wie viele der neueren Schriftsteller annahmen, noch unter den Augen Leonardos, der um die
Wende des Jahres 1499 Mailand verließ, ausgeführt habe, wenn auch eine unmittelbare Mitwirkung
desselben nicht angenommen zu werden braucht.
Selbst Waagen, der, wie wir gesehen haben, am frühesten und nachdrücklichsten für das Lon-
doner Exemplar eintrat, vermochte solches
doch nur in Bezug auf einzelne Teile des Bil-
des zu tun.1 Alles übrige schrieb bereits er
(wie schon angeführt) dem Maler der Pala
Sforzesca, also unserem Preda, zu. Was ihn
daran hinderte, ihm das ganze Bild zu geben,
war die besondere Vorstellung von Leonardos
Kunstweise, die er sich höchst wahrscheinlich
auf Grund der vielen Zeichnungen gebildet
hatte, welche Leonardo zugeschrieben wurden,
von denen ich aber hier nachgewiesen zu haben
hoffe, daß sie Preda angehören. — Gruyer tat
1887 in der Gazette des Beaux-Arts (tome
XXXV, p. 470) den bemerkenswerten Aus-
spruch darüber: une oeuvre jolie plutot que
belle. — Morelli (Gal. Borgh. 1890, 235) schrieb
sie seinem dritten, unbekannten Meister zu,
dem er auch die beiden jetzt als Predas Werke
gesicherten Engel, die sich zu den Seiten des
Bildes befunden hatten, gab, ebenso wie das
männliche Bildnis der Ambrosiana und ver-
Fig. 19. Studie zur Auferstehung. schiedene unter Leonardos Namen gehende
London, British Museum, Nr. 88. Zeichnungen. — Als der erste trat Herbert
Cook 1898 in dem Katalog der Mailänder
Ausstellung im Burlington Club (p. 50) für Preda ein; ihm schlössen sich Pauli und Wölffiin sowie
die meisten englischen und italienischen Kunstschriftsteller an. — Frizzoni hielt an der Ansicht fest,
daß das Bild wenigstens nicht ohne Leonardos Hife entstanden sei. — Mc Curdy, der jüngste ausge-
zeichnete Biograph Leonardos (Leonardo, 1904, 98), nimmt einen ähnlichen Standpunkt ein wie Friz-
zoni.2 Bei dem hohen Grade nicht von künstlerischer Erfindungskraft sondern von natürlicher Anmut
her in Florenz selbst entstanden war. Man kann dazu auch noch den Christuskopf in Raphaels Rundbilde der Bridgewater-
Galerie hinzufügen (Koopmann im Repertorium 1891, 36o). — Perugino, der in seiner Madonna in Nancy (Abbildung bei
Müller-Walde, S. 108) wesentliche Bestandteile aus der Madonna in der Grotte unmittelbar entnommen hat, mag 1496 bei
seinem Aufenthalt in Oberitalien Gelegenheit gehabt haben, das Bild zu sehen.
1 Er fährt nach der oben angeführten Stelle (Treas. III, 168) fort: «Leonardo da Vincis participation in the work is,
however, confined to these portions, all the rest being inferior, and some parts, such as the extremities, one and all, too
clumsy, and the left hand of the Virgin feebly drawn.»
2 Von dem Londoner Bild sagt er: «The whole picture shows greater smoothness and facility of touch. The artist
seems to have worked more rapidly. It lacks something of the hesitance associated with primary conception. It is a question
of degree [?] wether the possession of these qualities must be held to denote it a work by Leonardo him-
self, or wether the facility of execution is attained by a pupil. I believe the former to be substantially,
though notentirely the case (daß es also von Leonardo stamme). The whole of the composition is Leonardo. — Where
most differing from the Louvre picture, in the figure of the angel, the idealized refinement of the conception, and the delicacy
of texture of the sleeve of the arm, seem to me essential. proofs of is authenticity. The execution is apparently in
part the work of another hand, and that not of a pupil whose individuality was absorbed in that of Leo-
nardo, but of one who, having learned his art in the earlier school of Milan, changed his method very
little in his association with the greater painter, the result showing most perceptibly in the leaden flesh colour-
ing and the opaqueness of the entourage».
*