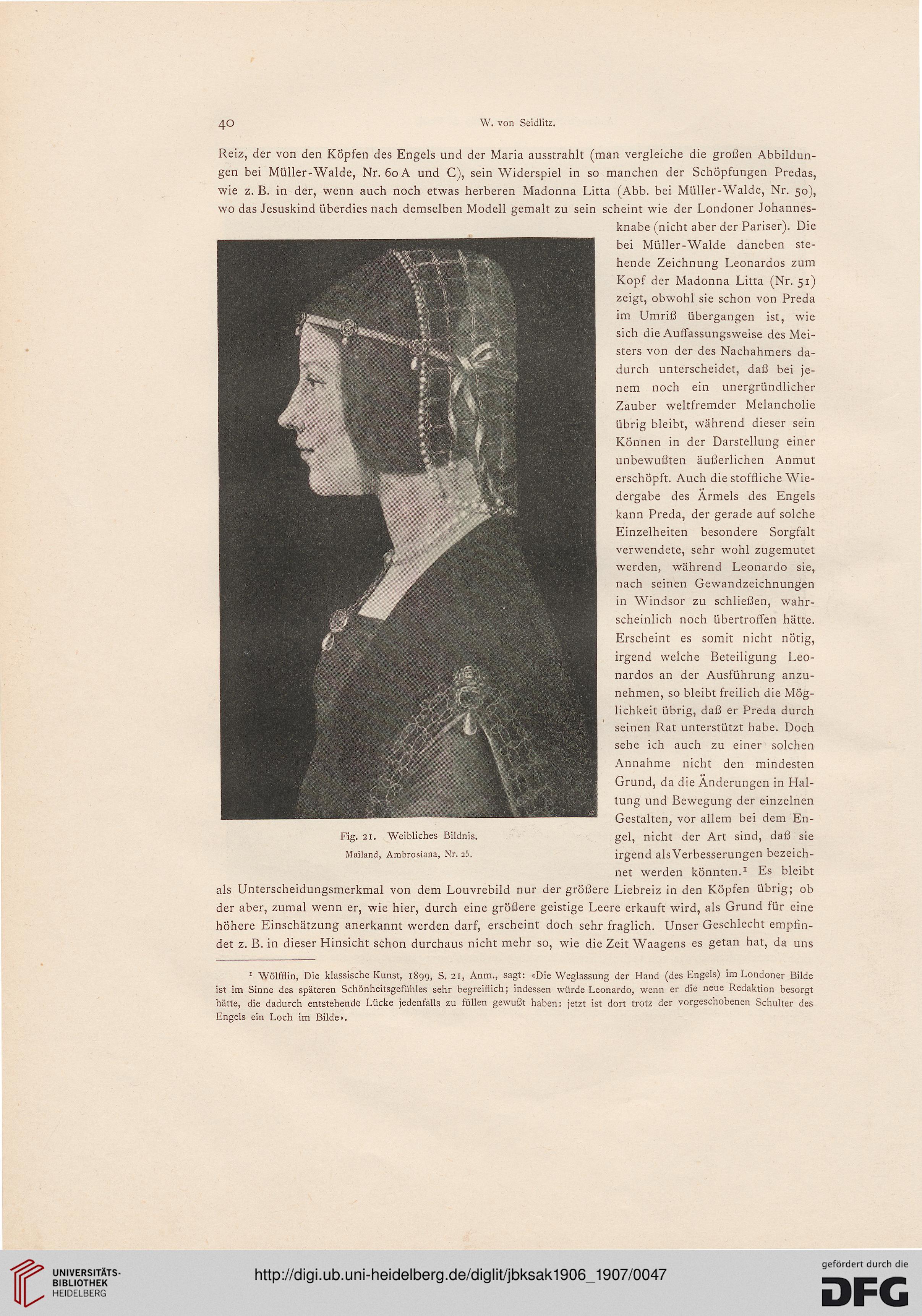40
W. von Seidlitz.
Reiz, der von den Köpfen des Engels und der Maria ausstrahlt (man vergleiche die großen Abbildun-
gen bei Müller-Walde, Nr. 60 A und C), sein Widerspiel in so manchen der Schöpfungen Predas,
wie z. B. in der, wenn auch noch etwas herberen Madonna Litta (Abb. bei Müller-Walde, Nr. 50),
wo das Jesuskind überdies nach demselben Modell gemalt zu sein scheint wie der Londoner Johannes-
knabe (nicht aber der Pariser). Die
bei Müller-Walde daneben ste-
hende Zeichnung Leonardos zum
Kopf der Madonna Litta (Nr. 51)
zeigt, obwohl sie schon von Preda
im Umriß übergangen ist, wie
sich die Auffassungsweise des Mei-
sters von der des Nachahmers da-
durch unterscheidet, daß bei je-
nem noch ein unergründlicher
Zauber weltfremder Melancholie
übrig bleibt, während dieser sein
Können in der Darstellung einer
unbewußten äußerlichen Anmut
erschöpft. Auch die stoffliche Wie-
dergabe des Armeis des Engels
kann Preda, der gerade auf solche
Einzelheiten besondere Sorgfalt
verwendete, sehr wohl zugemutet
werden, während Leonardo sie,
nach seinen Gewandzeichnungen
in Windsor zu schließen, wahr-
scheinlich noch übertroffen hätte.
Erscheint es somit nicht nötig,
irgend welche Beteiligung Leo-
nardos an der Ausführung anzu-
nehmen, so bleibt freilich die Mög-
lichkeit übrig, daß er Preda durch
seinen Rat unterstützt habe. Doch
sehe ich auch zu einer solchen
Annahme nicht den mindesten
Grund, da die Änderungen in Hal-
tung und Bewegung der einzelnen
Gestalten, vor allem bei dem En-
gel, nicht der Art sind, daß sie
irgend alsVerbesserungen bezeich-
net werden könnten.1 Es bleibt
als Unterscheidungsmerkmal von dem Louvrebild nur der größere Liebreiz in den Köpfen übrig; ob
der aber, zumal wenn er, wie hier, durch eine größere geistige Leere erkauft wird, als Grund für eine
höhere Einschätzung anerkannt werden darf, erscheint doch sehr fraglich. Unser Geschlecht empfin-
det z. B. in dieser Hinsicht schon durchaus nicht mehr so, wie die Zeit Waagens es getan hat, da uns
Fig. 21. Weibliches Bildnis.
Mailand, Ambrosiana, Nr. 25.
1 Wölfflin, Die klassische Kunst, 1899, S. 21, Anm., sagt: «Die Weglassung der Hand (des Engels) im Londoner Bilde
ist im Sinne des späteren Schönheitsgefühles sehr begreiflich; indessen würde Leonardo, wenn er die neue Redaktion besorgt
hätte, die dadurch entstehende Lücke jedenfalls zu füllen gewußt haben: jetzt ist dort trotz der vorgeschobenen Schulter des
Engels ein Loch im Bilde».
W. von Seidlitz.
Reiz, der von den Köpfen des Engels und der Maria ausstrahlt (man vergleiche die großen Abbildun-
gen bei Müller-Walde, Nr. 60 A und C), sein Widerspiel in so manchen der Schöpfungen Predas,
wie z. B. in der, wenn auch noch etwas herberen Madonna Litta (Abb. bei Müller-Walde, Nr. 50),
wo das Jesuskind überdies nach demselben Modell gemalt zu sein scheint wie der Londoner Johannes-
knabe (nicht aber der Pariser). Die
bei Müller-Walde daneben ste-
hende Zeichnung Leonardos zum
Kopf der Madonna Litta (Nr. 51)
zeigt, obwohl sie schon von Preda
im Umriß übergangen ist, wie
sich die Auffassungsweise des Mei-
sters von der des Nachahmers da-
durch unterscheidet, daß bei je-
nem noch ein unergründlicher
Zauber weltfremder Melancholie
übrig bleibt, während dieser sein
Können in der Darstellung einer
unbewußten äußerlichen Anmut
erschöpft. Auch die stoffliche Wie-
dergabe des Armeis des Engels
kann Preda, der gerade auf solche
Einzelheiten besondere Sorgfalt
verwendete, sehr wohl zugemutet
werden, während Leonardo sie,
nach seinen Gewandzeichnungen
in Windsor zu schließen, wahr-
scheinlich noch übertroffen hätte.
Erscheint es somit nicht nötig,
irgend welche Beteiligung Leo-
nardos an der Ausführung anzu-
nehmen, so bleibt freilich die Mög-
lichkeit übrig, daß er Preda durch
seinen Rat unterstützt habe. Doch
sehe ich auch zu einer solchen
Annahme nicht den mindesten
Grund, da die Änderungen in Hal-
tung und Bewegung der einzelnen
Gestalten, vor allem bei dem En-
gel, nicht der Art sind, daß sie
irgend alsVerbesserungen bezeich-
net werden könnten.1 Es bleibt
als Unterscheidungsmerkmal von dem Louvrebild nur der größere Liebreiz in den Köpfen übrig; ob
der aber, zumal wenn er, wie hier, durch eine größere geistige Leere erkauft wird, als Grund für eine
höhere Einschätzung anerkannt werden darf, erscheint doch sehr fraglich. Unser Geschlecht empfin-
det z. B. in dieser Hinsicht schon durchaus nicht mehr so, wie die Zeit Waagens es getan hat, da uns
Fig. 21. Weibliches Bildnis.
Mailand, Ambrosiana, Nr. 25.
1 Wölfflin, Die klassische Kunst, 1899, S. 21, Anm., sagt: «Die Weglassung der Hand (des Engels) im Londoner Bilde
ist im Sinne des späteren Schönheitsgefühles sehr begreiflich; indessen würde Leonardo, wenn er die neue Redaktion besorgt
hätte, die dadurch entstehende Lücke jedenfalls zu füllen gewußt haben: jetzt ist dort trotz der vorgeschobenen Schulter des
Engels ein Loch im Bilde».