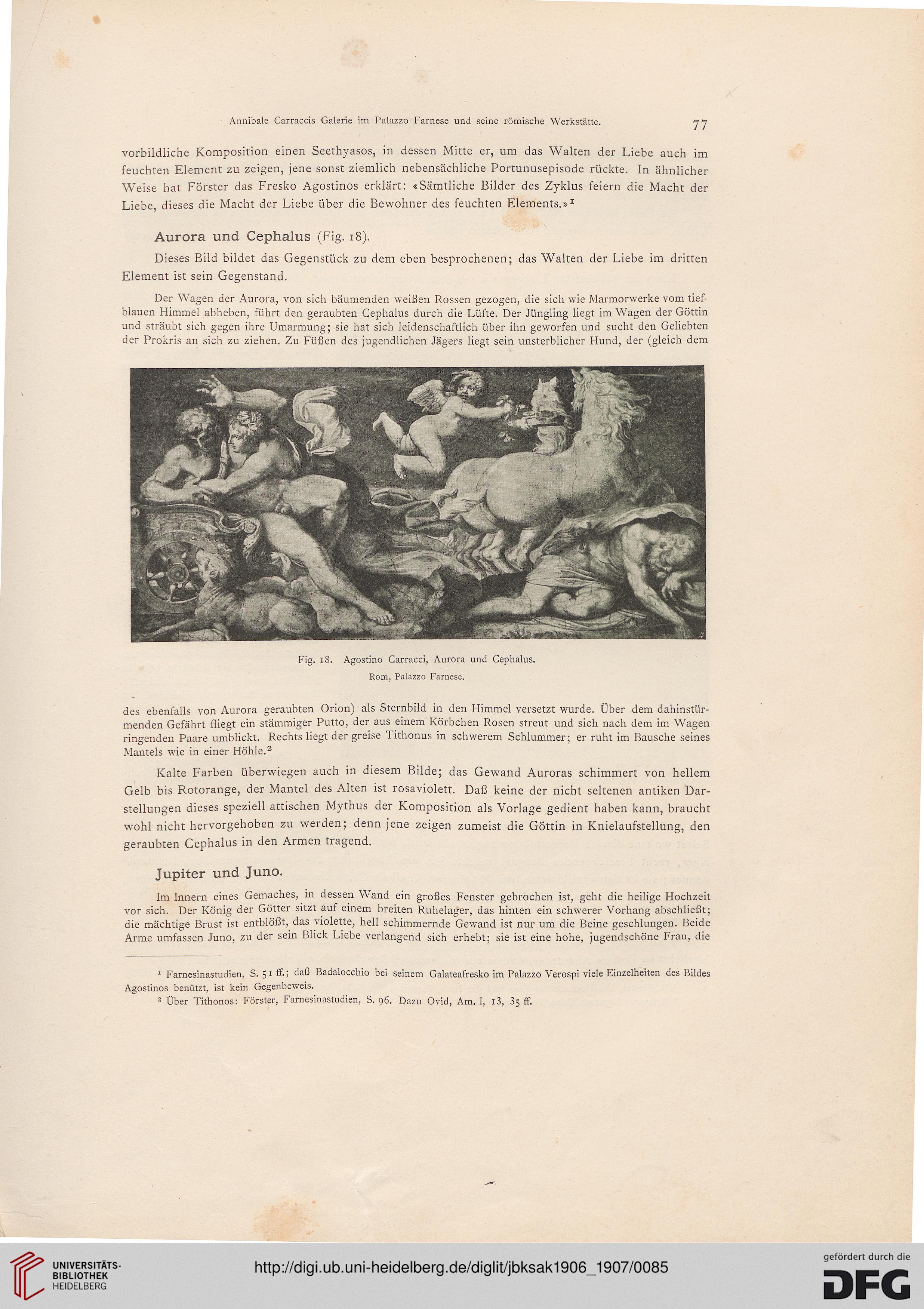Annibale Carraccis Galerie im Palazzo Farnese und seine römische Werkstättc.
77
vorbildliche Komposition einen Seethyasos, in dessen Mitte er, um das Walten der Liebe auch im
feuchten Element zu zeigen, jene sonst ziemlich nebensächliche Portunusepisode rückte. In ähnlicher
Weise hat Förster das Fresko Agostinos erklärt: «Sämtliche Bilder des Zyklus feiern die Macht der
Liebe, dieses die Macht der Liebe über die Bewohner des feuchten Elements.»1
Aurora und Cephalus (Fig. 18).
Dieses Bild bildet das Gegenstück zu dem eben besprochenen; das Walten der Liebe im dritten
Element ist sein Gegenstand.
Der Wagen der Aurora, von sich bäumenden weißen Rossen gezogen, die sich wie Marmorwerke vom tief-
blauen Himmel abheben, führt den geraubten Cephalus durch die Lüfte. Der Jüngling liegt im Wagen der Göttin
und sträubt sich gegen ihre Umarmung; sie hat sich leidenschaftlich über ihn geworfen und sucht den Geliebten
der Prokris an sich zu ziehen. Zu Füßen des jugendlichen Jägers liegt sein unsterblicher Hund, der (gleich dem
Fig. 18. Agostino Carracci, Aurora und Cephalus.
Rom, Palazzo Farnese.
des ebenfalls von Aurora geraubten Orion) als Sternbild in den Himmel versetzt wurde. Über dem dahinstür-
menden Gefährt fliegt ein stämmiger Putto, der aus einem Körbchen Rosen streut und sich nach dem im Wagen
ringenden Paare umblickt. Rechts liegt der greise Tithonus in schwerem Schlummer; er ruht im Bausche seines
Mantels wie in einer Höhle.2
Kalte Farben überwiegen auch in diesem Bilde; das Gewand Auroras schimmert von hellem
Gelb bis Rotorange, der Mantel des Alten ist rosaviolett. Daß keine der nicht seltenen antiken Dar-
stellungen dieses speziell attischen Mythus der Komposition als Vorlage gedient haben kann, braucht
wohl nicht hervorgehoben zu werden; denn jene zeigen zumeist die Göttin in Knielaufstellung, den
geraubten Cephalus in den Armen tragend.
Jupiter und Juno.
Im Innern eines Gemaches, in dessen Wand ein großes Fenster gebrochen ist, geht die heilige Hochzeit
vor sich. Der König der Götter sitzt auf einem breiten Ruhelager, das hinten ein schwerer Vorhang abschließt;
die mächtige Brust ist entblößt, das violette, hell schimmernde Gewand ist nur um die Beine geschlungen. Beide
Arme umfassen Juno, zu der sein Blick Liebe verlangend sich erhebt; sie ist eine hohe, jugendschöne Frau, die
1 Farnesinastudien, S. 5 i ff.; daß Badalocchio bei seinem Galateafresko im Palazzo Verospi viele Einzelheiten des Bildes
Agostinos benützt, ist kein Gegenbeweis.
2 Über Tithonos: Förster, Farnesinastudien, S. 96. Dazu Ovid, Am. I, i3, 35 ff.
77
vorbildliche Komposition einen Seethyasos, in dessen Mitte er, um das Walten der Liebe auch im
feuchten Element zu zeigen, jene sonst ziemlich nebensächliche Portunusepisode rückte. In ähnlicher
Weise hat Förster das Fresko Agostinos erklärt: «Sämtliche Bilder des Zyklus feiern die Macht der
Liebe, dieses die Macht der Liebe über die Bewohner des feuchten Elements.»1
Aurora und Cephalus (Fig. 18).
Dieses Bild bildet das Gegenstück zu dem eben besprochenen; das Walten der Liebe im dritten
Element ist sein Gegenstand.
Der Wagen der Aurora, von sich bäumenden weißen Rossen gezogen, die sich wie Marmorwerke vom tief-
blauen Himmel abheben, führt den geraubten Cephalus durch die Lüfte. Der Jüngling liegt im Wagen der Göttin
und sträubt sich gegen ihre Umarmung; sie hat sich leidenschaftlich über ihn geworfen und sucht den Geliebten
der Prokris an sich zu ziehen. Zu Füßen des jugendlichen Jägers liegt sein unsterblicher Hund, der (gleich dem
Fig. 18. Agostino Carracci, Aurora und Cephalus.
Rom, Palazzo Farnese.
des ebenfalls von Aurora geraubten Orion) als Sternbild in den Himmel versetzt wurde. Über dem dahinstür-
menden Gefährt fliegt ein stämmiger Putto, der aus einem Körbchen Rosen streut und sich nach dem im Wagen
ringenden Paare umblickt. Rechts liegt der greise Tithonus in schwerem Schlummer; er ruht im Bausche seines
Mantels wie in einer Höhle.2
Kalte Farben überwiegen auch in diesem Bilde; das Gewand Auroras schimmert von hellem
Gelb bis Rotorange, der Mantel des Alten ist rosaviolett. Daß keine der nicht seltenen antiken Dar-
stellungen dieses speziell attischen Mythus der Komposition als Vorlage gedient haben kann, braucht
wohl nicht hervorgehoben zu werden; denn jene zeigen zumeist die Göttin in Knielaufstellung, den
geraubten Cephalus in den Armen tragend.
Jupiter und Juno.
Im Innern eines Gemaches, in dessen Wand ein großes Fenster gebrochen ist, geht die heilige Hochzeit
vor sich. Der König der Götter sitzt auf einem breiten Ruhelager, das hinten ein schwerer Vorhang abschließt;
die mächtige Brust ist entblößt, das violette, hell schimmernde Gewand ist nur um die Beine geschlungen. Beide
Arme umfassen Juno, zu der sein Blick Liebe verlangend sich erhebt; sie ist eine hohe, jugendschöne Frau, die
1 Farnesinastudien, S. 5 i ff.; daß Badalocchio bei seinem Galateafresko im Palazzo Verospi viele Einzelheiten des Bildes
Agostinos benützt, ist kein Gegenbeweis.
2 Über Tithonos: Förster, Farnesinastudien, S. 96. Dazu Ovid, Am. I, i3, 35 ff.