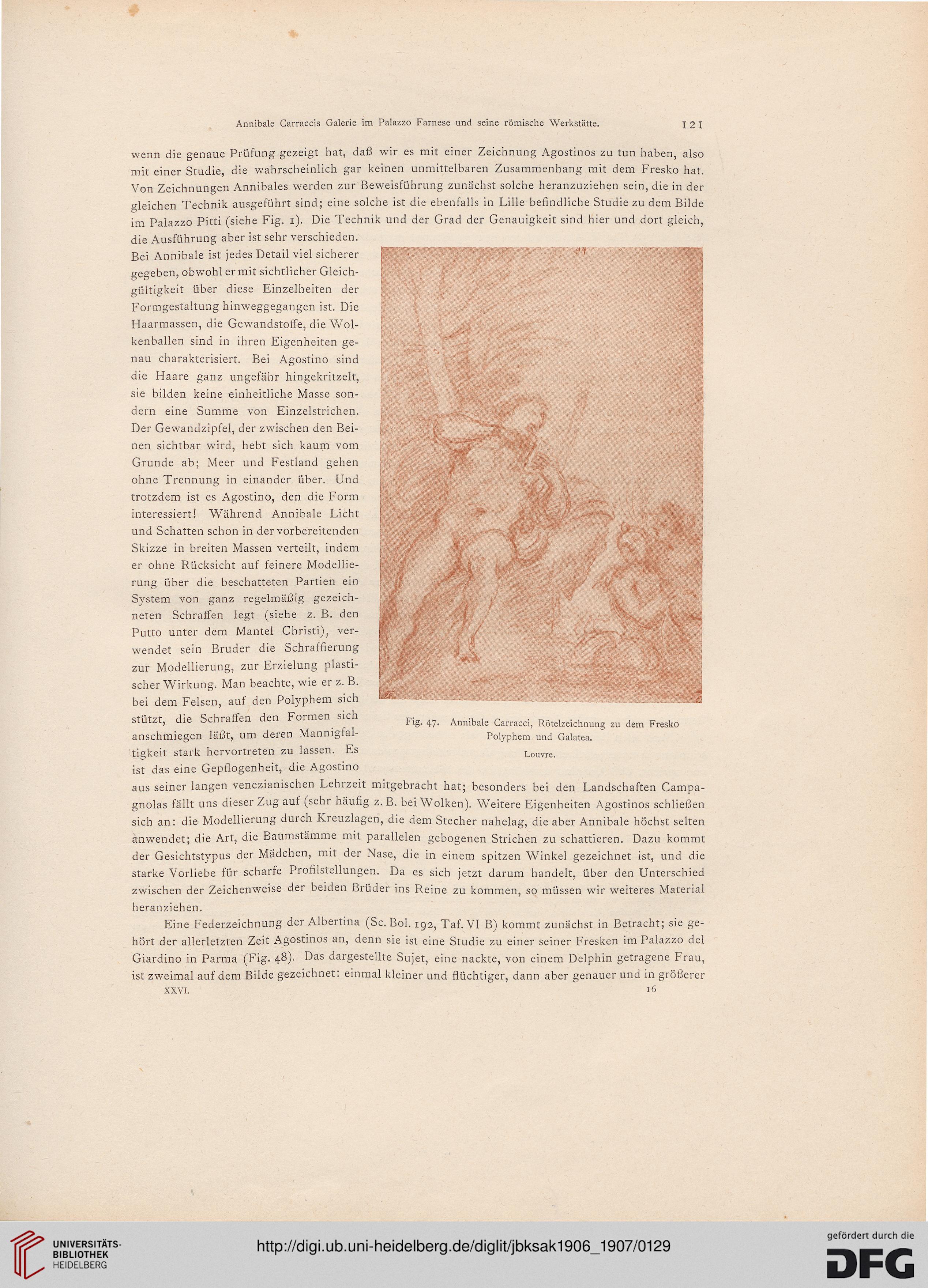Annibale Carraccis Galerie im Palazzo Farnese und seine römische Werkstätte.
121
wenn die genaue Prüfung gezeigt hat, daß wir es mit einer Zeichnung Agostinos zu tun haben, also
mit einer Studie, die wahrscheinlich gar keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Fresko hat.
Von Zeichnungen Annibales werden zur Beweisführung zunächst solche heranzuziehen sein, die in der
gleichen Technik ausgeführt sind; eine solche ist die ebenfalls in Lille befindliche Studie zu dem Bilde
im Palazzo Pitti (siehe Fig. i). Die Technik und der Grad der Genauigkeit sind hier und dort gleich,
die Ausführung aber ist sehr verschieden.
Bei Annibale ist jedes Detail viel sicherer
gegeben, obwohl er mit sichtlicher Gleich-
gültigkeit über diese Einzelheiten der
Formgestaltung hinweggegangen ist. Die
Haarmassen, die Gewandstoffe, die Wol-
kenballen sind in ihren Eigenheiten ge-
nau charakterisiert. Bei Agostino sind
die Haare ganz ungefähr hingekritzelt,
sie bilden keine einheitliche Masse son-
dern eine Summe von Einzelstrichen.
Der Gewandzipfel, der zwischen den Bei-
nen sichtbar wird, hebt sich kaum vom
Grunde ab; Meer und Festland gehen
ohne Trennung in einander über. Und
trotzdem ist es Agostino, den die Form
interessiert! Während Annibale Licht
und Schatten schon in der vorbereitenden
Skizze in breiten Massen verteilt, indem
er ohne Rücksicht auf feinere Modellie-
rung über die beschatteten Partien ein
System von ganz regelmäßig gezeich-
neten SchrafFen legt (siehe z. B. den
Putto unter dem Mantel Christi), ver-
wendet sein Bruder die Schraffierung
zur Modellierung, zur Erzielung plasti-
scher Wirkung. Man beachte, wie er z. B.
bei dem Felsen, auf den Polyphem sich
stützt, die Schraffen den Formen sich Fig. 47.
anschmiegen läßt, um deren Mannigfal-
tigkeit stark hervortreten zu lassen. Es
ist das eine Gepflogenheit, die Agostino
aus seiner langen venezianischen Lehrzeit mitgebracht hat; besonders bei den Landschaften Campa-
gnolas fällt uns dieser Zug auf (sehr häufig z.B. bei Wolken). Weitere Eigenheiten Agostinos schließen
sich an: die Modellierung durch Kreuzlagen, die dem Stecher nahelag, die aber Annibale höchst selten
anwendet; die Art, die Baumstämme mit parallelen gebogenen Strichen zu schattieren. Dazu kommt
der Gesichtstypus der Mädchen, mit der Nase, die in einem spitzen Winkel gezeichnet ist, und die
starke Vorliebe für scharfe Profilstellungen. Da es sich jetzt darum handelt, über den Unterschied
zwischen der Zeichenweise der beiden Brüder ms Reine zu kommen, so müssen wir weiteres Material
heranziehen.
Eine Federzeichnung der Albertina (Sc. Bol. 192, Taf. VI B) kommt zunächst in Betracht; sie ge-
hört der allerletzten Zeit Agostinos an, denn sie ist eine Studie zu einer seiner Fresken im Palazzo del
Giardino in Parma (Fig. 48). Das dargestellte Sujet, eine nackte, von einem Delphin getragene Frau,
ist zweimal auf dem Bilde gezeichnet: einmal kleiner und flüchtiger, dann aber genauer und in größerer
xxvi. 16
Annibale Carracci, Rötelzeichnung zu dem Fresko
Polyphem und Galatea.
Louvre.
121
wenn die genaue Prüfung gezeigt hat, daß wir es mit einer Zeichnung Agostinos zu tun haben, also
mit einer Studie, die wahrscheinlich gar keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Fresko hat.
Von Zeichnungen Annibales werden zur Beweisführung zunächst solche heranzuziehen sein, die in der
gleichen Technik ausgeführt sind; eine solche ist die ebenfalls in Lille befindliche Studie zu dem Bilde
im Palazzo Pitti (siehe Fig. i). Die Technik und der Grad der Genauigkeit sind hier und dort gleich,
die Ausführung aber ist sehr verschieden.
Bei Annibale ist jedes Detail viel sicherer
gegeben, obwohl er mit sichtlicher Gleich-
gültigkeit über diese Einzelheiten der
Formgestaltung hinweggegangen ist. Die
Haarmassen, die Gewandstoffe, die Wol-
kenballen sind in ihren Eigenheiten ge-
nau charakterisiert. Bei Agostino sind
die Haare ganz ungefähr hingekritzelt,
sie bilden keine einheitliche Masse son-
dern eine Summe von Einzelstrichen.
Der Gewandzipfel, der zwischen den Bei-
nen sichtbar wird, hebt sich kaum vom
Grunde ab; Meer und Festland gehen
ohne Trennung in einander über. Und
trotzdem ist es Agostino, den die Form
interessiert! Während Annibale Licht
und Schatten schon in der vorbereitenden
Skizze in breiten Massen verteilt, indem
er ohne Rücksicht auf feinere Modellie-
rung über die beschatteten Partien ein
System von ganz regelmäßig gezeich-
neten SchrafFen legt (siehe z. B. den
Putto unter dem Mantel Christi), ver-
wendet sein Bruder die Schraffierung
zur Modellierung, zur Erzielung plasti-
scher Wirkung. Man beachte, wie er z. B.
bei dem Felsen, auf den Polyphem sich
stützt, die Schraffen den Formen sich Fig. 47.
anschmiegen läßt, um deren Mannigfal-
tigkeit stark hervortreten zu lassen. Es
ist das eine Gepflogenheit, die Agostino
aus seiner langen venezianischen Lehrzeit mitgebracht hat; besonders bei den Landschaften Campa-
gnolas fällt uns dieser Zug auf (sehr häufig z.B. bei Wolken). Weitere Eigenheiten Agostinos schließen
sich an: die Modellierung durch Kreuzlagen, die dem Stecher nahelag, die aber Annibale höchst selten
anwendet; die Art, die Baumstämme mit parallelen gebogenen Strichen zu schattieren. Dazu kommt
der Gesichtstypus der Mädchen, mit der Nase, die in einem spitzen Winkel gezeichnet ist, und die
starke Vorliebe für scharfe Profilstellungen. Da es sich jetzt darum handelt, über den Unterschied
zwischen der Zeichenweise der beiden Brüder ms Reine zu kommen, so müssen wir weiteres Material
heranziehen.
Eine Federzeichnung der Albertina (Sc. Bol. 192, Taf. VI B) kommt zunächst in Betracht; sie ge-
hört der allerletzten Zeit Agostinos an, denn sie ist eine Studie zu einer seiner Fresken im Palazzo del
Giardino in Parma (Fig. 48). Das dargestellte Sujet, eine nackte, von einem Delphin getragene Frau,
ist zweimal auf dem Bilde gezeichnet: einmal kleiner und flüchtiger, dann aber genauer und in größerer
xxvi. 16
Annibale Carracci, Rötelzeichnung zu dem Fresko
Polyphem und Galatea.
Louvre.