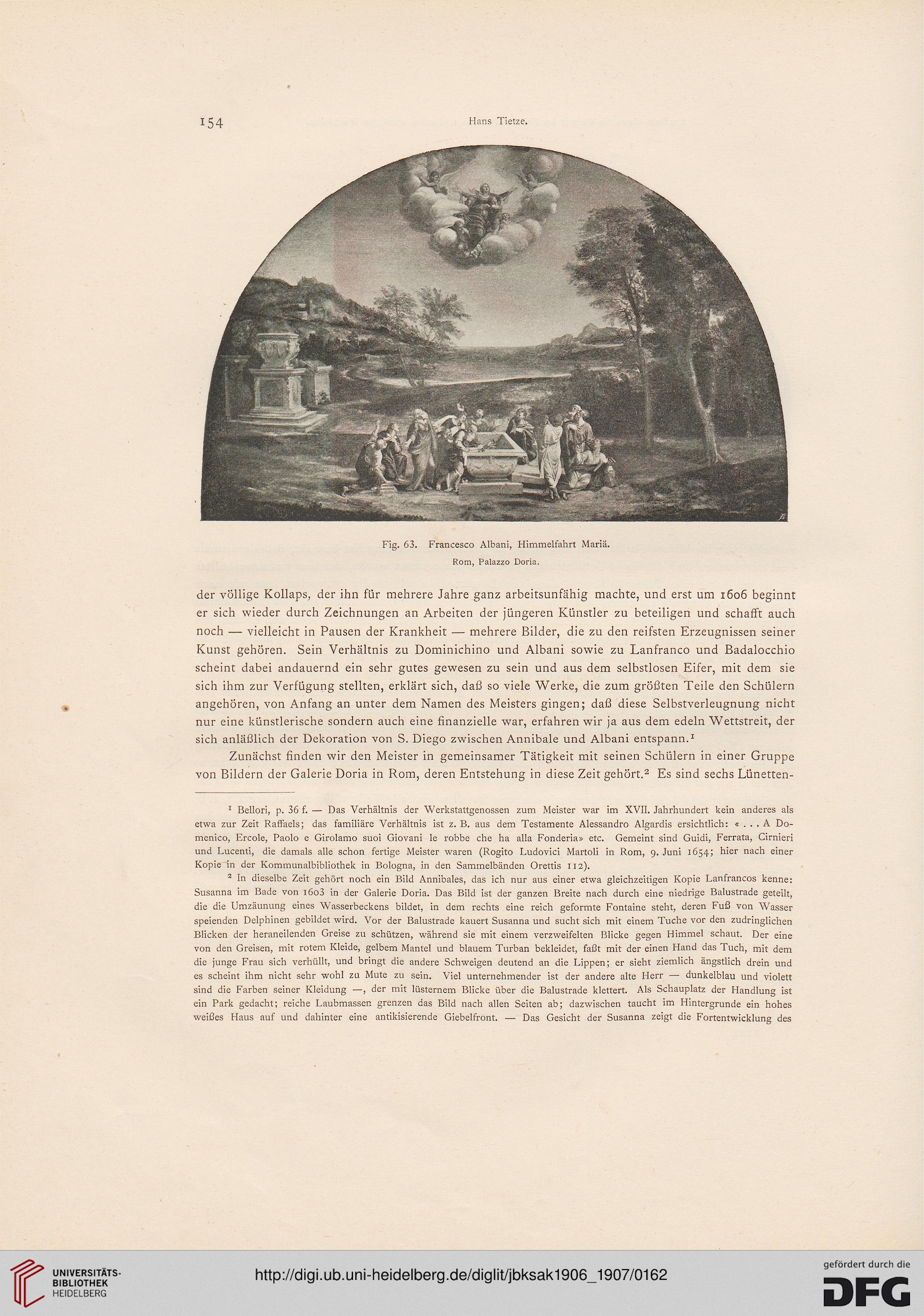154
Hans Hetze.
Fig. 63. Francesco Albani, Himmelfahrt Maria.
Rom, Palazzo Doria.
der völlige Kollaps, der ihn für mehrere Jahre ganz arbeitsunfähig machte, und erst um 1606 beginnt
er sich wieder durch Zeichnungen an Arbeiten der jüngeren Künstler zu beteiligen und schafft auch
noch — vielleicht in Pausen der Krankheit — mehrere Bilder, die zu den reifsten Erzeugnissen seiner
Kunst gehören. Sein Verhältnis zu Dominichino und Albani sowie zu Lanfranco und Badalocchio
scheint dabei andauernd ein sehr gutes gewesen zu sein und aus dem selbstlosen Eifer, mit dem sie
sich ihm zur Verfügung stellten, erklärt sich, daß so viele Werke, die zum größten Teile den Schülern
angehören, von Anfang an unter dem Namen des Meisters gingen; daß diese Selbstverleugnung nicht
nur eine künstlerische sondern auch eine finanzielle war, erfahren wir ja aus dem edeln Wettstreit, der
sich anläßlich der Dekoration von S. Diego zwischen Annibale und Albani entspann.1
Zunächst finden wir den Meister in gemeinsamer Tätigkeit mit seinen Schülern in einer Gruppe
von Bildern der Galerie Doria in Rom, deren Entstehung in diese Zeit gehört.2 Es sind sechs Lünetten-
1 Bellori, p. 36 f. — Das Verhältnis der Werkstattgenossen zum Meister war im XVII. Jahrhundert kein anderes als
etwa zur Zeit Raffaels; das familiäre Verhältnis ist z. B. aus dem Testamente Alessandro Algardis ersichtlich: « . . . A Do-
menico, Ercole, Paolo e Girolamo suoi Giovani le robbe che ha alla Fonderia» etc. Gemeint sind Guidi, Ferrata, Cirnieri
und Lucenti, die damals alle schon fertige Meister waren (Rogito Ludovici Martoli in Rom, 9. Juni 1654; hier nach einer
Kopie in der Kommunalbibliothek in Bologna, in den Sammelbänden Orettis 112).
2 In dieselbe Zeit gehört noch ein Bild Annibales, das ich nur aus einer etwa gleichzeitigen Kopie Lanfrancos kenne:
Susanna im Bade von i6o3 in der Galerie Doria. Das Bild ist der ganzen Breite nach durch eine niedrige Balustrade geteilt,
die die Umzäunung eines Wasserbeckens bildet, in dem rechts eine reich geformte Fontaine steht, deren Fuß von Wasser
speienden Delphinen gebildet wird. Vor der Balustrade kauert Susanna und sucht sich mit einem Tuche vor den zudringlichen
Blicken der heraneilenden Greise zu schützen, während sie mit einem verzweifelten Blicke gegen Himmel schaut. Der eine
von den Greisen, mit rotem Kleide, gelbem Mantel und blauem Turban bekleidet, faßt mit der einen Hand das Tuch, mit dem
die junge Frau sich verhüllt, und bringt die andere Schweigen deutend an die Lippen; er sieht ziemlich ängstlich drein und
es scheint ihm nicht sehr wohl zu Mute zu sein. Viel unternehmender ist der andere alte Herr — dunkelblau und violett
sind die Farben seiner Kleidung —, der mit lüsternem Blicke über die Balustrade klettert. Als Schauplatz der Handlung ist
ein Park gedacht; reiche Laubmassen grenzen das Bild nach allen Seiten ab; dazwischen taucht im Hintergrunde ein hohes
weißes Haus auf und dahinter eine antikisierende Giebelfront. — Das Gesicht der Susanna zeigt die Fortentwicklung des
Hans Hetze.
Fig. 63. Francesco Albani, Himmelfahrt Maria.
Rom, Palazzo Doria.
der völlige Kollaps, der ihn für mehrere Jahre ganz arbeitsunfähig machte, und erst um 1606 beginnt
er sich wieder durch Zeichnungen an Arbeiten der jüngeren Künstler zu beteiligen und schafft auch
noch — vielleicht in Pausen der Krankheit — mehrere Bilder, die zu den reifsten Erzeugnissen seiner
Kunst gehören. Sein Verhältnis zu Dominichino und Albani sowie zu Lanfranco und Badalocchio
scheint dabei andauernd ein sehr gutes gewesen zu sein und aus dem selbstlosen Eifer, mit dem sie
sich ihm zur Verfügung stellten, erklärt sich, daß so viele Werke, die zum größten Teile den Schülern
angehören, von Anfang an unter dem Namen des Meisters gingen; daß diese Selbstverleugnung nicht
nur eine künstlerische sondern auch eine finanzielle war, erfahren wir ja aus dem edeln Wettstreit, der
sich anläßlich der Dekoration von S. Diego zwischen Annibale und Albani entspann.1
Zunächst finden wir den Meister in gemeinsamer Tätigkeit mit seinen Schülern in einer Gruppe
von Bildern der Galerie Doria in Rom, deren Entstehung in diese Zeit gehört.2 Es sind sechs Lünetten-
1 Bellori, p. 36 f. — Das Verhältnis der Werkstattgenossen zum Meister war im XVII. Jahrhundert kein anderes als
etwa zur Zeit Raffaels; das familiäre Verhältnis ist z. B. aus dem Testamente Alessandro Algardis ersichtlich: « . . . A Do-
menico, Ercole, Paolo e Girolamo suoi Giovani le robbe che ha alla Fonderia» etc. Gemeint sind Guidi, Ferrata, Cirnieri
und Lucenti, die damals alle schon fertige Meister waren (Rogito Ludovici Martoli in Rom, 9. Juni 1654; hier nach einer
Kopie in der Kommunalbibliothek in Bologna, in den Sammelbänden Orettis 112).
2 In dieselbe Zeit gehört noch ein Bild Annibales, das ich nur aus einer etwa gleichzeitigen Kopie Lanfrancos kenne:
Susanna im Bade von i6o3 in der Galerie Doria. Das Bild ist der ganzen Breite nach durch eine niedrige Balustrade geteilt,
die die Umzäunung eines Wasserbeckens bildet, in dem rechts eine reich geformte Fontaine steht, deren Fuß von Wasser
speienden Delphinen gebildet wird. Vor der Balustrade kauert Susanna und sucht sich mit einem Tuche vor den zudringlichen
Blicken der heraneilenden Greise zu schützen, während sie mit einem verzweifelten Blicke gegen Himmel schaut. Der eine
von den Greisen, mit rotem Kleide, gelbem Mantel und blauem Turban bekleidet, faßt mit der einen Hand das Tuch, mit dem
die junge Frau sich verhüllt, und bringt die andere Schweigen deutend an die Lippen; er sieht ziemlich ängstlich drein und
es scheint ihm nicht sehr wohl zu Mute zu sein. Viel unternehmender ist der andere alte Herr — dunkelblau und violett
sind die Farben seiner Kleidung —, der mit lüsternem Blicke über die Balustrade klettert. Als Schauplatz der Handlung ist
ein Park gedacht; reiche Laubmassen grenzen das Bild nach allen Seiten ab; dazwischen taucht im Hintergrunde ein hohes
weißes Haus auf und dahinter eine antikisierende Giebelfront. — Das Gesicht der Susanna zeigt die Fortentwicklung des