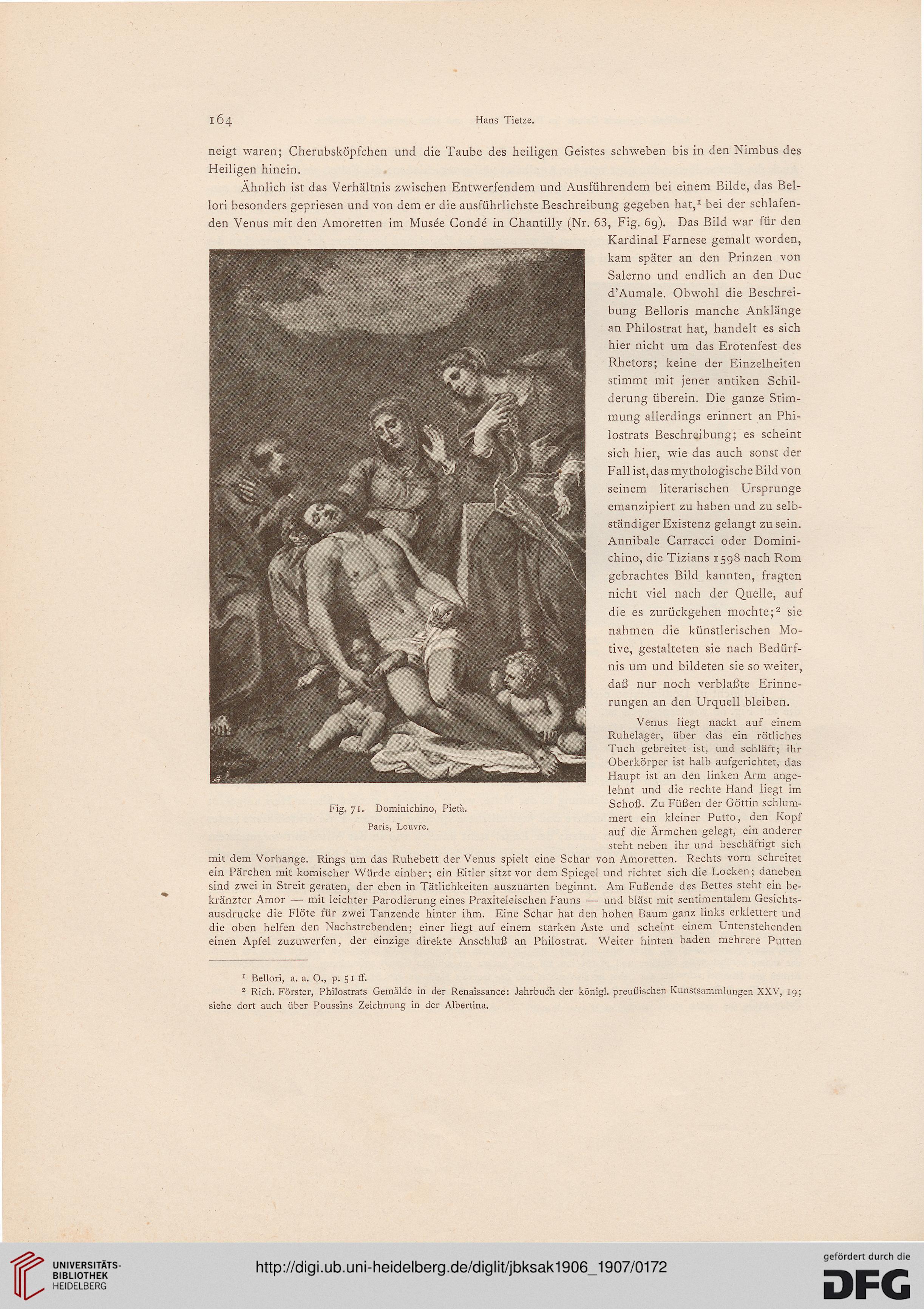IÖ4
Hans Tietze.
neigt waren; Cherubsköpfchen und die Taube des heiligen Geistes schweben bis in den Nimbus des
Heiligen hinein.
Ähnlich ist das Verhältnis zwischen Entwerfendem und Ausführendem bei einem Bilde, das Bel-
lori besonders gepriesen und von dem er die ausführlichste Beschreibung gegeben hat,1 bei der schlafen-
den Venus mit den Amoretten im Musee Conde in Chantilly (Nr. 63, Fig. 6g). Das Bild war für den
Kardinal Farnese gemalt worden,
kam später an den Prinzen von
Salerno und endlich an den Duc
d'Aumale. Obwohl die Beschrei-
bung Belloris manche Anklänge
an Philostrat hat, handelt es sich
hier nicht um das Erotenfest des
Rhetors; keine der Einzelheiten
stimmt mit jener antiken Schil-
derung überein. Die ganze Stim-
mung allerdings erinnert an Phi-
lostrats Beschreibung; es scheint
sich hier, wie das auch sonst der
Fall ist, das mythologische Bild von
seinem literarischen Ursprünge
emanzipiert zu haben und zu selb-
ständiger Existenz gelangt zu sein.
Annibale Carracci oder Domini-
chino, die Tizians 1598 nach Rom
gebrachtes Bild kannten, fragten
nicht viel nach der Quelle, auf
die es zurückgehen mochte;2 sie
nahmen die künstlerischen Mo-
tive, gestalteten sie nach Bedürf-
nis um und bildeten sie so weiter,
daß nur noch verblaßte Erinne-
rungen an den Urquell bleiben.
Venus liegt nackt auf einem
Ruhelager, über das ein rötliches
Tuch gebreitet ist, und schläft; ihr
Oberkörper ist halb aufgerichtet, das
Haupt ist an den linken Arm ange-
lehnt und die rechte Hand liegt im
Schoß. Zu Füßen der Göttin schlum-
mert ein kleiner Putto, den Kopf
auf die Ärmchen gelegt, ein anderer
steht neben ihr und beschäftigt sich
mit dem Vorhange. Rings um das Ruhebett der Venus spielt eine Schar von Amoretten. Rechts vorn schreitet
ein Pärchen mit komischer Würde einher; ein Eitler sitzt vor dem Spiegel und richtet sich die Locken; daneben
sind zwei in Streit geraten, der eben in Tätlichkeiten auszuarten beginnt. Am Fußende des Bettes steht ein be-
kränzter Amor — mit leichter Parodierung eines Praxiteleischen Fauns — und bläst mit sentimentalem Gesichts-
ausdrucke die Flöte für zwei Tanzende hinter ihm. Eine Schar hat den hohen Baum ganz links erklettert und
die oben helfen den Nachstrebenden; einer liegt auf einem starken Aste und scheint einem Untenstehenden
einen Apfel zuzuwerfen, der einzige direkte Anschluß an Philostrat. Weiter hinten baden mehrere Putten
Fig. 71.
Dominichino, Pietä.
Paris, Louvre.
1 Bellori, a. a. O., p. 51 ff.
2 Rieh. Förster, Philostrats Gemälde in der Renaissance: Jahrbuch der königl. preußischen Kunstsammlungen XXV, 19;
siehe dort auch über Poussins Zeichnung in der Albertina.
Hans Tietze.
neigt waren; Cherubsköpfchen und die Taube des heiligen Geistes schweben bis in den Nimbus des
Heiligen hinein.
Ähnlich ist das Verhältnis zwischen Entwerfendem und Ausführendem bei einem Bilde, das Bel-
lori besonders gepriesen und von dem er die ausführlichste Beschreibung gegeben hat,1 bei der schlafen-
den Venus mit den Amoretten im Musee Conde in Chantilly (Nr. 63, Fig. 6g). Das Bild war für den
Kardinal Farnese gemalt worden,
kam später an den Prinzen von
Salerno und endlich an den Duc
d'Aumale. Obwohl die Beschrei-
bung Belloris manche Anklänge
an Philostrat hat, handelt es sich
hier nicht um das Erotenfest des
Rhetors; keine der Einzelheiten
stimmt mit jener antiken Schil-
derung überein. Die ganze Stim-
mung allerdings erinnert an Phi-
lostrats Beschreibung; es scheint
sich hier, wie das auch sonst der
Fall ist, das mythologische Bild von
seinem literarischen Ursprünge
emanzipiert zu haben und zu selb-
ständiger Existenz gelangt zu sein.
Annibale Carracci oder Domini-
chino, die Tizians 1598 nach Rom
gebrachtes Bild kannten, fragten
nicht viel nach der Quelle, auf
die es zurückgehen mochte;2 sie
nahmen die künstlerischen Mo-
tive, gestalteten sie nach Bedürf-
nis um und bildeten sie so weiter,
daß nur noch verblaßte Erinne-
rungen an den Urquell bleiben.
Venus liegt nackt auf einem
Ruhelager, über das ein rötliches
Tuch gebreitet ist, und schläft; ihr
Oberkörper ist halb aufgerichtet, das
Haupt ist an den linken Arm ange-
lehnt und die rechte Hand liegt im
Schoß. Zu Füßen der Göttin schlum-
mert ein kleiner Putto, den Kopf
auf die Ärmchen gelegt, ein anderer
steht neben ihr und beschäftigt sich
mit dem Vorhange. Rings um das Ruhebett der Venus spielt eine Schar von Amoretten. Rechts vorn schreitet
ein Pärchen mit komischer Würde einher; ein Eitler sitzt vor dem Spiegel und richtet sich die Locken; daneben
sind zwei in Streit geraten, der eben in Tätlichkeiten auszuarten beginnt. Am Fußende des Bettes steht ein be-
kränzter Amor — mit leichter Parodierung eines Praxiteleischen Fauns — und bläst mit sentimentalem Gesichts-
ausdrucke die Flöte für zwei Tanzende hinter ihm. Eine Schar hat den hohen Baum ganz links erklettert und
die oben helfen den Nachstrebenden; einer liegt auf einem starken Aste und scheint einem Untenstehenden
einen Apfel zuzuwerfen, der einzige direkte Anschluß an Philostrat. Weiter hinten baden mehrere Putten
Fig. 71.
Dominichino, Pietä.
Paris, Louvre.
1 Bellori, a. a. O., p. 51 ff.
2 Rieh. Förster, Philostrats Gemälde in der Renaissance: Jahrbuch der königl. preußischen Kunstsammlungen XXV, 19;
siehe dort auch über Poussins Zeichnung in der Albertina.